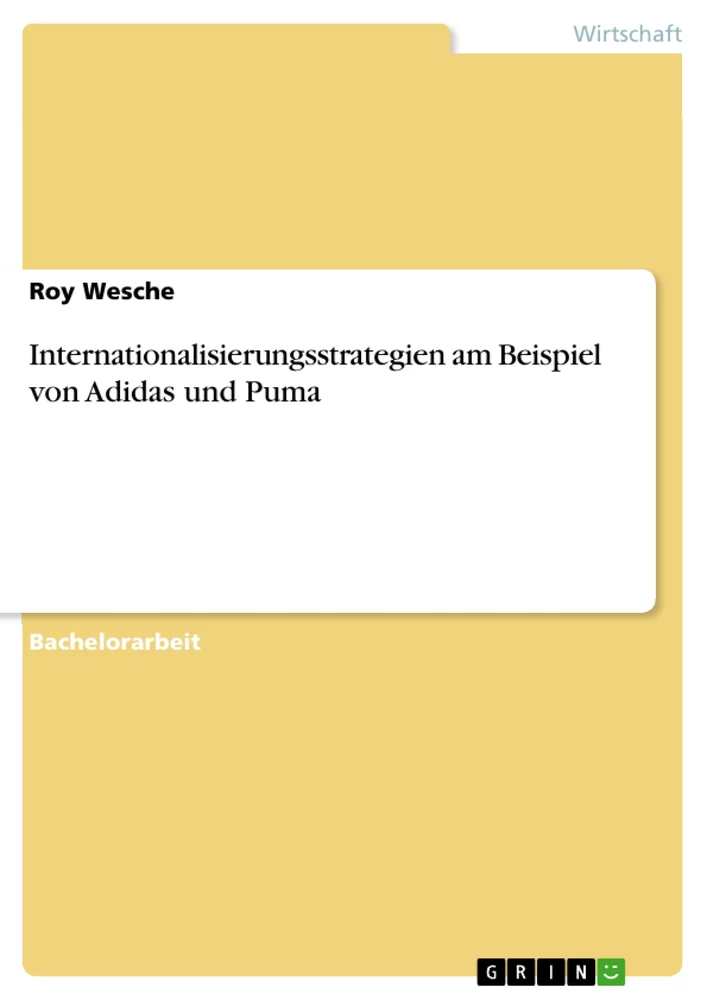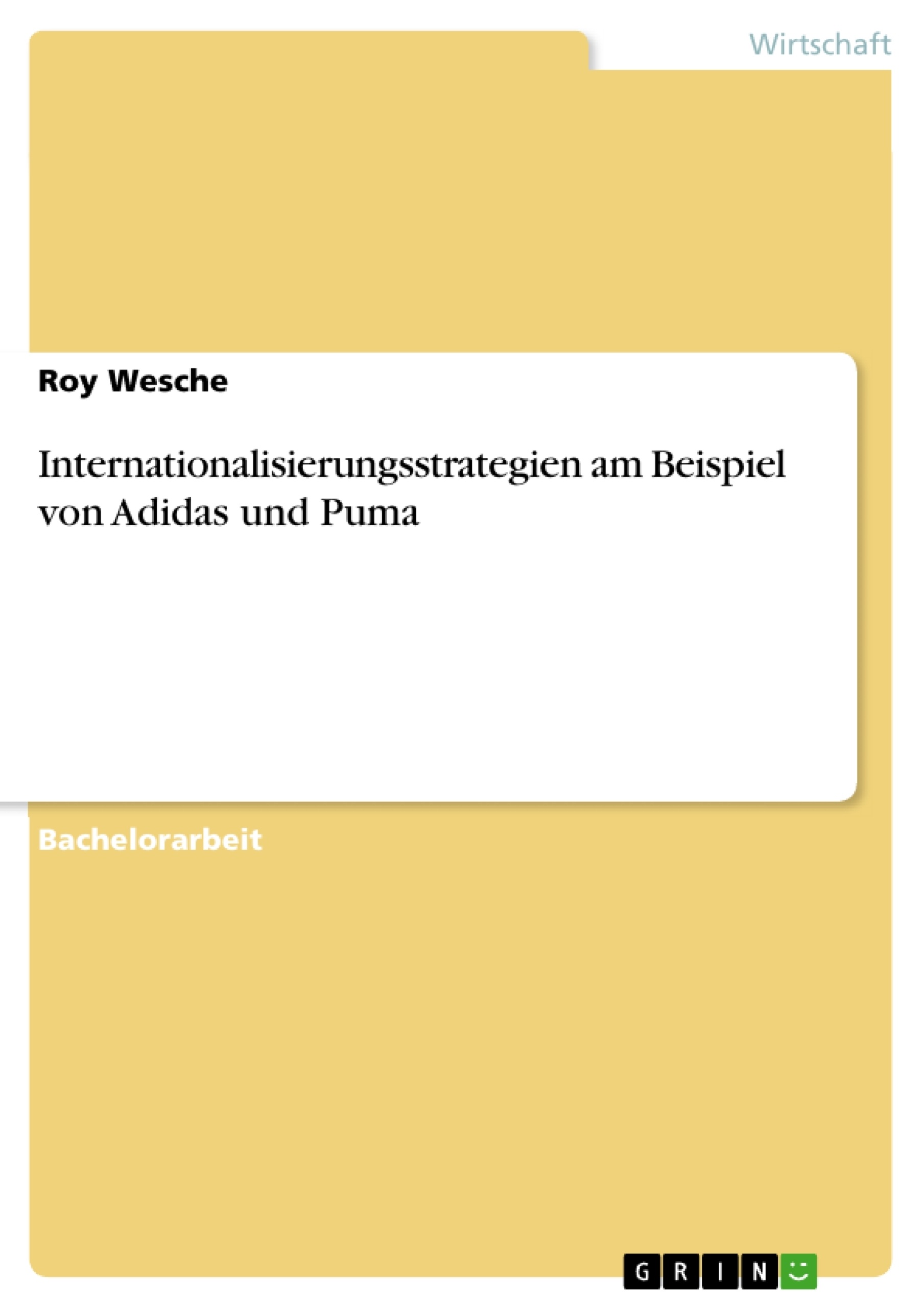Wir leben in einer Zeit, in der die Landesgrenzen, sowohl für die Bevölkerung als auch für die Wirtschaft, immer bedeutungsloser geworden sind. Internationale Produkte sind aus der heutigen Gesellschaft kaum noch wegzudenken. Der Außenhandel gewinnt zunehmend an Bedeutung. Mittlerweile wollen zwei Drittel der bereits im Ausland tätigen Unternehmen ihre Auslandsaktivitäten weiter ausbauen. Der Export spielt dabei eine zentrale Rolle. Er ist ganz klar das bedeutendste Element für Unternehmen zur Ausbreitung der Geschäftsaktivitäten auf internationale Märkte. Im Jahr 2011 haben bereits 91 Prozent aller im Ausland tätigen deutschen Unternehmen Waren exportiert. Zudem ist der Schritt ins Ausland über eine Zusammenarbeit mit selbständigen Kooperationspartnern sowie eine Zusammenarbeit mit ausländischen Zulieferern und Produzenten sehr beliebt. Ungefähr ein Drittel der im Ausland tätigen deutschen Unternehmen arbeiten im internationalen Markt mit rechtlich selbständigen Tochterunternehmen, sowie mit eigenen Niederlassungen.
Beliebtester Auslandsmarkt sind die westeuropäischen Länder. Weiterhin gewinnt der asiatische Markt zunehmend an Bedeutung für deutsche Unternehmen, dicht gefolgt von Russland und Osteuropa. Die USA sind mit knapp sieben Prozent Anteil am deutschen Export ebenso ein wichtiger Abnehmer und nach China der wichtigste Handelspartner für Deutschland außerhalb der EU.
Hinter der Ausweitung der Geschäftsaktivitäten über die Landesgrenzen steckt bei den meisten Unternehmen eine konkrete Strategie, die zur Erreichung unterschiedlicher Ziele eingesetzt wird. Deutsche Unternehmen verfolgen unterschiedlichste Strategien um im internationalen Konkurrenzkampf bestehen zu können: von einem Massenanbieter mit einem aggressiven Kostensenkungsprogramm über einen Premiumanbieter mit einzigartigen Produkteigenschaften bis hin zu einem Nischenanbieter, der sich auf ein bestimmtes Marktsegment konzentriert.
Internationalisierungsstrategien müssen bestimmten Anforderungen gerecht werden. Bei der Formulierung der Strategien sollten die 5 Stoßrichtungen der Internationalisierung beachtet werden (Markeintritts- und Marktbearbeitungsstrategien, Timingstrategien, Koordinationsstrategien, Zielmarktstrategie, Allokationsstrategie).
Auch die deutschen Sportartikelhersteller Adidas und Puma sind grenzüberschreitend tätig. Die Produktionen der beiden Unternehmen sind weltweit vertreten. Sowohl Puma als auch Adidas haben sich beinahe in ein virtuelles Unternehmen verwandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Problemstellung und Zielsetzung
- Methodisches Vorgehen
- Aufbau der Arbeit
- Internationalisierung
- Begriff Internationalisierung
- Motive/Ziele der Internationalisierung
- Problembereiche bei einer Internationalisierung
- Internationalisierungsstrategie
- Markteintritts- und Marktbearbeitungsstrategie
- Franchising
- Export
- Lizenzierung
- Joint Venture
- Tochtergesellschaft
- Das Konzept von Perlmutter
- Wettbewerbsvorteile
- Adidas
- Vorstellung des Unternehmens
- Internationalisierungsstrategie von Adidas
- Markteintritts-/Marktbearbeitungsstrategie Adidas
- Perlmutter Konzept bei Adidas
- Wettbewerbsstrategie Adidas nach Porter
- Branchenstruktur- und Wettbewerbsanalyse nach Porter
- Puma
- Vorstellung des Unternehmens
- Internationalisierungsstrategie von Puma
- Markteintritts-/Marktbearbeitungsstrategie Puma
- Perlmutter Konzept bei Puma
- Wettbewerbsstrategie Puma nach Porter
- Wettbewerbskräfte in der internationalen Sportartikelbranche
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorthesis befasst sich mit der Internationalisierungsstrategie von Adidas und Puma. Ziel der Arbeit ist es, die Internationalisierungsstrategien der beiden Unternehmen anhand verschiedener Modelle und Theorien zu analysieren und zu vergleichen. Dabei werden die Motive und Ziele der Internationalisierung, die gewählten Markteintritts- und Marktbearbeitungsstrategien sowie die Wettbewerbsstrategien der Unternehmen im Fokus stehen.
- Analyse der Internationalisierungsstrategien von Adidas und Puma
- Vergleich der Markteintritts- und Marktbearbeitungsstrategien
- Anwendung des Perlmutter-Konzepts auf die beiden Unternehmen
- Bewertung der Wettbewerbsstrategien nach Porter
- Identifizierung der wichtigsten Wettbewerbskräfte in der internationalen Sportartikelbranche
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit ein. Sie erläutert das methodische Vorgehen und den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel definiert den Begriff der Internationalisierung und beleuchtet die Motive und Ziele sowie die Problembereiche einer Internationalisierung. Das dritte Kapitel widmet sich der Internationalisierungsstrategie und stellt verschiedene Markteintritts- und Marktbearbeitungsstrategien vor. Das Konzept von Perlmutter wird ebenfalls erläutert. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Wettbewerbsvorteilen von Unternehmen. Das fünfte Kapitel analysiert die Internationalisierungsstrategie von Adidas. Es werden die Markteintritts- und Marktbearbeitungsstrategie sowie das Perlmutter-Konzept und die Wettbewerbsstrategie nach Porter betrachtet. Das sechste Kapitel widmet sich der Internationalisierungsstrategie von Puma. Es werden die Markteintritts- und Marktbearbeitungsstrategie, das Perlmutter-Konzept und die Wettbewerbsstrategie nach Porter analysiert. Das siebte Kapitel untersucht die Wettbewerbskräfte in der internationalen Sportartikelbranche. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Internationalisierungsstrategien, Adidas, Puma, Markteintrittsstrategien, Marktbearbeitungsstrategien, Perlmutter-Konzept, Wettbewerbsstrategie, Porter's Five Forces, Sportartikelbranche.
- Quote paper
- Roy Wesche (Author), 2014, Internationalisierungsstrategien am Beispiel von Adidas und Puma, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284502