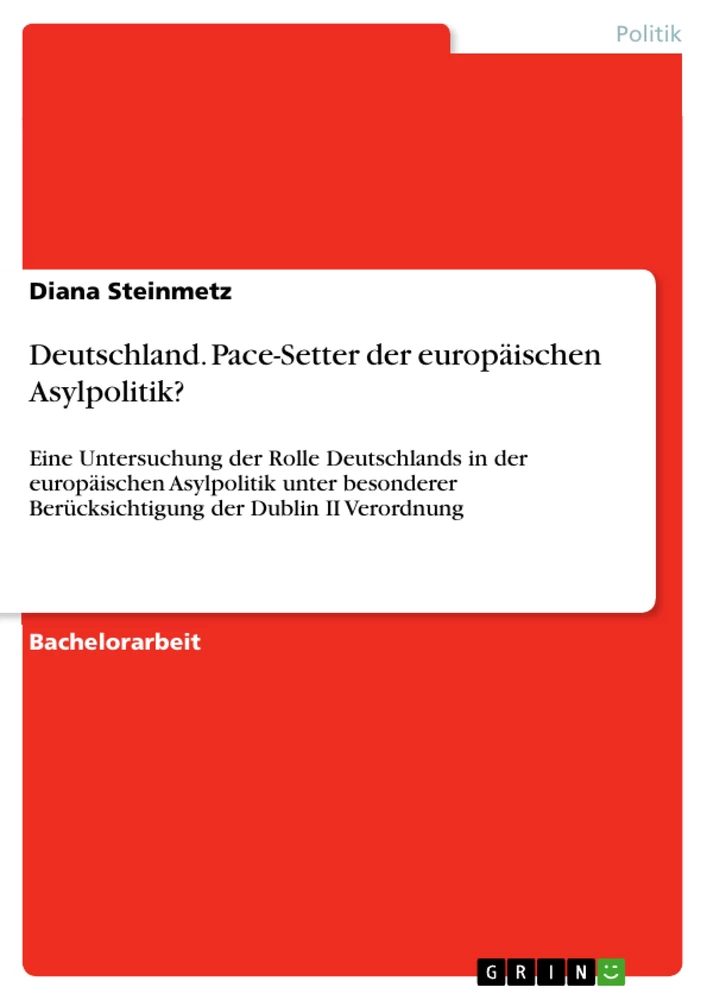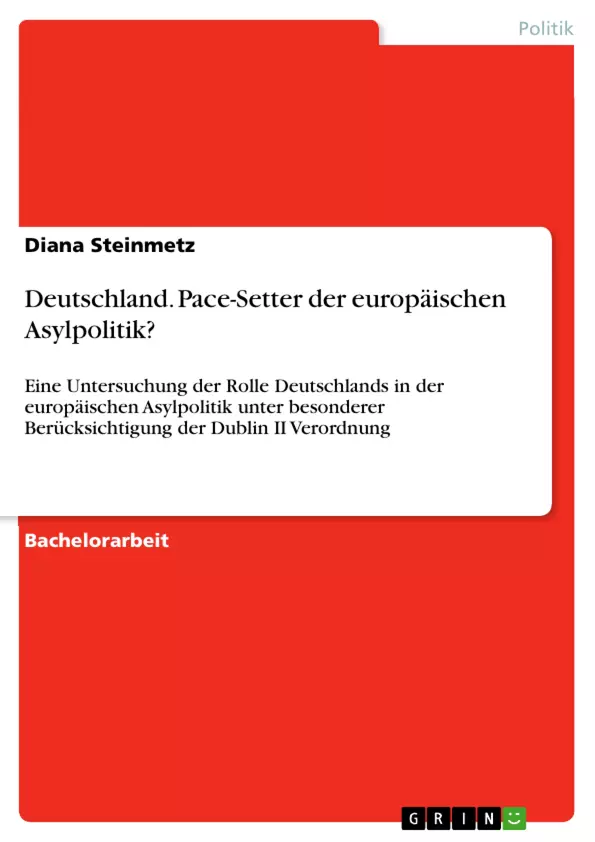„Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ heißt es in Artikel 16a Absatz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (GG). Damit hat die Bundesrepublik sich zum Ziel gesetzt, ihrer humanitären Verpflichtung nachzukommen und politische Flüchtlinge aufzunehmen. Bis zum Jahr 1993 war Deutschland das Land, das im europäischen Vergleich die meisten Flüchtlinge aufnahm. Mit Ausnahme des Jahres 1987 hat Deutschland bis 1993 fast die Hälfte aller Flüchtlinge in der Europäischen Union aufgenommen (Seifer 2009: 148-149; Schmidt 2001: 55).
Im Rahmen der Europäischen Union wird die Asylpolitik seit dem Amsterdamer Vertrag von 1997 als „vergemeinschafteter Politikbereich “ (Gerber 2004: 68) behandelt. Deutschland entscheidet daher nicht mehr souverän im Bereich der Flüchtlingspolitik, sondern in Abstimmung mit den anderen europäischen Mitgliedsstaaten. Die europäische Asylpolitik ist verglichen mit anderen Politikbereichen der Europäischen Union (EU) ein recht junges Aufgabenfeld und steht immer stärker im „Spannungsfeld zwischen der Verantwortung gegenüber schutzsuchenden Personen und der Sicherung des wirtschaftlichen Wohlstandes der Aufnahmestaaten“ (Jahn et al. 2006: 3).
Jüngste Ereignisse, wie das Schiffsunglück vor der Insel Lampedusa am 3.10.2013, bei dem über 300 Flüchtlinge ertranken, haben Diskussionen in Gesellschaft und Wissenschaft über die Asylpolitik ausgelöst Riedel 2013; Schmid 4.10.2013; Müller von Blumencron, Mathias 4.10.2013). Einige Autoren sehen die europäische Asylpolitik als gescheitert an (Riedel 2013; Kopp 2011). Daher ist es interessant, die deutsche Rolle in der europäischen Asylpolitik zu untersuchen. In der B.A.-Arbeit soll dem Thema unter besonderer Berücksichtigung der Dublin II Verordnung [Verordnung (EG) Nr. 343/2003] nachgegangen werden.
Betrachtet wird die Asylpolitik, nicht aber die Integrationspolitik, dies würde den Umfang einer B.A.-Arbeit sprengen, wenngleich beide Bereiche Teil der Migrationspolitik sind. Die Dublin II Verordnung des Rates der Europäischen Union ist zentral für die europäische Asylpolitik, denn sie legt die Kriterien und Verfahren fest, nach denen die Zuständigkeit eines Staates für die Bearbeitung eines Asylantrages bestimmt wird (Balzacq/Carrera 2005: 44). Die Verordnung wurde 2003 vom Europäischen Rat beschlossen.
Als theoretische Grundlage zur Analyse der Frage wird das Europäisierungskonzept nach Tanja Börzel verwendet (Börzel 2002: 193-214).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konzeptioneller Rahmen
- Europäisierung
- Pace-Setter, Foot-Dragger und Fence-Sitter
- Zentrale Begriffe
- Asylpolitik
- Asylant
- Die Dublin II Verordnung
- Die Rolle Deutschlands in der europäischen Asylpolitik unter besonderer Berücksichtigung der Dublin II Verordnung
- Die Rolle Deutschlands in der europäischen Asylpolitik
- Deutsche Asylpolitik
- Deutschlands Verhalten zu anderen europäischen Staaten
- Deutschlands Verhalten in europäischen Verhandlungen
- Die Rolle Deutschlands in der Dublin II Verordnung
- Deutsche Asylpolitik
- Deutschlands Verhalten zu anderen europäischen Staaten
- Deutschlands Verhalten in europäischen Verhandlungen
- Zwischenfazit
- Die Rolle Deutschlands in der europäischen Asylpolitik
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Rolle Deutschlands in der europäischen Asylpolitik unter besonderer Berücksichtigung der Dublin II Verordnung. Ziel ist es, zu analysieren, ob Deutschland als Pace-Setter in der europäischen Asylpolitik agiert und welche Rolle es im Kontext der Dublin II Verordnung einnimmt. Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der europäischen Asylpolitik, den zentralen Entscheidungen, an denen Deutschland beteiligt war, und dem Verhalten Deutschlands gegenüber anderen europäischen Staaten.
- Europäisierung der Asylpolitik
- Rolle Deutschlands in der europäischen Asylpolitik
- Dublin II Verordnung und ihre Auswirkungen
- Verhalten Deutschlands in europäischen Verhandlungen
- Pace-Setter-Rolle Deutschlands
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Relevanz der deutschen Rolle in der europäischen Asylpolitik dar. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Asylpolitik in Deutschland und die Bedeutung der Dublin II Verordnung. Der konzeptionelle Rahmen der Arbeit wird im zweiten Kapitel vorgestellt. Hier werden die zentralen Begriffe der Asylpolitik, wie Asylant und Dublin II Verordnung, definiert. Außerdem wird das Europäisierungskonzept nach Tanja Börzel erläutert, das als theoretische Grundlage für die Analyse der deutschen Rolle in der europäischen Asylpolitik dient. Das dritte Kapitel analysiert die Rolle Deutschlands in der europäischen Asylpolitik unter besonderer Berücksichtigung der Dublin II Verordnung. Es werden die zentralen Entscheidungen, an denen Deutschland beteiligt war, sowie das Verhalten Deutschlands gegenüber anderen europäischen Staaten untersucht. Das Kapitel beleuchtet auch die Auswirkungen der Dublin II Verordnung auf die deutsche Asylpolitik und die Rolle Deutschlands in den europäischen Verhandlungen. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen hinsichtlich der Rolle Deutschlands in der europäischen Asylpolitik.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die europäische Asylpolitik, die Rolle Deutschlands in der europäischen Asylpolitik, die Dublin II Verordnung, Pace-Setter, Foot-Dragger, Fence-Sitter, Europäisierung, Asylrecht, Flüchtlingspolitik, Integration, Migrationspolitik, Schengen-Raum, Europäische Union, Grundgesetz, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), UNHCR.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Dublin II Verordnung?
Die Dublin II Verordnung legt fest, welcher EU-Mitgliedstaat für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist – in der Regel der Staat, über den der Asylsuchende zuerst in die EU eingereist ist.
Agierte Deutschland als Pace-Setter in der Asylpolitik?
Die Arbeit untersucht, ob Deutschland durch nationale Standards und Initiativen die europäische Gesetzgebung aktiv vorangetrieben (Pace-Setting) oder eher gebremst hat.
Was bedeutet "Europäisierung" im Kontext der Asylpolitik?
Es beschreibt den Prozess, bei dem nationale Asylpolitiken zunehmend durch EU-Vorgaben harmonisiert werden und Zuständigkeiten von der nationalen auf die europäische Ebene verlagert werden.
Warum ist der Amsterdamer Vertrag von 1997 wichtig für das Asylrecht?
Mit diesem Vertrag wurde die Asylpolitik zu einem vergemeinschafteten Politikbereich der EU, was die gemeinsame Entscheidungsfindung stärkte.
Welches Spannungsfeld prägt die europäische Asylpolitik?
Es besteht ein Konflikt zwischen der humanitären Verpflichtung gegenüber Schutzsuchenden und dem Interesse der Staaten an Grenzsicherung und wirtschaftlichem Wohlstand.
- Quote paper
- Diana Steinmetz (Author), 2014, Deutschland. Pace-Setter der europäischen Asylpolitik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284544