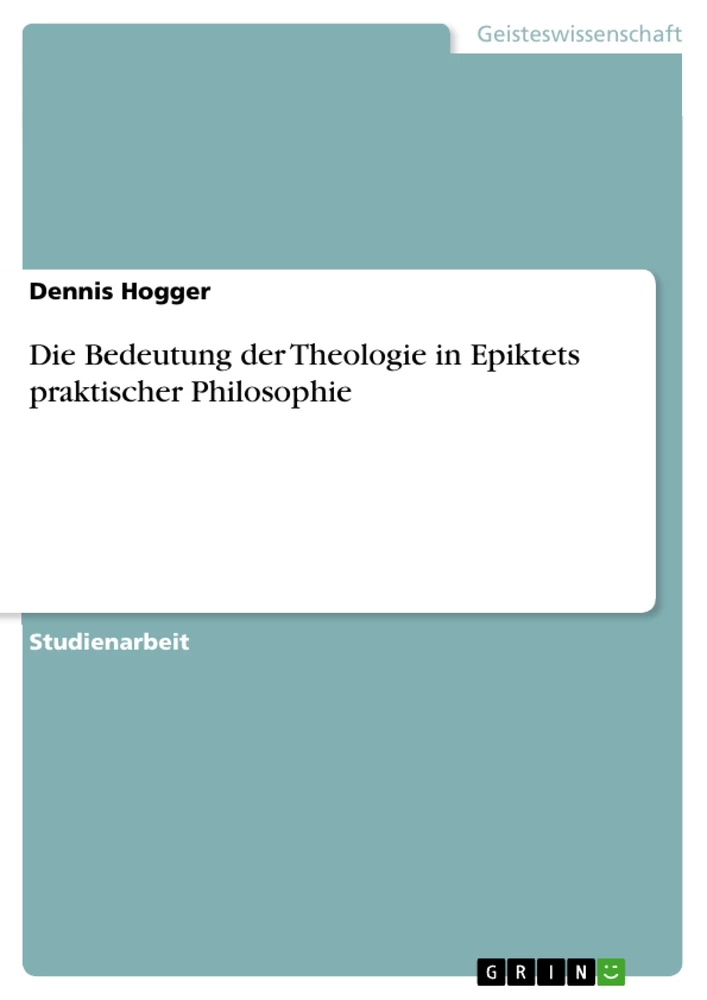Günther Bien schreibt über die Philosophie der Stoa und der Epikureer, erst bei ihnen würde sich die antike Philosophie – ganz im Gegensatz zu den Vorsokratikern, den klassischen Philosophen Platon und Aristoteles sowie der von ihnen begründeten Schulen der Akademie und Peripatos – völlig und ausschließlich auf ihren praktischen Aspekt, der „Unterweisung in der ars vivendi“ (Bien 1994, 71), konzentrieren. Selbst die scheinbar theoretischen Spielarten der Philosophie würden „ausschließlich funktional auf die Begründung und Verteidigung“ (ebd.) der ethischen und moralischen Ansichten der stoischen und epikureischen Philosophen bezogen sein.
Was Bien schreibt, gilt auch für den stoischen, kaiserzeitlichen Philosophen Epiktet (ca. 50 – 135 n.Chr.). Den von seinem Schüler Arrian geschriebenen Lehrbüchern, den Diatriben und dem Handbuch, merkt man einen dominanten Fokus auf praktische, lebensweltliche Probleme an. Insbesondere das Handbuch wirkt stellenweise wie eine Aufzählung recht simpler Lebensweisheiten, die zur Glückseligkeit führen sollen.
Diesem Eindruck steht jedoch im Weg, dass sich v.a. in den Diatriben Abschnitte finden, die auf den ersten Blick rein theoretisch motiviert erscheinen. Dazu gehören beispielsweise die Abschnitte über Logik (z.B. D 1.17, D 2.12) oder über Theologie (z.B. D 1.6, D 1.14, D 1.16).
Ich möchte in dieser Arbeit exemplarisch zeigen, dass der erste Eindruck trügt, und selbst die Gegenstände theoretischer Philosophie – gemäß der Ansicht Günther Biens – bei Epiktet in Zusammenhang mit seinen praktisch-philosophischen Vorstellungen stehen. Ich werde mich dabei auf einige Aspekte von Epiktets Theologie konzentrieren, die sich in einen begründungslogischen Zusammenhang mit einigen seiner praktischen Grundsätze bringen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gott als Welterschaffer und Weltenlenker
- Die Grenze der göttlichen Determination in der Prohairesis
- Die bestmögliche Welt und das Problem der Theodizee
- Die theologischen Prämissen von Epiktets praktischer Philosophie
- Die Angleichung des eigenen Willens an den Willen Gottes
- Das Wissen vom Eigenen und vom Fremden
- Freiheit und Glückseligkeit als Konsequenz
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verbindung zwischen Epiktets theoretischer und praktischer Philosophie, insbesondere im Kontext seiner theologischen Ansichten. Sie widerlegt die Annahme, dass Epiktets scheinbar theoretische Ausführungen losgelöst von seinen praktischen Lehren stehen. Stattdessen wird gezeigt, wie seine theologischen Konzepte seine praktischen Ratschläge zur Erlangung von Glückseligkeit begründen und stützen.
- Epiktets Gottesbild und dessen Rolle als Welterschaffer und -lenker
- Die Grenzen der göttlichen Determination und der Bereich der menschlichen Prohairesis (Willensfreiheit)
- Die Vorstellung der Welt als bestmögliche Welt und die damit verbundene Theodizee
- Die praktischen Konsequenzen der theologischen Prämissen für das menschliche Handeln
- Die Verbindung zwischen Freiheit, Glückseligkeit und der Angleichung des eigenen Willens an den Willen Gottes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die These auf, dass selbst die scheinbar theoretischen Aspekte von Epiktets Philosophie, wie seine theologischen Überlegungen, eng mit seinen praktischen Lehren zur ars vivendi verbunden sind. Sie skizziert den Forschungsansatz, der sich auf die exemplarische Untersuchung einiger Aspekte von Epiktets Theologie konzentriert, um deren begründungslogischen Zusammenhang mit seinen praktischen Grundsätzen aufzuzeigen. Die Arbeit fokussiert auf die Darstellung der göttlichen Macht als Welterschaffer und -lenker, die Grenzen dieser Macht im Bereich der menschlichen Prohairesis und die daraus resultierenden praktischen Konsequenzen für das menschliche Streben nach Glückseligkeit.
Gott als Welterschaffer und Weltenlenker: Dieses Kapitel argumentiert, basierend auf Epiktets Diatriben, für die Existenz Gottes als Schöpfer und Lenker der Welt. Epiktet verwendet teleologische Argumente, indem er die sinnvolle Verknüpfung einzelner Dinge in der Welt als Beweis für einen intelligenten Designer anführt. Ähnliche Argumentationslinien werden verwendet, um die permanente Steuerung der Welt durch Gott zu begründen, basierend auf der beobachtbaren Regularität in Natur und Kosmos. Obwohl die Welt von Gott gelenkt wird, wird die absolute Determination der gesamten Welt von Epiktet abgelehnt; dieser Punkt wird im folgenden Kapitel weiter vertieft.
Die Grenze der göttlichen Determination in der Prohairesis: Dieses Kapitel behandelt die zentrale Frage der Willensfreiheit im Kontext der göttlichen Determination. Epiktet postuliert die Prohairesis als den Bereich menschlicher Freiheit, der mentale Operationen wie Entscheidung, Begehren und Zustimmung umfasst. Dieser Bereich ist, laut Epiktet, selbst von göttlicher Macht nicht beeinflussbar. Es wird argumentiert, dass diese Freiheit nicht eine Schwäche Gottes darstellt, sondern eine bewusste Selbstbeschränkung, die Gott dem Menschen gewährt hat. Die Unabhängigkeit der Prohairesis von äußeren Einflüssen wird als entscheidend für Epiktets praktische Philosophie hervorgehoben, da sie die Grundlage für moralisches Handeln und die Erlangung von Glückseligkeit bildet. Der Fokus liegt auf der Unbeeinflussbarkeit der Prohairesis durch äußere Faktoren, einschließlich göttlicher Determination.
Die bestmögliche Welt und das Problem der Theodizee: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach dem Bestehen von Leid in einer von einem allmächtigen und allgütigen Gott gelenkten Welt. Ausgehend von der Prämisse, dass Gott vernünftig und das Vernünftige gut ist, und dass Gott die Welt steuert, wird die Schlussfolgerung gezogen, dass die Welt in ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit eine bestmögliche ist. Das Kapitel untersucht, wie diese Sichtweise mit dem Problem des Leids in Einklang gebracht werden kann. Es wird argumentiert, dass das Verständnis der göttlichen Ordnung und die Akzeptanz des Weltgeschehens essentiell sind, um das Leid zu bewältigen und Glückseligkeit zu finden.
Schlüsselwörter
Epiktet, Stoa, Prohairesis, Willensfreiheit, göttliche Determination, Theodizee, bestmögliche Welt, praktische Philosophie, Glückseligkeit, ars vivendi, Gott, Weltordnung.
Häufig gestellte Fragen zu: Epiktets theologische und praktische Philosophie
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verbindung zwischen Epiktets theoretischer und praktischer Philosophie, insbesondere seiner theologischen Ansichten. Sie zeigt, dass seine theologischen Konzepte seine praktischen Lehren zur Erlangung von Glückseligkeit begründen und stützen, im Gegensatz zur Annahme einer Loslösung beider Bereiche.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt Epiktets Gottesbild als Welterschaffer und -lenker, die Grenzen der göttlichen Determination im Bereich der menschlichen Prohairesis (Willensfreiheit), die Vorstellung der Welt als bestmögliche Welt und die damit verbundene Theodizee, sowie die praktischen Konsequenzen der theologischen Prämissen für das menschliche Handeln und den Zusammenhang zwischen Freiheit, Glückseligkeit und der Angleichung des eigenen Willens an den Willen Gottes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Gott als Welterschaffer und -lenker, die Grenzen der göttlichen Determination in der Prohairesis, die bestmögliche Welt und das Problem der Theodizee, sowie ein abschließendes Kapitel. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Wie beschreibt die Arbeit Epiktets Gottesbild?
Die Arbeit beschreibt Gott bei Epiktet als Schöpfer und Lenker der Welt, basierend auf teleologischen Argumenten (sinnvolle Verknüpfung der Dinge). Obwohl Gott die Welt lenkt, wird eine absolute Determination abgelehnt. Gottes Lenkung der Welt basiert auf der beobachtbaren Regularität in Natur und Kosmos.
Wie wird die Frage der Willensfreiheit behandelt?
Die Prohairesis, der Bereich menschlicher Freiheit (Entscheidung, Begehren, Zustimmung), ist laut Epiktet selbst von göttlicher Macht nicht beeinflussbar. Diese Freiheit wird nicht als Schwäche Gottes, sondern als bewusste Selbstbeschränkung interpretiert und ist die Grundlage für moralisches Handeln und Glückseligkeit.
Wie wird das Problem der Theodizee angegangen?
Die Arbeit argumentiert, dass die Welt, da Gott vernünftig und das Vernünftige gut ist, in ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit eine bestmögliche Welt darstellt. Das Leid wird in diesem Kontext betrachtet und die Akzeptanz des Weltgeschehens als essentiell für die Bewältigung von Leid und das Finden von Glückseligkeit dargestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Epiktet, Stoa, Prohairesis, Willensfreiheit, göttliche Determination, Theodizee, bestmögliche Welt, praktische Philosophie, Glückseligkeit, ars vivendi, Gott und Weltordnung.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit widerlegt die Annahme, dass Epiktets theoretische und praktische Philosophie getrennt voneinander betrachtet werden können. Sie zeigt den engen Zusammenhang zwischen seinen theologischen Überlegungen und seinen praktischen Lehren zur ars vivendi auf.
- Citar trabajo
- Dennis Hogger (Autor), 2014, Die Bedeutung der Theologie in Epiktets praktischer Philosophie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284730