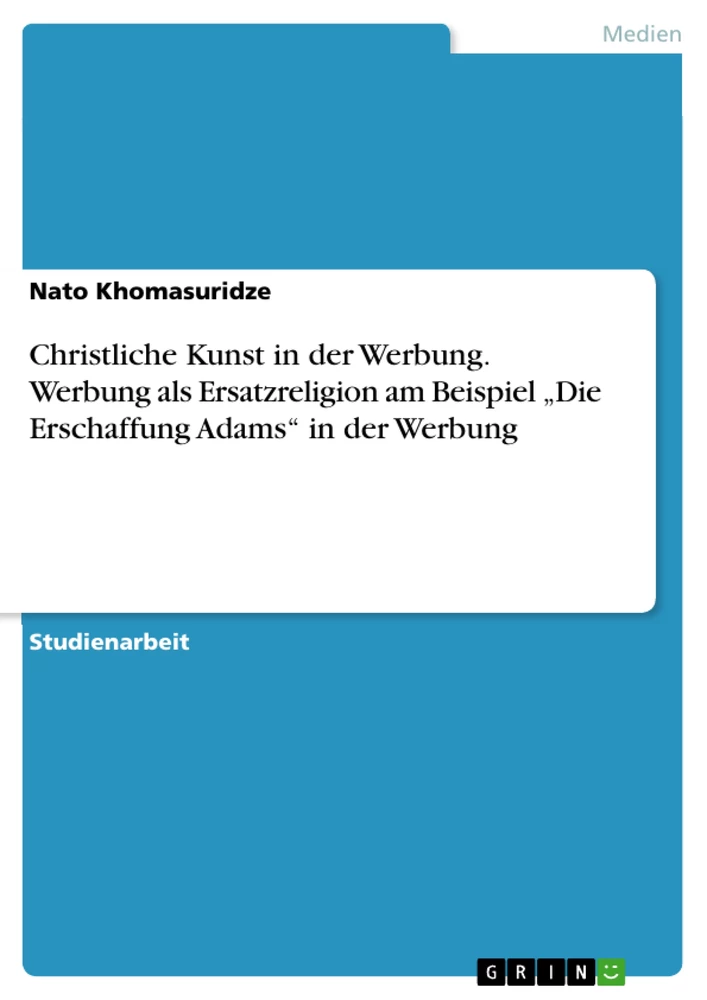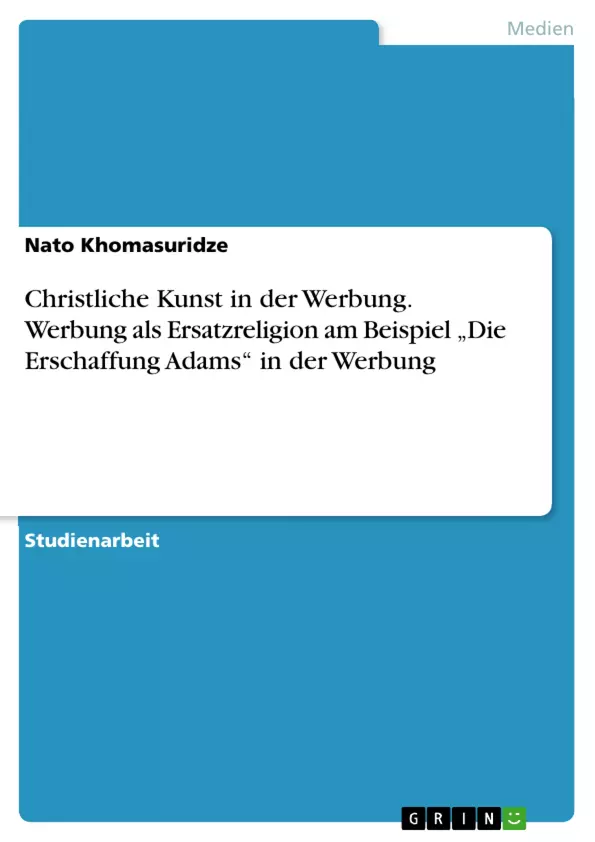Der Anspruch der Religion, im Leben der Menschen sinnstiftend zu wirken, wird auch in unserer heutigen Mediengesellschaft aufrechterhalten, die zugleich in hohem Ausmaß auch als Werbegesellschaft bezeichnet werden kann. Der Ausspruch des bekannten evangelischen Religionspädagogen Gerd Buschmann über die Allgegenwärtigkeit der Werbung lässt die Frage aufkommen, wie die Religion diesen Anspruch behaupten kann, besonders auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir in der Werbung ständig mit Gott und Religion konfrontiert werden: Produkte werden mit Hilfe von Religion beworben. Werbestrategen bauen auf den Bekanntheitsgrad von Engeln und Teufeln, Apfel und Schlange, Himmel und Hölle – und ein Großteil der heutigen Medienkonsumenten schaut sich diese Werbung täglich an, ob in der Werbepause von TV-Sendungen oder in Zeitschriften. Aber auch die Werbung, die ihre Aussage mit Hilfe religiöser Motive vermittelt, will nicht die Botschaft der Religion vermitteln, sondern den Betrachter so manipulieren, dass er die beworbenen Produkte kauft.
Neutraler formuliert dient Werbung allgemein der Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren eines Marktes. In den meisten Fällen sind das die Unternehmen als Anbieter und die potentiellen Konsumenten des jeweiligen Angebots, die der Anbieter über seine Produkte informieren und vom Erwerb/ Konsum seiner Produkte überzeugen will.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung und Komplexität der Beziehung zwischen Religion und Werbung
- Mögliche Verwendung und Funktionen der Religion in der Werbung
- ,,Die Erschaffung Adams"
- Vorikonographische Beschreibung
- Bildaufbau
- Formale Bildbeschreibung
- Inhaltliche (ikonografische) Bildanalyse
- „Die Erschaffung Adams“ in der Werbung
- Zusammenfassung
- Literatur
- Abbildungsverzeichnis
- Abbildungsanhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der komplexen Beziehung zwischen Religion und Werbung. Sie untersucht, wie religiöse Motive in der Werbung verwendet werden und welche Funktionen sie dabei erfüllen. Dabei wird insbesondere das Fresko „Die Erschaffung Adams“ von Michelangelo analysiert und dessen Verwendung in der Werbung betrachtet. Die Arbeit zielt darauf ab, die Interaktion zwischen Religion und Werbung zu beleuchten und zu analysieren, ob es sich um eine einseitige Ausnutzung der Religion durch die Werbung handelt oder ob auch die Religion von dieser Beziehung profitieren kann.
- Die Verwendung religiöser Motive in der Werbung
- Die Funktionen von Religion in der Werbung
- Die Analyse des Freskos „Die Erschaffung Adams“
- Die Verwendung des Freskos „Die Erschaffung Adams“ in der Werbung
- Die ethischen und gesellschaftlichen Implikationen der Beziehung zwischen Religion und Werbung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik dar und führt in die Problematik der Beziehung zwischen Religion und Werbung ein. Sie beleuchtet die Allgegenwärtigkeit der Werbung in unserer Gesellschaft und stellt die Frage, wie die Religion in diesem Kontext ihren sinnstiftenden Anspruch behaupten kann.
Das erste Kapitel befasst sich mit der Entwicklung und Komplexität der Beziehung zwischen Religion und Werbung. Es werden verschiedene Perspektiven auf diese Beziehung beleuchtet, von der kritischen Sichtweise, die Werbung als eine Art Ersatzreligion betrachtet, bis hin zu werbungsfreundlichen Ansätzen, die die Möglichkeiten der Werbung für die Kirche sehen. Das Kapitel beleuchtet auch die ethischen und gesellschaftlichen Implikationen der Beziehung zwischen Religion und Werbung.
Das zweite Kapitel untersucht mögliche Verwendungen und Funktionen der Religion in der Werbung. Es werden verschiedene Beispiele dafür angeführt, wie religiöse Motive in der Werbung eingesetzt werden, um Produkte zu bewerben und Konsumenten anzusprechen. Dabei werden auch die ethischen und moralischen Aspekte dieser Verwendung von Religion in der Werbung diskutiert.
Das dritte Kapitel analysiert das Fresko „Die Erschaffung Adams“ von Michelangelo. Es werden die vorikonographische Beschreibung, der Bildaufbau, die formale Bildbeschreibung und die inhaltliche (ikonografische) Bildanalyse des Freskos behandelt. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Freskos in der Kunstgeschichte und seine ikonografische Bedeutung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Beziehung zwischen Religion und Werbung, die Verwendung religiöser Motive in der Werbung, die Analyse des Freskos „Die Erschaffung Adams“ von Michelangelo, die Verwendung des Freskos in der Werbung, die ethischen und gesellschaftlichen Implikationen der Beziehung zwischen Religion und Werbung sowie die Frage, ob es sich um eine einseitige Ausnutzung der Religion durch die Werbung handelt oder ob auch die Religion von dieser Beziehung profitieren kann.
Häufig gestellte Fragen
Warum nutzt die Werbung christliche Motive?
Werbestrategen nutzen den hohen Bekanntheitsgrad religiöser Symbole (Engel, Teufel, Paradies), um Aufmerksamkeit zu erzeugen und Produkte emotional aufzuladen.
Wie wird Michelangelos „Die Erschaffung Adams“ in der Werbung verwendet?
Das Motiv wird oft zitiert oder verfremdet, um die Botschaft einer „Schöpfung“ oder eines besonderen Produkts als „göttlich“ zu inszenieren.
Ist Werbung eine Art „Ersatzreligion“?
Die Arbeit diskutiert diese These kritisch und untersucht, ob Werbung heute ähnliche sinnstiftende Funktionen übernimmt wie früher die Religion.
Was ist das Ziel religiöser Motive in der Anzeigenwerbung?
Das Ziel ist meist die Manipulation des Betrachters zum Kauf, nicht die Vermittlung einer religiösen Botschaft.
Kann auch die Kirche von Werbung profitieren?
Die Untersuchung beleuchtet auch werbungsfreundliche Ansätze, die Möglichkeiten für die Kirche sehen, ihre Botschaft moderner zu kommunizieren.
- Quote paper
- Nato Khomasuridze (Author), 2012, Christliche Kunst in der Werbung. Werbung als Ersatzreligion am Beispiel „Die Erschaffung Adams“ in der Werbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284746