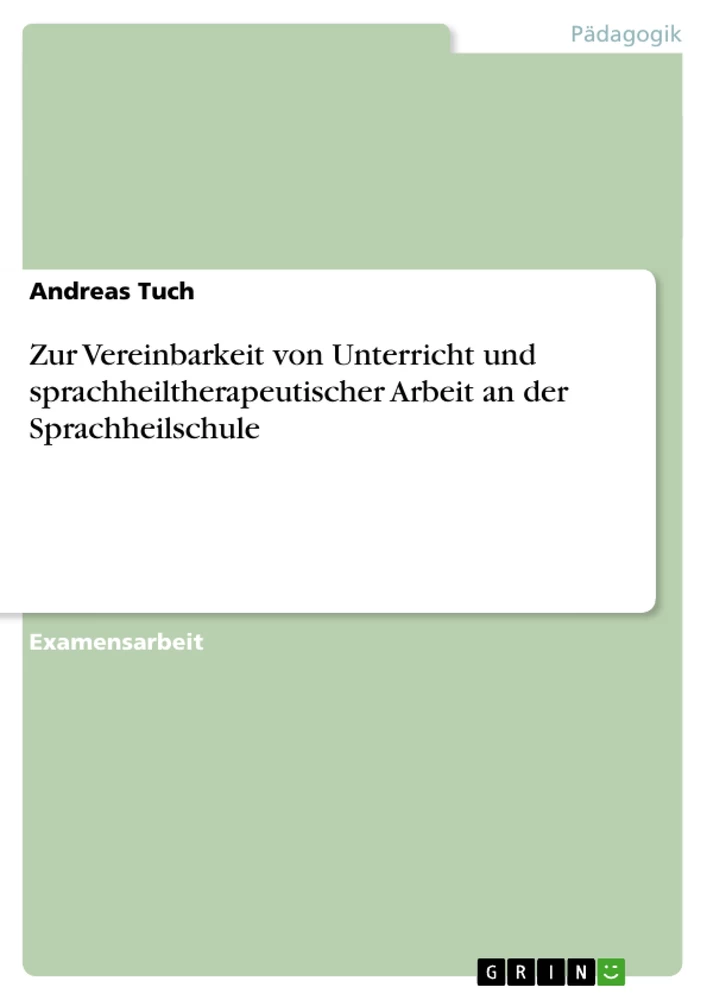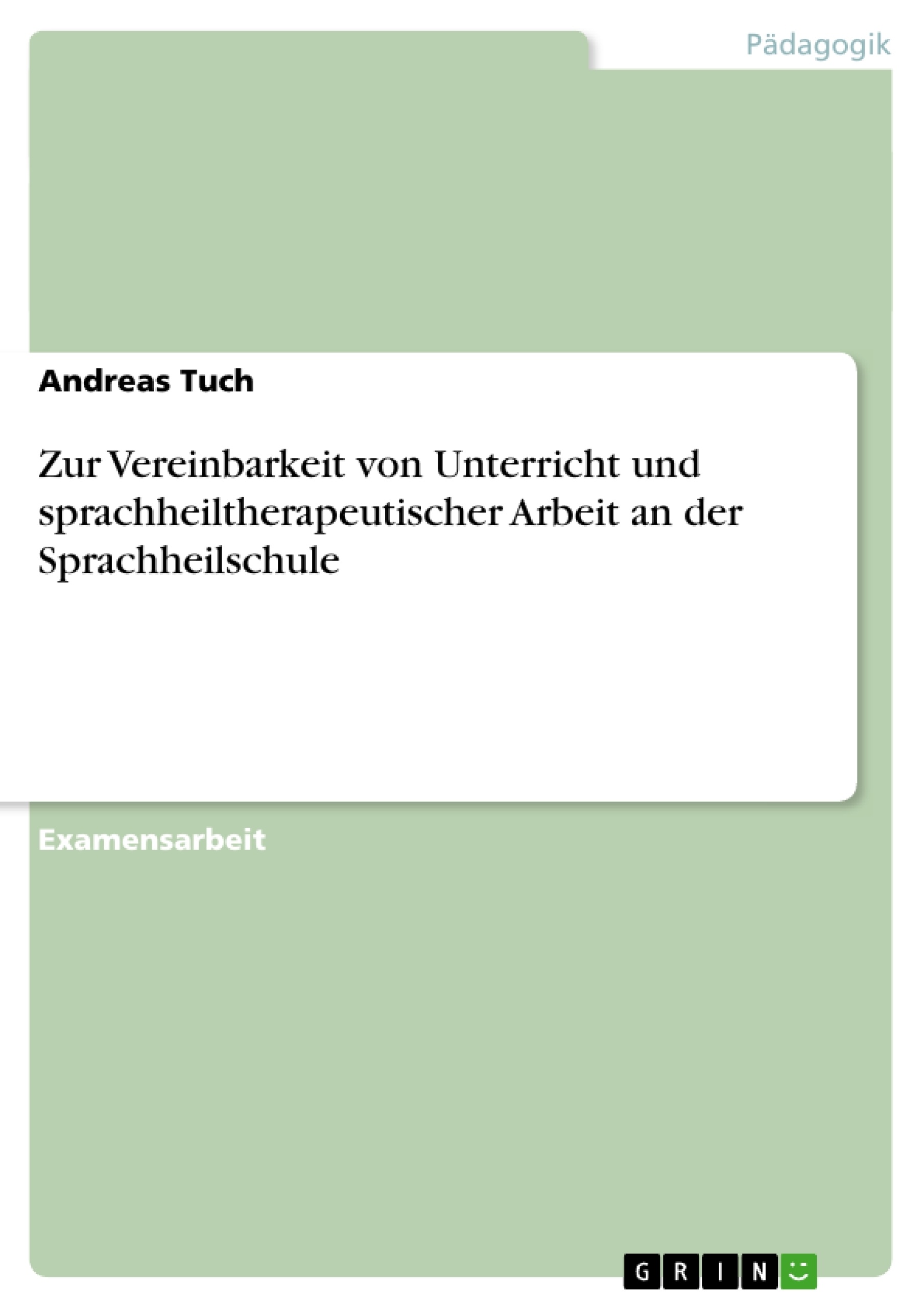Gegenstand dieser Arbeit die Frage nach der Vereinbarkeit von Unterricht und sprachheiltherapeutische Arbeit an der Sprachheilschule (Dualismusproblem). Oder anders formuliert: Wie lassen sich die Anforderungen des Rahmenlehrplans mit den spezifischen Sprachproblemen der Schüler verbinden?
Vorgestellt wird hier ein Konzept für den Deutsch- und Mathematikunterricht aus der Schweiz. Die beiden Autoren Ruf/Gallin haben ein Konzept entwickelt, dass eine permanente sprachliche Umsetzung des Gehörten und Erarbeiteten anstrebt. Und das auf verschiedenen Ebenen. ZU Nennen sin hier das Sprachlerntagebuch, das in seiner Grundkonzeption Eingang in das neue Berliner Schulgesetz gefunden hat.
Diese Arbeit stellt das Dilemma der Sprachheilschule dar und entwirft mit Hilfe des Ruf/Gallinschen Modells einen Alternative für den Unterricht.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Die Rahmenbedingungen an der Sprachheilschule
- Die Geschichte der Sprachheilpädagogik
- Antike und Mittelalter
- Von den Sprachheilkursen zur Sprachheilschule
- Aufgaben und Ziele der Berliner Sprachheilschule
- Sprachbehinderung und Probleme des Lern- und Leistungsvermögens von Kindern an Sprachheilschulen
- Die Schule als “Setting”
- Sprachliche Entwicklungsaufgaben der Schule
- Sprachstörungen und Schule aus ökologischer Sicht
- Konsequenzen für die Schule
- Zweisprachigkeit und Sprachheilschule
- Die Situation von Schülern nichtdeutscher Herkunft an den Sonderschulen
- Sprachheilpädagogik und Mehrsprachigkeit
- Einblicke in die Praxis des sprachheiltherapeutischen Unterrichts
- Erschwerende Faktoren für den Unterricht an der Sprachheilschule
- Die Besonderheiten des Unterrichts in der Sprachheilschule
- Didaktische Modelle im Unterricht
- Ergebnisse
- Fazit
- Das Dialogische Lernen
- Einleitung
- Die Elemente des Dialogischen Lernens
- Die Kernidee
- Der Auftrag
- Das Reisetagebuch
- Die Rückmeldung
- Zusammenfassung
- Das Dialogische Lernen im Unterricht mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Sprache
- Vorüberlegungen
- Qualitätsmerkmale des sprachheilpädagogischen Unterrichts nach Bahr in Verbindung mit dem Dialogischen Lernen
- Das Feld “Schülerinnen und Schüler”
- Das Feld “Bildungsgehalte”
- Das Feld “Methoden und Medien”
- Konsequenzen für die Unterrichtsplanung
- Probleme bei der Umsetzung des Dialogischen Lernens
- Möglichkeiten der schriftlichen Dokumentation
- Ergebnis
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob sich das didaktische Modell des „Dialogischen Lernens“ sinnvoll und bereichernd im Unterricht an der Sprachheilschule einsetzen lässt. Der Fokus liegt dabei auf der Anpassung des Modells an die besonderen Bedingungen der Sprachheilschule, die durch die Integration von Bildung, Erziehung und Therapie eine einzigartige Herausforderung darstellen.
- Die Herausforderungen der Sprachheilschule
- Die Besonderheiten sprachbehinderter Kinder im Lernprozess
- Das Konzept des Dialogischen Lernens
- Die Integration des Dialogischen Lernens in die Praxis der Sprachheilschule
- Probleme und Chancen der Umsetzung des Modells
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel der Arbeit behandelt die Rahmenbedingungen an der Sprachheilschule und zeichnet einen historischen Abriss der Sprachheilpädagogik nach. Dabei werden die Aufgaben und Ziele der Berliner Sprachheilschule anhand der entsprechenden Verordnung vorgestellt. Weiterhin werden die Problematiken der Mehrsprachigkeit und der Lernschwierigkeiten von Kindern an Sprachheilschulen beleuchtet, wobei aktuelle Ansätze und Erkenntnisse dazu vorgestellt werden.
Das zweite Kapitel fokussiert auf das Konzept des Dialogischen Lernens und stellt dessen Ziele, Methoden und Adressaten vor. Es wird gezeigt, wie das Dialogische Lernen durch einen Dialog zwischen singulären und regulären Lernwelten eine neue Perspektive für den Unterricht schafft.
Das dritte Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie das Dialogische Lernen an die besonderen Bedingungen der Sprachheilschule angepasst werden kann. Dazu werden die Qualitätsmerkmale des sprachheilpädagogischen Unterrichts nach Bahr untersucht und die Integration des Dialogischen Lernens in diese Qualitätsmerkmale geprüft. Weiterhin werden mögliche Probleme bei der Umsetzung des Modells im Unterricht thematisiert, insbesondere im Hinblick auf die schriftliche Dokumentation und die Förderung von Schülern nichtdeutscher Herkunft.
Schlüsselwörter (Keywords)
Diese Arbeit befasst sich mit dem Dialogischen Lernen als ein didaktisches Modell für den Unterricht an der Sprachheilschule. Die zentralen Themen sind die spezifischen Bedingungen der Sprachheilschule, die Integration von Bildung, Erziehung und Therapie, die Sprachbehinderung und deren Auswirkungen auf das Lernverhalten, die Mehrsprachigkeit, die Förderung von Schülern nichtdeutscher Herkunft, die Anpassung des Dialogischen Lernens an die Bedürfnisse sprachbehinderter Kinder und die Herausforderungen bei der Umsetzung des Modells in der Praxis.
- Citation du texte
- Andreas Tuch (Auteur), 2003, Zur Vereinbarkeit von Unterricht und sprachheiltherapeutischer Arbeit an der Sprachheilschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28480