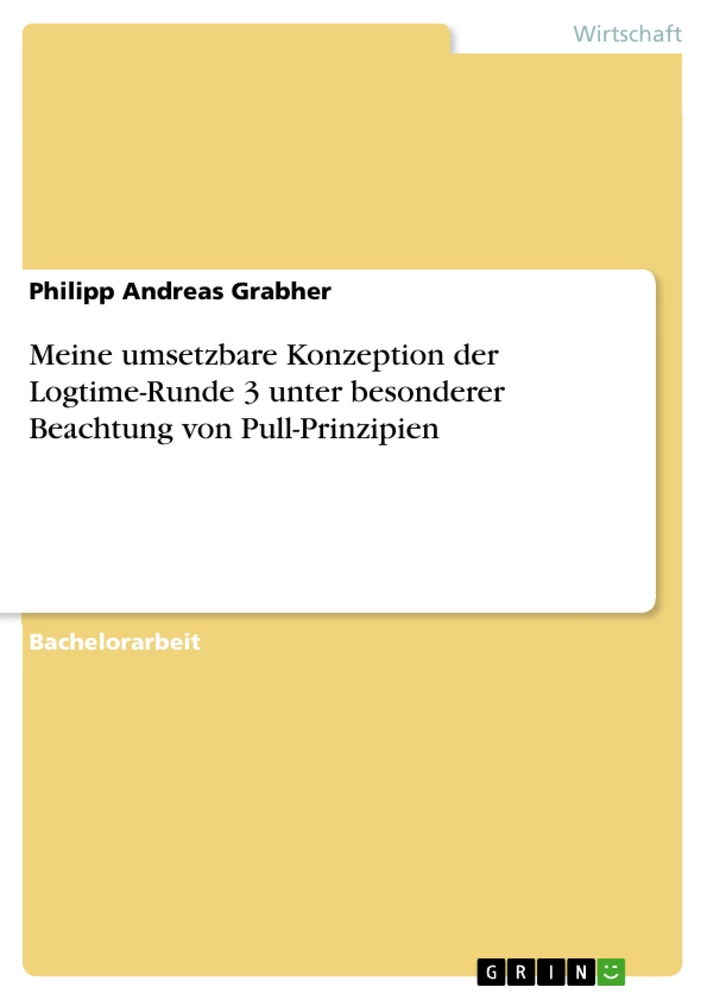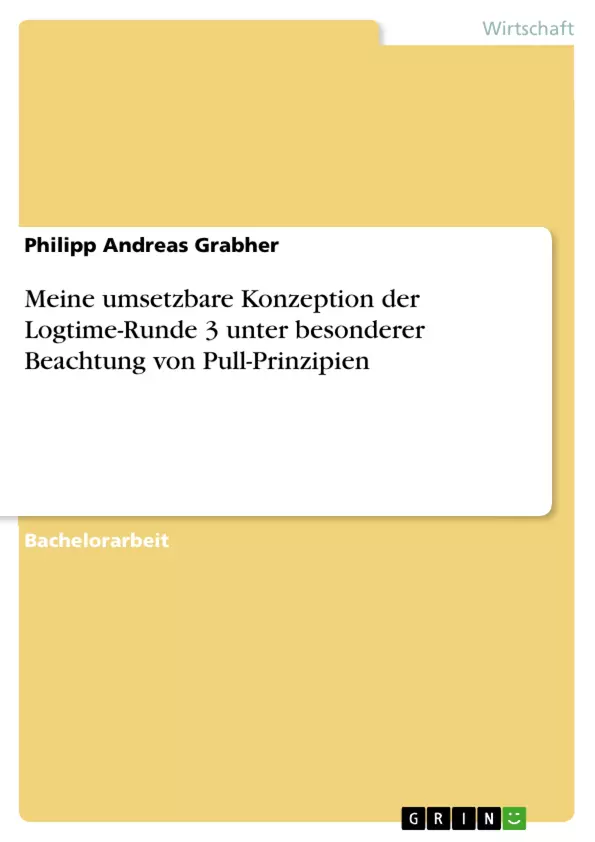Mittels des Planspiels Logtime, welches eine Firma darstellt, die verschiedene Uhren produziert, wird ersichtlich wie viel Einfluss ein Unternehmen durch seine Planung der Fertigung auf die Höhe der Bestände, die Qualität und die Durchlaufzeiten bzw. der Liefertreue haben kann. Durch unkoordinierte Fertigungsprozesse und Arbeitsabläufe wirkt sich dies schnell auf die Bestände und die damit verbundenen Kapitalkosten aus. Durch unkoordinierte Anordnung von Arbeitsstationen und Arbeitsprozesse entstehen lange Transportwege bzw. Wartezeiten. Diese Faktoren haben einen wesentlichen Einfluss auf die Durchlaufzeit. Diese wiederum beeinflussen die Lieferzeit und damit auch die Liefertreue. Außerdem wird durch hohe Bestände in den Lagern das Kapital einer Firma gebunden. Diese Aspekte haben negative Auswirkung, welches insgesamt die Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens beeinträchtigt. Um konkurrenzfähig zu sein, sollte es im Interesse eines Unternehmens sein, diese negativen Effekte zu unterbinden und sich als effizientes und kundenorientiertes Unternehmen am Markt zu präsentieren.
Inhaltsverzeichnis
- Darstellungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Ausgangssituation im Planspiel Logtime
- 2.1 Arbeitsprozessgestaltung, Material- und Informationsfluss in der 1. Spielsequenz
- 2.2 Arbeitsprozessgestaltung, Material- und Informationsfluss in der 2. Spielsequenz
- 3 Problemdefinition und deren Verbesserungspotenziale
- 3.1 Verschwendung durch Überproduktion
- 3.2 Verschwendung durch Warten
- 3.3 Verschwendung durch Transporte
- 3.4 Verschwendung durch hohe Bestände
- 3.5 Verschwendung durch Qualitätsfehler
- 3.6 Verschwendung durch Variantenvielfalt
- 3.7 Problematik Bearbeitungszeit versus Kundentaktung
- 4 Lösungsansätze zur Optimierung der Verschwendungen
- 4.1 Reduzierung der Bestände
- 4.1.1 Einführung von Kanban
- 4.1.2 Variantenbildung am Ende des Fertigungsprozesses
- 4.1.3 Materialbereitstellung über Konsignationslager
- 4.2 Reduzierung der Durchlaufzeit
- 4.2.1 Anpassung des Fassungsvermögens des Veredelungsofens
- 4.2.2 Produktion nach Kundentakt – Zusammenlegung von Arbeitsschritten
- 4.2.3 Implementierung der Fließfertigung
- 4.2.4 Implementierung des One-Piece-Flow
- 4.3 Reduzierung der Qualitätsfehler durch Mitarbeiterschulung
- 5 Konzept der neuen Produktionslinie
- 5.1 Informationsfluss
- 5.2 Materialfluss und Tätigkeiten
- 5.3 Einführungsbedingungen
- 6 Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bakkalaureatsarbeit befasst sich mit der Optimierung der Produktionsprozesse im Planspiel Logtime, wobei der Fokus auf der Umstellung von einer Push- auf eine Pull-Strategie liegt. Ziel ist es, ein Konzept für die dritte Spielrunde zu entwickeln, welches die Reduzierung von Beständen und Durchlaufzeiten sowie die Steigerung der Kundenzufriedenheit durch eine kundenorientierte Produktion ermöglicht.
- Analyse der Verschwendung in der Produktion
- Implementierung von Pull-Prinzipien
- Reduzierung von Beständen und Durchlaufzeiten
- Steigerung der Kundenzufriedenheit
- Optimierung der Material- und Informationsflüsse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit erläutert. Anschließend wird die Ausgangssituation im Planspiel Logtime in den ersten beiden Spielrunden beschrieben, wobei die Arbeitsprozessgestaltung, der Material- und Informationsfluss sowie die auftretenden Probleme analysiert werden. Im dritten Kapitel werden die verschiedenen Arten von Verschwendung im Produktionsprozess identifiziert und deren Verbesserungspotenziale aufgezeigt. Das vierte Kapitel präsentiert Lösungsansätze zur Optimierung der Verschwendung, wobei die Schwerpunkte auf der Reduzierung von Beständen und Durchlaufzeiten liegen. Im fünften Kapitel wird das Konzept der neuen Produktionslinie vorgestellt, welches die Implementierung von Pull-Prinzipien und die Optimierung der Material- und Informationsflüsse beinhaltet. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, die die Ergebnisse zusammenfasst und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gibt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Logtime-Runde 3, Pull-Prinzipien, Bestandsreduktion, Durchlaufzeitoptimierung, Kanban-System, Fließfertigung, One-Piece-Flow, Kundentaktung, Wertschöpfungsanalyse, Verschwendung, Produktionsplanung, Materialfluss, Informationsfluss und Kundenzufriedenheit.
Häufig gestellte Fragen zum Logtime-Planspiel
Was ist das Ziel des Planspiels Logtime?
Das Ziel ist die Optimierung von Fertigungsprozessen, um Bestände zu senken, Durchlaufzeiten zu verkürzen und die Liefertreue zu erhöhen.
Was versteht man unter dem Pull-Prinzip?
Im Gegensatz zum Push-Prinzip wird die Produktion erst durch den tatsächlichen Kundenbedarf ausgelöst, was Überproduktion verhindert.
Welche Rolle spielt das Kanban-System?
Kanban dient als Steuerungsinstrument für den Materialfluss, um Bestände in der Fertigung nach dem Supermarkt-Prinzip zu minimieren.
Was ist ein One-Piece-Flow?
Ein Fertigungskonzept, bei dem jedes Werkstück ohne Zwischenlagerung direkt von einer Station zur nächsten fließt.
Welche Arten von Verschwendung werden analysiert?
Analysiert werden Verschwendung durch Überproduktion, Wartezeiten, unnötige Transporte, hohe Bestände und Qualitätsfehler.
- Citar trabajo
- Philipp Andreas Grabher (Autor), 2013, Meine umsetzbare Konzeption der Logtime-Runde 3 unter besonderer Beachtung von Pull-Prinzipien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284816