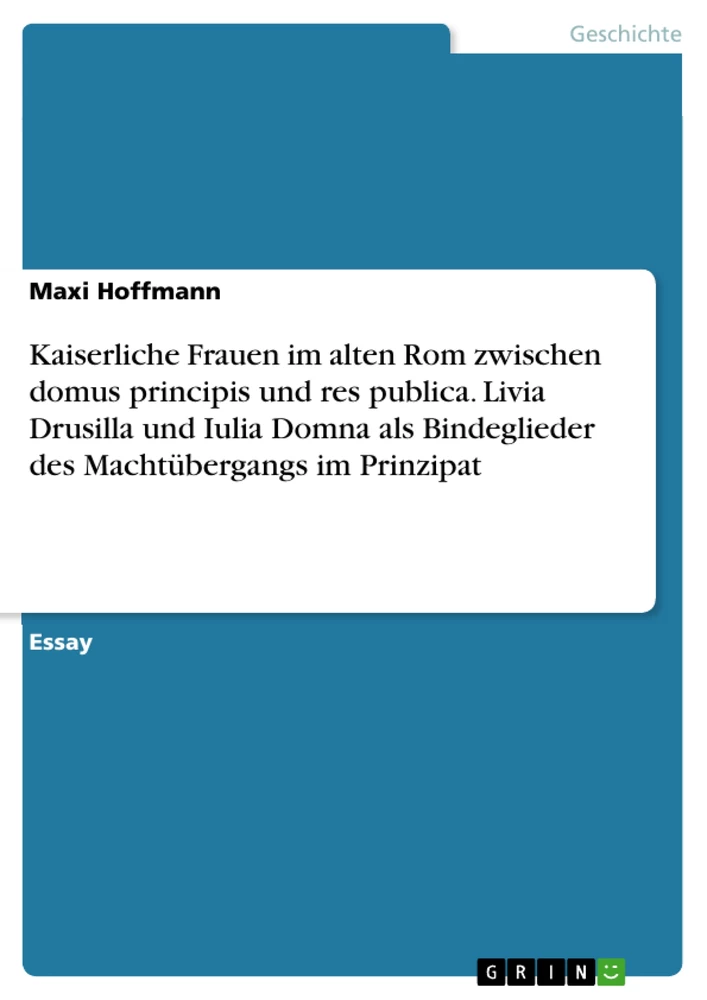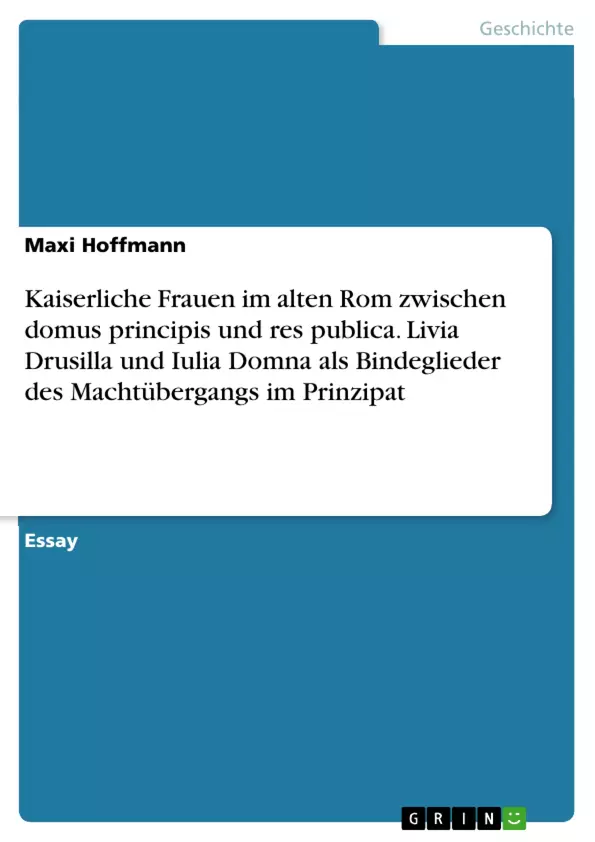Die von Augustus 27 v. Chr. errichtete Herrschaftsordnung des Prinzipats benötigte einen starken legitimatorischen Rückhalt, um - trotz formaler Wiederherstellung der Republik - Akzeptanz für das monarchische Modell zu erlangen. Hierbei berief sich Augustus auf die tradierten Sitten und Verhaltensnormen seiner Vorfahren, den mores maiorum. Als wichtigster Raum für die eigene Darstellung in der Öffentlichkeit und Umsetzung des Wertekanons erwies sich die römische domus und insbesondere die kaiserliche Familie, die fortan eine soziale Vorbildfunktion für den ganzen römischen Staat übernahm.
Durch die große Bedeutung des Fortbestands der kaiserlichen domus und ihrer politischen Macht, veränderte sich auch die Rolle der Frauen. Die dynastische Hauptaufgabe bestand zwar weiterhin „nur“ im Gebären von männlichem Nachwuchs, diese Aufgabe wurde aber für die res publica wichtiger als je zuvor. Den Zeitpunkt des Übergangs zwischen dem Tod eines alten und dem Machtantritt eines neuen Kaisers lohnt es daher besonders auf die jeweiligen Umstände und Rollen der darin involvierten Frauen zu überprüfen.
Livia Drusilla, die als erste Kaiserin für all ihre Nachfolgerinnen Maßstäbe setzte, befand sich ebenso wie Julia Domna, die erste Kaiserin der severischen Dynastie, in der Situation eines Herrschaftsübergangs, der vom Ehemann auf den Sohn erfolgte. Anhand der antiken Historiographie soll dargestellt werden, welcher Stellenwert den Kaiserinnen hier jeweils zugeschrieben wurde, welche Einflussmöglichkeiten sich für die Frauen tatsächlich ergaben und wie sich innerfamiliäre Beziehungen der domus auf die res publica auswirken konnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Livia und der erste Herrschaftsübergang im Prinzipat zwischen Augustus und Tiberius
- Julia Domna und die Nachfolgefrage in der severischen Dynastie
- Vergleich der dynastischen Rollen von Livia Drusilla und Iulia Domna
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle von Kaiserinnen im frühen und hohen Prinzipat, insbesondere im Kontext von Herrschaftsübergängen. Sie analysiert, wie Livia Drusilla und Julia Domna als Frauen der römischen Kaiserhäuser die dynastische Stabilität und den Machterhalt beeinflussten. Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich für Kaiserinnen im Spannungsfeld zwischen domus principis und res publica ergaben.
- Die Bedeutung der kaiserlichen Familie für die Legitimation des Prinzipats
- Die Rolle von Frauen im dynastischen Machterhalt
- Der Einfluss von Kaiserinnen auf die politische Entscheidungsfindung
- Die Darstellung von Kaiserinnen in der antiken Historiographie
- Der Vergleich der Rollen von Livia Drusilla und Julia Domna
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung der kaiserlichen Familie für die Legitimation des Prinzipats und die Rolle von Frauen im dynastischen Machterhalt. Es wird die Situation von Livia Drusilla als erste Kaiserin und ihre Position im Kontext des Herrschaftsübergangs von Augustus auf Tiberius analysiert. Das Kapitel untersucht die Darstellung Livias in der antiken Historiographie und die Frage, ob sie tatsächlich einen aktiven Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung hatte.
Das zweite Kapitel widmet sich Julia Domna, der ersten Kaiserin der severischen Dynastie. Es wird die Nachfolgefrage in der severischen Dynastie und die Rolle von Julia Domna im Kontext des Herrschaftsübergangs von Septimius Severus auf Caracalla beleuchtet. Das Kapitel analysiert die Einflussmöglichkeiten von Julia Domna und ihre Bedeutung für die Stabilität der Dynastie.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Kaiserinnen Livia Drusilla und Julia Domna, die domus principis, die res publica, den Herrschaftsübergang, die dynastische Legitimation, die antike Historiographie und den Einfluss von Frauen auf die politische Entscheidungsfindung im römischen Prinzipat.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Livia Drusilla und Julia Domna für das römische Kaiserreich?
Beide fungierten als zentrale Bindeglieder bei Machtübergängen (vom Ehemann auf den Sohn) und sicherten die dynastische Stabilität.
Was bedeutete "domus principis" im Kontext der Macht?
Das kaiserliche Haus (domus) war der private Raum, der jedoch eine öffentliche Vorbildfunktion übernahm und untrennbar mit der staatlichen Ordnung (res publica) verknüpft war.
Wie legitimierte Augustus seine Herrschaft durch die Familie?
Er berief sich auf die "mores maiorum" (Sitten der Vorfahren) und nutzte die kaiserliche Familie als moralisches und soziales Vorbild für den Staat.
Hatten Kaiserinnen tatsächlichen politischen Einfluss?
Die Arbeit untersucht anhand antiker Quellen, welche informellen Einflussmöglichkeiten sich für Frauen wie Livia und Julia Domna jenseits ihrer Gebärrolle ergaben.
Was war die dynastische Hauptaufgabe der römischen Kaiserinnen?
Ihre primäre Aufgabe war die Sicherung der Nachfolge durch das Gebären männlicher Erben, was für den Fortbestand des Prinzipats überlebenswichtig war.
- Quote paper
- Maxi Hoffmann (Author), 2010, Kaiserliche Frauen im alten Rom zwischen domus principis und res publica. Livia Drusilla und Iulia Domna als Bindeglieder des Machtübergangs im Prinzipat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284848