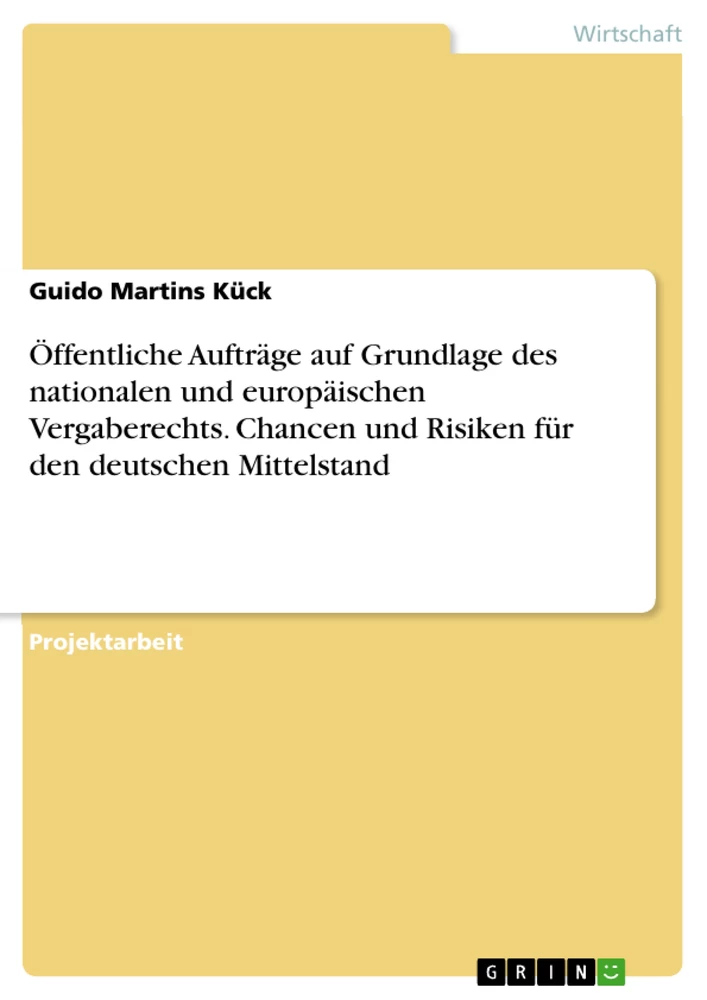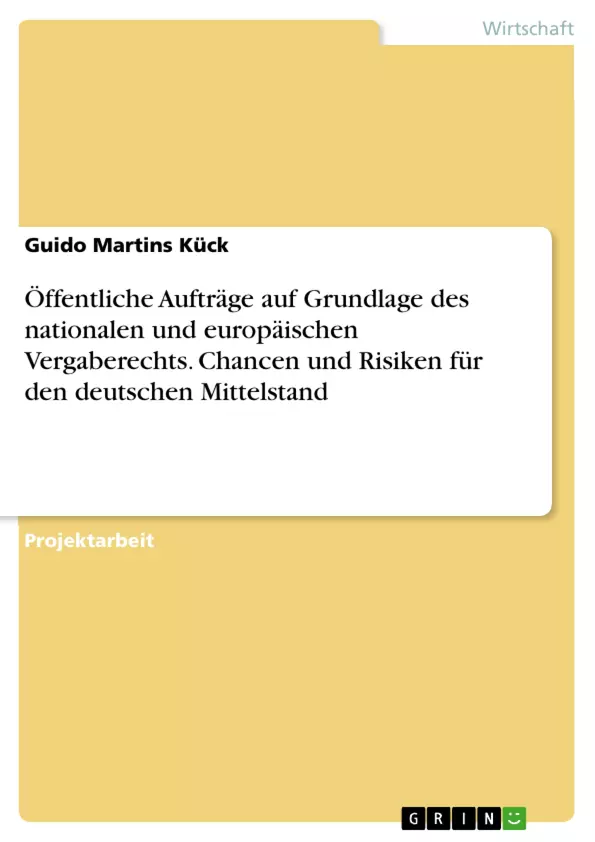Ziel der Arbeit ist es, herauszuarbeiten und zu analysieren, welche Chancen und Risiken sich durch die verstärkte Beteiligung an öffentlichen Vergaben bzw. Aufträgen für den deutschen Mittelstand ergeben. Hierfür wird ein Überblick über die wesentlichen Grundlagen zum Thema der öffentlichen Auftragsvergabe auf Grund des nationalen und europäischen Vergaberechts gegeben und erklärt.
Für den deutschen Mittelstand besteht national sowie europaweit ein großes Auftragspotential, das bislang nicht ausgeschöpft wurde. Der Hauptgrund für die vermeintliche Zurückhaltung der Beteiligung des Mittelstandes an öffentlichen Aufträgen ist wohl darin zu sehen, dass die öffentliche Vergabe bzw. Beauftragung auf Grund des nationalen und europäischen Vergaberechts nicht nur die Chancen, sondern auch Risiken für den deutschen Mittelstand mit sich bringt.
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffliche Grundlagen
2.1 Deutscher Mittelstand und KMU
2.2 Vergaberecht
2.3 Offent Hehe Auf träge
2.4 Öffentliche Auftraggeber
3 Systematik/Rechtsgrundlagen des Vergaberechts
3.1 Systematik/Rechtsgrundlagen des europäischen Vergaberechts
3.2 Systematik/Rechtsgrundlagen des nationalen Vergaberechts
3.2.1 Systematik/Rechtsgrundlagen unterhalb der EU-Schwellenwerte
3.2.2 Systematik/Rechtsgrundlagen oberhalb der EU-Schwellenwerte
3.2.2.1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
3.2.2.2 Vergabeverordnung (VgV)
3.2.2.3 Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit (VSVgV)
3.2.2.4 Sektorenverordnung (SektVO)
3.2.2.5 Vergabe- und Vertragsordnungen (VOB, VOL, VOR)
4 Vergabeverfahren
4.1 Nationale Vergabeverfahren
4.1.1 Öffentliche Ausschreibung
4.1.2 Beschränkte Ausschreibung
4.1.3 Freihändige Vergabe
4.1.4 Neue Verfahren (Direktkauf Rahmenvereinbarung, dynamische elektronische Verfahren, elektronische Auktion)
4.2 Europaweite Vergabeverfahren
4.2.1 Offenes Verfahren
4.2.2 Nicht offenes Verfahren
4.2.3 Verhandlungsverfahren
4.2.4 Wettbewerblicher Dialog
4.2.5 Neue Verfahren (dynamische elektronische Verfahren)
5 Chancen und Risiken für den Mittelstand
5.1 Chancen
5.1.1 Allgemein
5.1.2 Auf nationaler Ebene
5.1.3 Auf europäischer Ebene
5.2 Risiken
5.2.1 Allgemein
5.2.2 Auf nationaler Ebene
5.2.3 Auf europäischer Ebene
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was sind die rechtlichen Grundlagen für öffentliche Aufträge in Deutschland?
Die Grundlagen bilden das GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), die VgV (Vergabeverordnung) sowie spezifische Vergabeordnungen wie VOB und VOL.
Welche Chancen bietet das Vergaberecht dem Mittelstand?
Der Mittelstand erhält Zugang zu einem enormen Auftragspotenzial auf nationaler und europäischer Ebene, das Planungssicherheit und neue Marktanteile verspricht.
Welche Risiken bestehen bei der Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen?
Zu den Risiken gehören der hohe bürokratische Aufwand, strenge formale Anforderungen und die Gefahr des Ausschlusses bei kleinsten Fehlern im Angebot.
Was ist der Unterschied zwischen nationalen und europaweiten Vergabeverfahren?
Europaweite Verfahren müssen ab Erreichen bestimmter Schwellenwerte durchgeführt werden und unterliegen strengeren Transparenz- und Publikationspflichten im EU-Amtsblatt.
Welche neuen Verfahren gibt es im modernen Vergaberecht?
Dazu zählen unter anderem Rahmenvereinbarungen, dynamische elektronische Verfahren und elektronische Auktionen, die den Prozess effizienter gestalten sollen.
- Quote paper
- Guido Martins Kück (Author), 2014, Öffentliche Aufträge auf Grundlage des nationalen und europäischen Vergaberechts. Chancen und Risiken für den deutschen Mittelstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284894