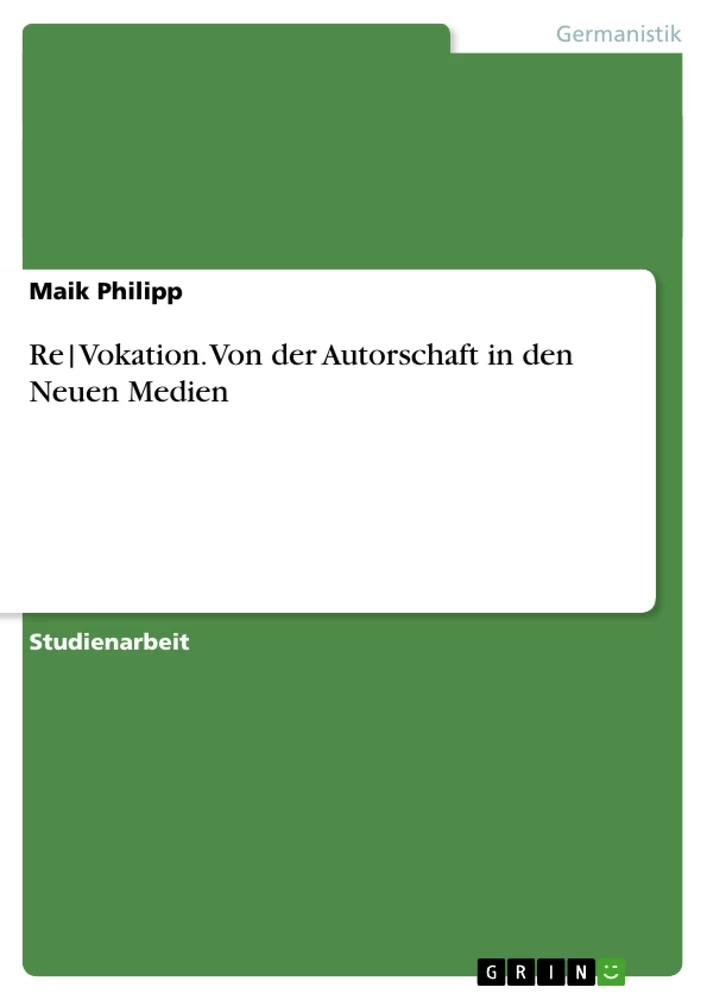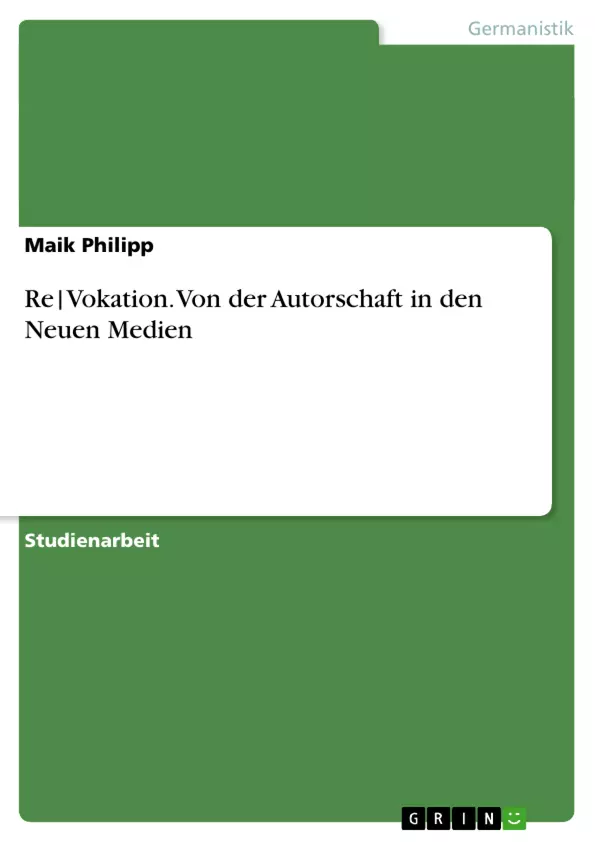Die Zeit der Euphorie ist vergangen. Zumindest wenn man den Spiegel-Autoren Anne PETERSEN und Johannes
SALTZWEDEL Glauben schenkt, die in ihrem Beitrag „Absturz der Netzpoeten“ ein Scherbengericht abhalten
über die „schwindsüchtige[] Szene“ der Autoren (PETERSEN, SALTZWEDEL (2002), S. 178), die in den digitalen
Medien, allen voran: dem World Wide Web, publizieren. Im WWW, heißt es, sähen viele nur eine „Probebühne
für Unfertiges … Literarische Wert arbeit hingegen, so die stillschweigende Überzeugung, sollte man
auch getrost nach Hause tragen und ins Regal stellen können.“ Dieser Attitüde folgend attestiert das Spiegel-
Duo denn auch Mitschreibprojekten eine rührende „Hobby-Mentalität“ und „heitere[] Bedeutungslosigkeit“. Vernichtend
ist die Einschätzung, ein digital publizierender Autor könne „heute nur noch Artist ohne Geldsorgen,
verzweifelt armer Poet oder williger Schreibnovize sein“; ernst zu nehmende Poeten hingegen seien dem
Buch verhaftet (ebd., S. 180).1
Dabei gab es keine Dekade zuvor durchaus eine veritable deutsche Szene interessierter Leser und Netz-
Literaten, stimuliert durch die Ausbreitung des WWW und quasi als Nebenwirkung des „Internet-Literatur-
Wettbewerbs“, den ZEIT, IBM, Radio Bremen und weitere Sponsoren ausgelobt hatten. Doch bereits nach drei
Jahren war Schluss: Nach einer Umbenennung in „Pegasus“ wurde der Wettbewerb 1998 eingestellt (vgl. SUTER
(2000c)). Überraschend kam dies nicht, hieß es doch in der der Zeitung, die den Wettbewerb mit aus gelobt
hat: „Lesen im Internet ist wie Musikhören übers Telephon. … Literatur im Netz ist eine Totgeburt. Sie
scheitert schon als Idee, weil ihr Widersinn womöglich nur noch von Hörspielen aus dem Handy übertroffen
wird“ (BENNE (1998)). [...]
1 Die Häme und der Zynismus des Spiegel-Artikels sind evident. Dass die Autoren auf die Euphorie der Anfangszeit rekurrieren, in der
das Ende des Buches proklamiert wurde, ist zulässig, wirkt jedoch als Kontrastierung im Jahre 2002 nicht als Neuigkeit, sondern als
Aufguss des Altbekannten. Zudem scheint hier der Versuch stattzufinden, bestehende Vorurteile zu verifizieren. Diese Atti tüde ist nicht
neu im Bereich digitaler Literatur; neu ist nur der an Schadenfreude gemahnende Ton, der eine kritische, aber offene Auseinandersetzung
mit der Thematik als mindestens fragwürdig erscheinen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Neue Medien, Hypertext und digitale Literatur.
- Non-sequential writing – das Konzept Hypertext.
- 0/1: Digitale Literatur, eine Annäherung.
- Wer schreibt? Autorschaft in den Neuen Medien.
- Wen kümmert's, wer schreibt? Die Postmoderne als Totengräber.
- Hypertext und Postmoderne = Praxis zur Theorie?
- Autor³-autoritärer denn je zuvor?
- Wen kümmert's, wer liest? Die Rolle des Lesers.
- Nachlese.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie sich das Schreiben in den neuen Medien auf die Autorschaft auswirkt. Der Fokus liegt dabei auf dem Einfluss von Hypertext und digitaler Literatur auf die traditionelle Vorstellung vom Autor. Die Arbeit untersucht, ob und wie der Autor im digitalen Zeitalter stirbt, verloren geht oder im Gegenteil an Bedeutung gewinnt.
- Hypertext als Grundlage für ein geändertes Textverständnis
- Die Rolle des Autors in der digitalen Literatur
- Der Einfluss der Postmoderne auf die Autorschaft
- Die Bedeutung des Lesers im digitalen Zeitalter
- Die Ursachen für den (noch) ausbleibenden Erfolg der digitalen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition grundlegender Begriffe wie Neue Medien, Hypertext und digitale Literatur. Es wird die medienspezifische Veränderung des Literaturverständnisses im Kontext digitaler Medien und der damit verbundenen neuen ästhetischen Formen diskutiert.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel untersucht die Frage nach der Autorschaft in den neuen Medien. Es beleuchtet verschiedene Perspektiven auf die Rolle des Autors im Zeitalter der digitalen Medien und diskutiert den Einfluss der Postmoderne auf die traditionelle Vorstellung von Autorschaft.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel widmet sich der Rolle des Lesers in der digitalen Literatur. Es wird die Frage nach der Rezeption digitaler Texte im Kontext des Internets und der neuen Möglichkeiten der Interaktion zwischen Autor und Leser gestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Hausarbeit sind die Autorschaft in den neuen Medien, Hypertext, digitale Literatur, Postmoderne, Leserrolle und Medienwandel. Dabei stehen die Auswirkungen des digitalen Zeitalters auf die traditionelle Literatur und die damit verbundenen Veränderungen des Literaturverständnisses im Fokus.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter digitaler Literatur?
Digitale Literatur umfasst Werke, die speziell für digitale Medien (wie das WWW) geschaffen wurden und oft Techniken wie Hypertext nutzen, die im gedruckten Buch nicht möglich sind.
Wie verändert Hypertext das Konzept der Autorschaft?
Durch Hypertext wird das lineare Schreiben aufgebrochen. Der Autor verliert die absolute Kontrolle über den Leseweg, da der Leser durch Links eigene Pfade wählt.
Ist der Autor in den Neuen Medien „tot“?
Die Arbeit untersucht postmoderne Theorien zum „Tod des Autors“ und fragt, ob digitale Plattformen den Autor entmachten oder ihm im Gegenteil neue, autoritäre Rollen zuweisen.
Welche Rolle spielt der Leser bei digitaler Literatur?
Der Leser wird aktiver; er interagiert mit dem Text und bestimmt in Mitschreibprojekten oder Hypertexten oft die Struktur des Werks mit.
Warum wird Netz-Literatur oft als „Hobby-Mentalität“ kritisiert?
Kritiker (wie im Spiegel-Artikel 2002) sahen im Web oft nur eine Probebühne für Unfertiges, während „echte“ literarische Wertarbeit dem gedruckten Buch vorbehalten blieb.
Was war der „Pegasus“-Wettbewerb?
Ein von der ZEIT und IBM ausgelobter Internet-Literatur-Wettbewerb, der Ende der 90er Jahre die deutsche Szene für Netz-Literatur stimulierte, aber 1998 eingestellt wurde.
- Arbeit zitieren
- Maik Philipp (Autor:in), 2004, Re|Vokation. Von der Autorschaft in den Neuen Medien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28491