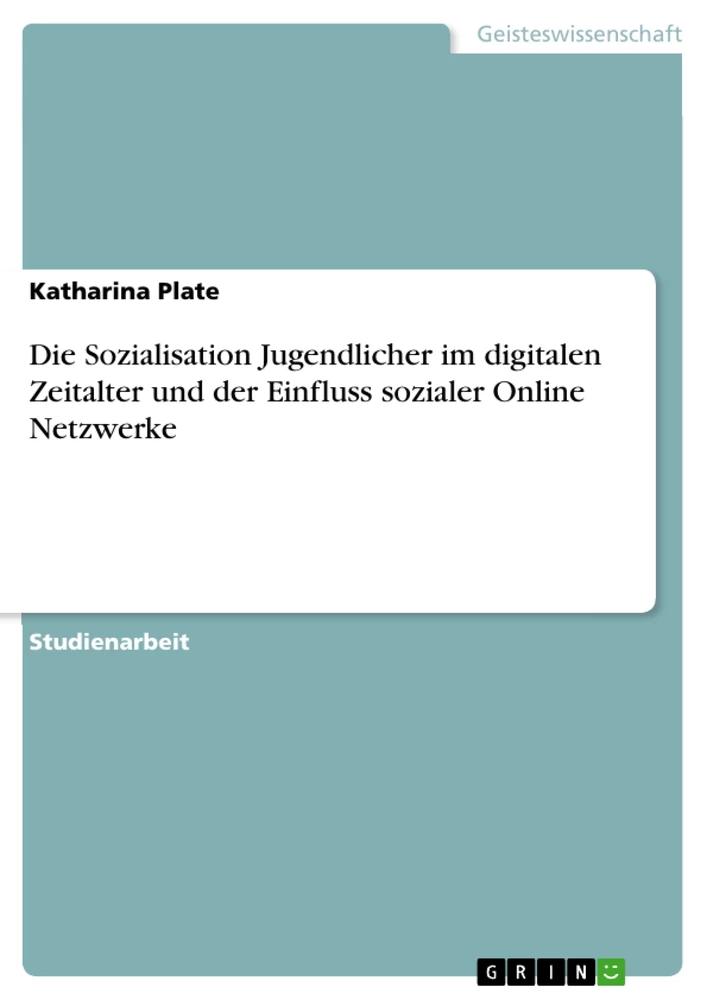Der Mensch ist durch andere formbar, gleichzeitig prägt er sich in der Auseinandersetzung mit sich und seiner materiellen und sozialen Umwelt selbst. Dabei kann er anders als Tiere auf über Jahrtausende entstandene Kulturen, soziale Strukturen und umfangreiches Wissen zurückgreifen. Sozialisationsprozesse lassen uns zu Menschen mit vielfältigen Identitäten und Persönlichkeiten werden, die gemeinsam Gesellschaften formen, welche sich wiederum durch allgemein anerkannte Kulturen mit spezifischen Rollenmustern, Grundannahmen, Werten, Normen, Ritualen, Helden und Symbolen sowie ein angehäuftes und strukturiertes Wissen auszeichnen (vgl. Hofstede et al. 2010). Die Sozialisation lässt uns unsere Rolle in der Gesellschaft finden und festigen. In diesem lebenslangen Prozess definieren wir uns einzeln als Individuen und insgesamt als Gesellschaft immer wieder neu. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die eigene Identitäts- bzw. Persönlichkeitsbildung, die ständige Beantwortung der Frage „Wer bin ich?“.
Ein Untersuchungsgegenstand der Sozialwissenschaft sind Instanzen wie Familie, Peer-groups, Erziehungs- und Bildungseinrichtungen sowie andere soziale Institutionen und Gruppierungen, die maßgebliche Einflussfaktoren für die Sozialisation darstellen. Soziale Online-Netzwerke wie Facebook könnten eine weitere Instanz darstellen, die maßgeblich die Sozialisation von Individuen beeinflusst, schließlich werden sie weltweit von Milliarden Men-schen genutzt. Vor diesem Hintergrund ist das Ziel dieser Hausarbeit, folgende Fragestel-lungen zu untersuchen:
1. Was ist Sozialisation und welche Einflussfaktoren liegen ihr zugrunde?
2. Wie können soziale Online-Netzwerke wie Facebook die Sozialisation von Jugendlichen beeinflussen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff Sozialisation
- Definitionsversuch
- Hierarchisch geordnete Makro- und Mikroebenen
- Die sieben Thesen Hurrelmanns
- Identitätsbildung bei Jugendlichen
- Mediensozialisation von Jugendlichen
- Das soziale Online-Netzwerk Facebook
- Nutzerverhalten von Jugendlichen bei Facebook
- Einfluss sozialer Online-Netzwerke auf die Sozialisation Jugendlicher
- Stärken und Möglichkeiten
- Schwächen und Risiken
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss sozialer Online-Netzwerke auf die Sozialisation Jugendlicher. Sie analysiert den Begriff der Sozialisation, beleuchtet die verschiedenen Einflussfaktoren und betrachtet die Rolle von Facebook in diesem Prozess. Das Ziel ist es, die Stärken und Schwächen von sozialen Online-Netzwerken in Bezug auf die Sozialisation von Jugendlichen aufzuzeigen.
- Definition und Einflussfaktoren der Sozialisation
- Mediensozialisation von Jugendlichen
- Das soziale Online-Netzwerk Facebook
- Nutzerverhalten von Jugendlichen bei Facebook
- Einfluss sozialer Online-Netzwerke auf die Sozialisation Jugendlicher
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Fragestellungen der Hausarbeit vor. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Begriff der Sozialisation und beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze, darunter Definitionsversuche, die Theorie von Urie Bronfenbrenner über hierarchisch geordnete Makro- und Mikroebenen sowie die sieben Thesen von Klaus Hurrelmann. Das dritte Kapitel behandelt die Mediensozialisation von Jugendlichen und stellt den Zusammenhang zwischen Medien und Sozialisationsprozessen her. Das vierte Kapitel widmet sich dem sozialen Online-Netzwerk Facebook, beleuchtet dessen Funktionsweise und erklärt die Bedeutung von Facebook für die Kommunikation und Interaktion von Jugendlichen. Das fünfte Kapitel untersucht das Nutzungsverhalten von Jugendlichen bei Facebook und analysiert die verschiedenen Nutzungsmotive und -formen. Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit dem Einfluss von sozialen Online-Netzwerken auf die Sozialisation Jugendlicher und analysiert sowohl die Stärken und Möglichkeiten als auch die Schwächen und Risiken dieser neuen Kommunikationsform.
Schlüsselwörter
Sozialisation, Jugendlicher, Digitalisierung, soziale Online-Netzwerke, Facebook, Mediensozialisation, Identität, Persönlichkeitsentwicklung, Einflussfaktoren, Stärken, Schwächen, Risiken, Chancen.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Facebook die Sozialisation von Jugendlichen?
Facebook wirkt als Instanz zur Identitätsbildung, ermöglicht Selbstdarstellung und soziale Vernetzung, birgt aber auch Risiken für die Persönlichkeitsentwicklung.
Was sind die sieben Thesen von Klaus Hurrelmann zur Sozialisation?
Diese Thesen beschreiben die produktive Realitätsverarbeitung des Individuums und die Bedeutung von inneren und äußeren Faktoren für die Identitätsbildung.
Was versteht man unter Mediensozialisation?
Es ist der Teil des Sozialisationsprozesses, der durch den Umgang mit Medien und deren Inhalten geprägt wird.
Welche Risiken bieten soziale Online-Netzwerke für Jugendliche?
Zu den Schwächen gehören Cybermobbing, Suchtgefahr, der Verlust der Privatsphäre und verzerrte Identitätsbilder.
Was ist das Ziel der Identitätsbildung im Jugendalter?
Das Ziel ist die Beantwortung der Frage „Wer bin ich?“ und die Festigung einer stabilen Rolle innerhalb der Gesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Katharina Plate (Autor:in), 2014, Die Sozialisation Jugendlicher im digitalen Zeitalter und der Einfluss sozialer Online Netzwerke, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284996