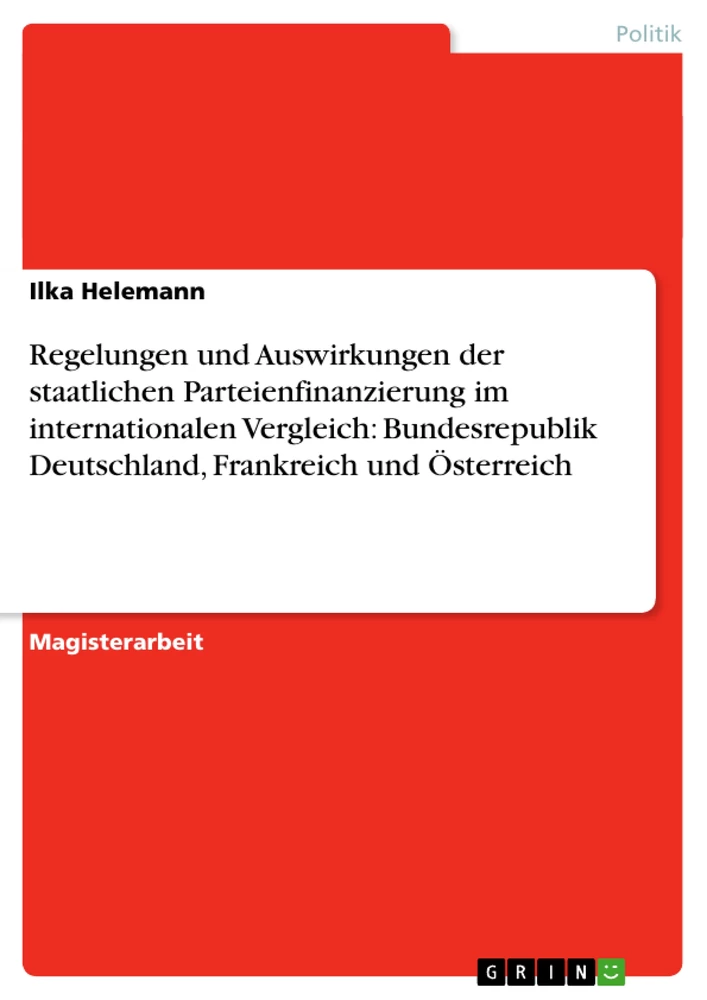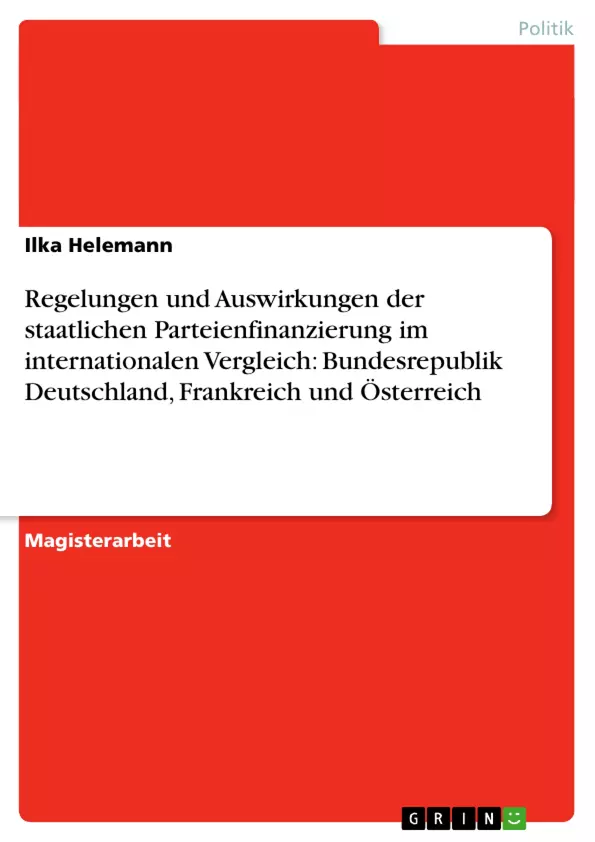Problemstellung
Bis in die 1950er Jahre galt es als selbstverständlich, dass sich politische Parteien ihre finanziellen Mittel aus eigener Kraft erwirtschafteten oder einwarben. Liberale und bürgerliche Parteien konnten sich zu einem großen Teil aus Spenden, die Linksparteien aus den Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Mit dem steigenden Anspruch der Wähler an die Parteien und den wachsenden Ausgaben für Wahlkämpfe reichte die Eigenfinanzierung nicht mehr aus. Folglich wurde nach und nach die staatliche Subventionierung der Parteien eingeführt. Diese hat sich inzwischen in den meisten westlichen Demokratien etabliert, auch wenn sie in der Öffentlichkeit auf wenig Akzeptanz stößt. Streitpunkt ist die Höhe der gewährten öffentlichen Mittel. Der Vorwurf der Selbstbedienung wird immer wieder laut - zu Recht? Vor allem in Verbindung mit Korruptionsfällen, Diätenerhöhungen und steigenden Einnahmen aus staatlicher Quelle gelangt die Parteienfinanzierung in die Kritik. Ihr wird mangelnde Transparenz vorgeworfen. Die Sanktionen für Fehlverhalten werden als nicht ausreichend betrachtet. Diese Punkte sind für viele Wissenschaftler Anlass zu Untersuchungen der Finanzierung der Parteien. In dieser Arbeit werden Länder vergleichend und mit neuestem Datenmaterial analysiert, wie es in dieser Kombination noch nicht durchgeführt wurde.
Konkurrenzfähig kann jedoch nur eine finanzstarke Partei werden. Eine kontinuierliche Parteiarbeit und die Werbung neuer Mitglieder ist nur mit einem gut ausgebauten Parteiapparat, einer hohen Organisationsstruktur und Verwaltung möglich. Das kostet Geld. Somit ist das Finanzvolumen ein ausschlaggebender Faktor, um im Parteienwettbewerb bestehen zu können bzw. sich in diesem überhaupt erst einmal zu integrieren. Für die Binnenstruktur einer Partei ist wichtig, wer über die finanziellen Mittel verfügt. Je nachdem wer das Geld in der Partei erhält, über dessen Verteilung und Verwendung bestimmt, hat eine große Machtposition inne. Die Menge der staatlichen Mittel kann Auswirkungen auf die Parteiaktivität haben. Es ist anzunehmen, dass eine Partei, die über einen hohen staatlichen Finanzierungsanteil verfügt, es nicht für dringend notwendig hält, neue Mitglieder zu werben oder Spenden zu sammeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Thema und Ziel der Arbeit
- Begründung der Themenwahl
- Auswahl der Untersuchungsstaaten
- Probleme
- Definition verschiedener Begriffe
- Parteienverständnis
- Daten- und Quellenlage
- Verfassungsrechtliche Stellung der politischen Parteien
- Bundesrepublik Deutschland
- Frankreich
- Österreich
- Fazit
- Ursachen und Umstände für die Einführung staatlicher Parteienfinanzierung
- Ursachen
- Bundesrepublik Deutschland
- Frankreich
- Österreich
- Minimierung der Korruption?
- Arten der Parteienfinanzierung
- Private Finanzierung
- Mitgliedsbeiträge
- Parteiunternehmen
- Spenden
- Parteisteuern
- Staatliche Parteienfinanzierung
- Indirekte Formen
- Presseförderung
- Sendezeiten in Rundfunk und Fernsehen
- Spendenbegünstigungen
- Finanzierung der Parlamentsfraktionen
- Finanzierung der Parteiakademien und politischen Stiftungen
- Direkte Formen
- Wahlkampfkostenerstattung
- Allgemeine Förderungsmittel
- Einnahme- und Ausgabestrukturen
- Einnahmestrukturen
- Mitgliedsbeiträge
- Spenden
- Staatliche Mittel
- Fazit
- Ausgabestrukturen
- Personalkosten
- Politische Arbeit
- Verwaltungskosten
- Fazit
- Transparenz und Offenlegungspflicht
- Rechtlicher Status
- Interne und externe Kontrollorgane
- Sanktionsmöglichkeiten
- Angewandte Sanktionen
- Auswirkungen der staatlichen Parteienfinanzierung auf die Binnenstrukturen, Parteienwettbewerb und Parteiaktivität
- Binnenstruktur
- Parteienwettbewerb
- Parteiaktivität
- Wahlsystem
- Zusammenfassung der empirischen Befunde
- Auswertung der Thesen
- Abschließende Wertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen staatlicher Parteienfinanzierung im internationalen Vergleich, insbesondere in Deutschland, Frankreich und Österreich. Ziel ist es, die gängigen Thesen über die Folgen der Parteienfinanzierung auf die Strukturen der Parteien und die Parteienlandschaft zu überprüfen.
- Der Einfluss staatlicher Finanzmittel auf die Binnenstrukturen der Parteien
- Die Auswirkungen der staatlichen Parteienfinanzierung auf den Wettbewerb zwischen Parteien
- Die Rolle der staatlichen Finanzierung für die Aktivität und das Funktionieren von Parteien
- Die Regulierung und Kontrolle der staatlichen Parteienfinanzierung in den untersuchten Ländern
- Die rechtliche und gesellschaftliche Stellung politischer Parteien in den jeweiligen Staaten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und das Ziel der Arbeit dar. Es wird die zunehmende Bedeutung der staatlichen Parteienfinanzierung und die damit verbundenen kontroversen Debatten erläutert. Das erste Kapitel definiert zentrale Begriffe und untersucht die Verfassungsrechtliche Stellung der Parteien in den drei untersuchten Staaten. Im zweiten Kapitel werden die Ursachen und Umstände für die Einführung staatlicher Parteienfinanzierung in den drei Ländern analysiert. Das dritte Kapitel widmet sich den verschiedenen Arten der Parteienfinanzierung, sowohl privaten als auch staatlichen. Im vierten Kapitel werden Einnahme- und Ausgabestrukturen der Parteien beleuchtet, mit einem Schwerpunkt auf den Einfluss staatlicher Mittel. Das fünfte Kapitel behandelt die Transparenz und Offenlegungspflicht in der Parteienfinanzierung. Abschließend werden im sechsten Kapitel die Auswirkungen der staatlichen Parteienfinanzierung auf die Binnenstrukturen der Parteien, den Parteienwettbewerb und die Parteiaktivität untersucht.
Schlüsselwörter
Parteienfinanzierung, staatliche Subventionierung, Parteienlandschaft, Binnenstruktur, Parteienwettbewerb, Parteiaktivität, Vergleichende Analyse, Deutschland, Frankreich, Österreich, Transparenz, Offenlegungspflicht, Korruption, Wahlkampf, Verfassungsrecht, politische Parteien.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde die staatliche Parteienfinanzierung eingeführt?
Da Mitgliedsbeiträge und Spenden aufgrund steigender Wahlkampfkosten oft nicht mehr ausreichten, wurde die staatliche Subventionierung eingeführt, um die kontinuierliche Parteiarbeit zu sichern.
Welche Länder werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Regelungen und Auswirkungen in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Österreich.
Was ist der Unterschied zwischen direkter und indirekter Parteienfinanzierung?
Direkte Finanzierung umfasst Geldzahlungen wie Wahlkampfkostenerstattungen. Indirekte Formen sind z.B. kostenlose Sendezeiten, Steuerbegünstigungen für Spenden oder die Finanzierung von Parteistiftungen.
Führt staatliche Finanzierung zu weniger Korruption?
Dies ist eine zentrale These der Arbeit. Es wird untersucht, ob staatliche Mittel die Abhängigkeit von Großspendern verringern und somit Korruptionsanreize minimieren.
Wie wirkt sich die Finanzierung auf die Parteiaktivität aus?
Es wird die These geprüft, ob Parteien mit hohem staatlichem Finanzierungsanteil weniger Anreize haben, aktiv neue Mitglieder zu werben oder private Spenden zu sammeln.
- Arbeit zitieren
- Ilka Helemann (Autor:in), 2004, Regelungen und Auswirkungen der staatlichen Parteienfinanzierung im internationalen Vergleich: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Österreich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28504