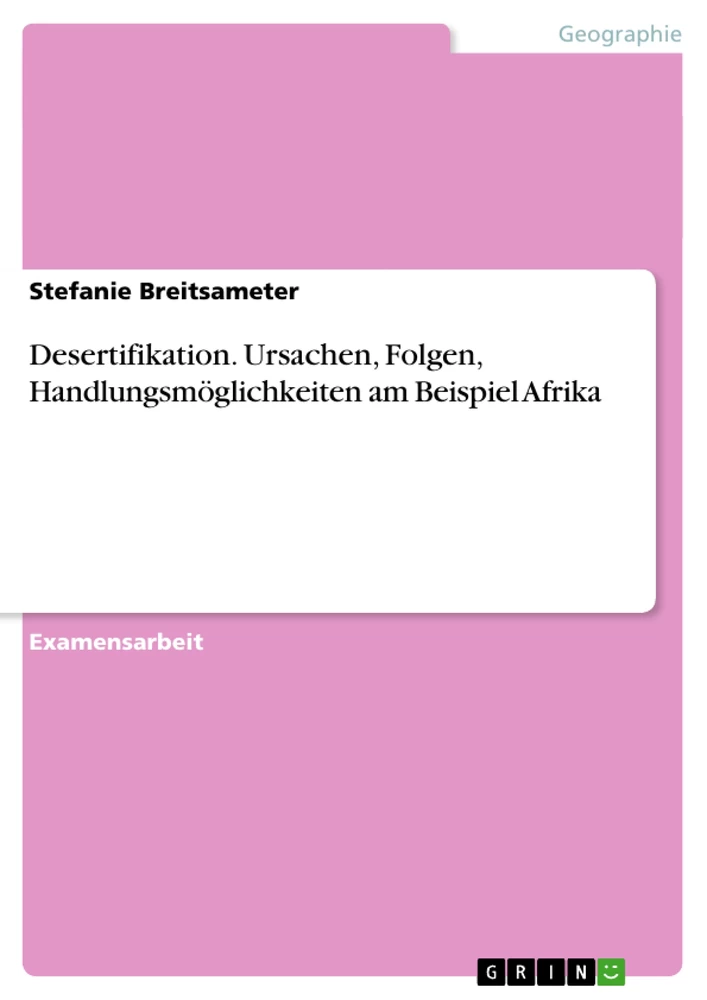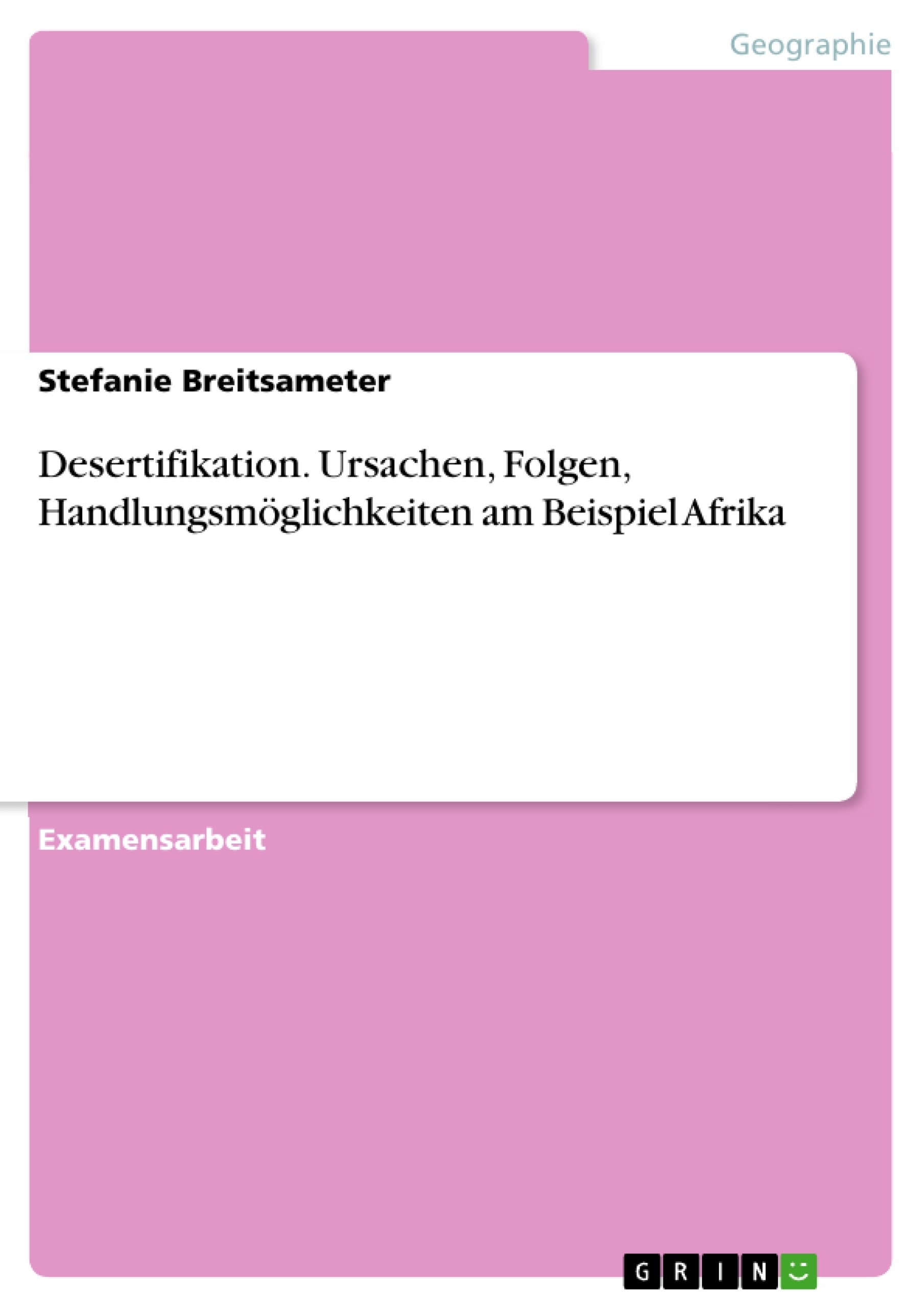Desertifikation gilt als ein Phänomen, das in bestimmten Klimaregionen auf der gesamten Welt zu beobachten ist. Am stärksten betroffen sind ökologisch empfindliche Regionen, wie zum Beispiel die ariden, semiariden und subhumiden Zonen.
Charakteristisch für diese Bereiche sind Erscheinungen, die zu einer besonders hohen Erosionsgefahr führen. Zum einen treten die Regenzeiten in kurzen, unregelmäßigen und ungleich verteilten Abständen auf, zum anderen herrschen häufige,
meist mehrere Jahre andauernde Dürreperioden mit geringen Ernteerträgen. So kann sich nur eine dünne Humusschicht mit einer sehr dünnen Vegetationsdecke entwickeln, die beispielsweise bei Starkniederschlägen oder exzessiver Landnutzung schnell erodiert und keinerlei Schutz für die Bodenschichten bietet. Obwohl die Böden dieser Zonen wenig geeignet sind, werden sie dennoch landwirtschaftlich genutzt. Die Bewohner dieser Regionen haben sich mit traditionellen Bewirtschaftungssystemen an das herrschende Klima angepasst und damit den Anbau ihre Grundnahrungsmittel gesichert. Allerdings zwingen Bevölkerungswachstum und der zunehmende Export von Nahrungsmitteln in vielen gefährdeten Regionen zu einer intensiveren Landnutzung und in der Folge zu Bodendegradation. So werden beispielsweise nicht nur „food crops“ wie Sorghum oder Hirse zur eigenen Versorgung, sondern auch „cash crops“ wie Erdnüsse oder Baumwolle für den Weltmarkt angebaut (HAUSER 1990, S. 148).
Zusätzlich tragen die Technisierung der Landwirtschaft durch Traktoreneinsatz statt Zugtiere und die Einführung erosionsfördernder Feldfrüchte aufgrund starker Bewässerung dazu bei, dass die von Bodenerosion und Desertifikation betroffenen Gebiete weiter zunehmen. Das reduziert die Anbauflächen bei gleichzeitiger Erhöhung der Anbaumengen und führt zu einem Nutzungskonflikt sowie zur Aufgabe von traditionellen Bewirtschaftungstechniken und schließlich zur Übernutzung und Ausbeutung der Agrarflächen (FELGENTREFF; GLADE 2008, S. 197).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in die Probleme von Desertifikation
- 2. Desertifikation – Verbreitung eines globalen Problems
- 2.1 Definition,,Desertifikation“ und Abgrenzung zum Begriff ,,encroachment“
- 2.2 Geographische Verbreitung von Desertifikation
- 2.3 Prozesse der Bodenerosion und Desertifikation
- 2.4 Dürren und Dürrekatastrophen als Auslöser für Desertifikation
- 3. Entstehung von Desertifikation vor dem Hintergrund von physischen Prädispositionen
- 3.1 Landwirtschaftliche Nutzung als Faktor von Desertifikation
- 3.2 Sozioökonomische und politische Aspekte bei der Desertifikation
- 3.3 Indikatoren für Desertifikation
- 3.4 Zeitliche und räumliche Variabilität als Schwierigkeit bei Messmethoden und Modellierung von Desertifikation
- 4. Folgen für das Ökosystem und die Gesellschaft durch Desertifikation
- 4.1 Klimatische Auswirkungen auf das Ökosystem
- 4.2 Produktionsschäden in der Landwirtschaft
- 4.3 Veränderungen im Wasserhaushalt
- 4.4 Sozioökonomische Folgen am Beispiel des Nomadentums
- 4.5 Wirtschaftspolitische Folgen
- 5. Handlungsmaßnahmen gegen Desertifikation
- 5.1 Maßnahmen in der Landwirtschaft
- 5.1.1 Ökologisch angepasste Nutzung im Senegal
- 5.1.2 Der humanökologische Ansatz als Erosionsschutzmaßnahme in der Kalahari
- 5.1.3 Maßnahmen gegen Wind- und Wassererosion und ihre Erfolge
- 5.1.4 Maßnahmen in der Bewässerungslandwirtschaft
- 5.1.5 Das „,,Holistic Management“ als ökologische Maßnahme gegen Desertifikation
- 5.2 Siedlungsmaßnahmen
- 5.3 Politische Maßnahmen
- 6. Vorsorge und Frühwarnung vor Desertifikation
- 6.1,,Soil Conservation Service“ – Das Informationssystem der USA über Bodenerosion
- 6.2 Angepasste Vegetation als natürliche Bodenbefestigung
- 6.3 Das,,Drought of Cycle Management“ als Bewältigungsstrategie von Dürrekatastrophen
- 6.4 Das,,monitoring system“ der UNO im Zusammenhang mit dem Versicherungsschutz von Kleinbauern
- 7. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zulassungsarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Desertifikation und untersucht die Ursachen, Folgen und Handlungsmöglichkeiten im Kontext des afrikanischen Kontinents. Die Arbeit analysiert die komplexen Prozesse der Bodendegradation, die durch natürliche Faktoren wie Dürren und durch menschliche Aktivitäten wie übermäßige Landnutzung beeinflusst werden.
- Definition und Verbreitung von Desertifikation
- Ursachen für Desertifikation, einschließlich menschlicher und natürlicher Faktoren
- Folgen von Desertifikation für das Ökosystem und die Gesellschaft
- Mögliche Handlungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Desertifikation
- Vorsorge und Frühwarnungssysteme zur Vermeidung weiterer Bodendegradation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung der Desertifikation ein und beleuchtet die Bedeutung des Themas im Kontext von ökologisch empfindlichen Regionen. Kapitel zwei befasst sich mit der Verbreitung und den Ursachen von Desertifikation, wobei die Prozesse der Bodenerosion und die Rolle von Dürren im Vordergrund stehen. Kapitel drei analysiert die Entstehung von Desertifikation vor dem Hintergrund von physischen Prädispositionen und betrachtet dabei die Rolle der Landwirtschaft, sozioökonomische Aspekte und Indikatoren für Desertifikation. Kapitel vier untersucht die Folgen von Desertifikation für das Ökosystem und die Gesellschaft, einschließlich der Auswirkungen auf das Klima, die Landwirtschaft, den Wasserhaushalt und die sozioökonomischen Verhältnisse. Kapitel fünf beleuchtet verschiedene Handlungsmaßnahmen gegen Desertifikation, die sich sowohl auf die Landwirtschaft als auch auf die Siedlungsplanung und Politik beziehen. Schließlich widmet sich Kapitel sechs der Vorsorge und Frühwarnung vor Desertifikation und stellt verschiedene Ansätze und Systeme vor.
Schlüsselwörter
Desertifikation, Bodendegradation, Dürre, Landnutzung, Landwirtschaft, Ökosystem, Gesellschaft, Handlungsmaßnahmen, Vorsorge, Frühwarnung, Afrika
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Desertifikation und "encroachment"?
Desertifikation ist die vom Menschen verursachte Wüstenbildung in ariden Zonen, während "encroachment" eher das natürliche Vordringen der Wüste in angrenzende Gebiete beschreibt.
Welche Rolle spielt die Landwirtschaft bei der Wüstenbildung in Afrika?
Überweidung, exzessive Landnutzung für "cash crops" wie Baumwolle und die Aufgabe traditioneller Techniken führen zur Bodendegradation und Erosion.
Was sind die sozioökonomischen Folgen der Desertifikation?
Dazu gehören Ernteausfälle, Wasserknappheit, der Verlust der Lebensgrundlage für Nomaden und die daraus resultierende Armut und Migration.
Welche Maßnahmen helfen gegen Wind- und Wassererosion?
Handlungsmaßnahmen umfassen ökologisch angepasste Nutzung, Erosionsschutz durch angepasste Vegetation und Ansätze wie das "Holistic Management".
Was ist ein "Drought Cycle Management"?
Es ist eine Bewältigungsstrategie für Dürrekatastrophen, die auf Frühwarnung und Vorsorge setzt, um die Auswirkungen von Trockenperioden auf Kleinbauern zu minimieren.
- Quote paper
- Stefanie Breitsameter (Author), 2014, Desertifikation. Ursachen, Folgen, Handlungsmöglichkeiten am Beispiel Afrika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285158