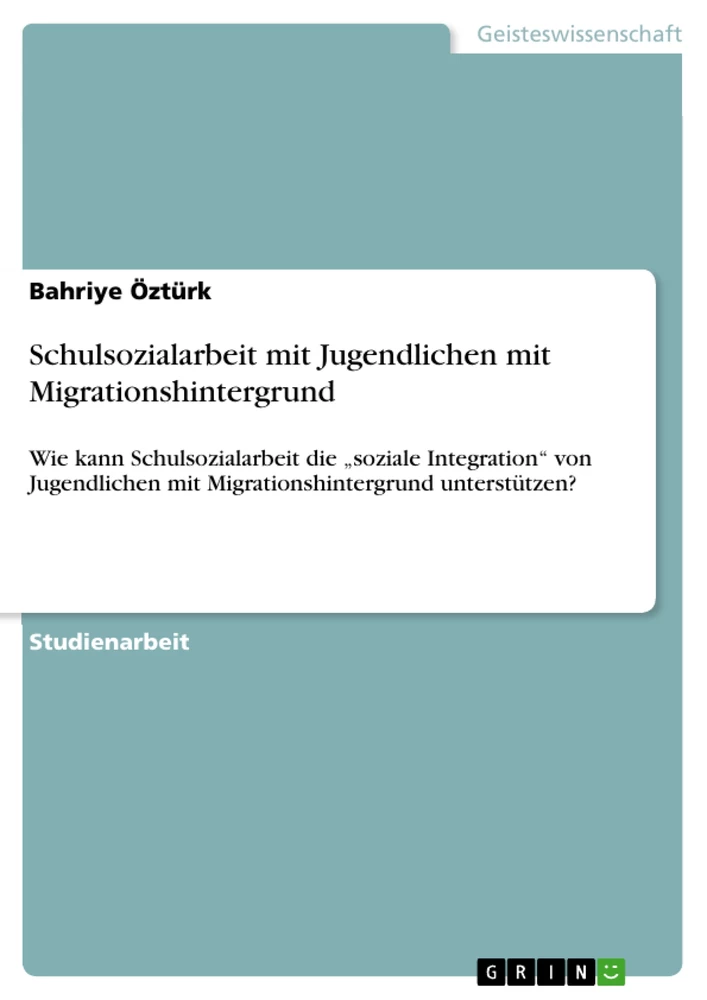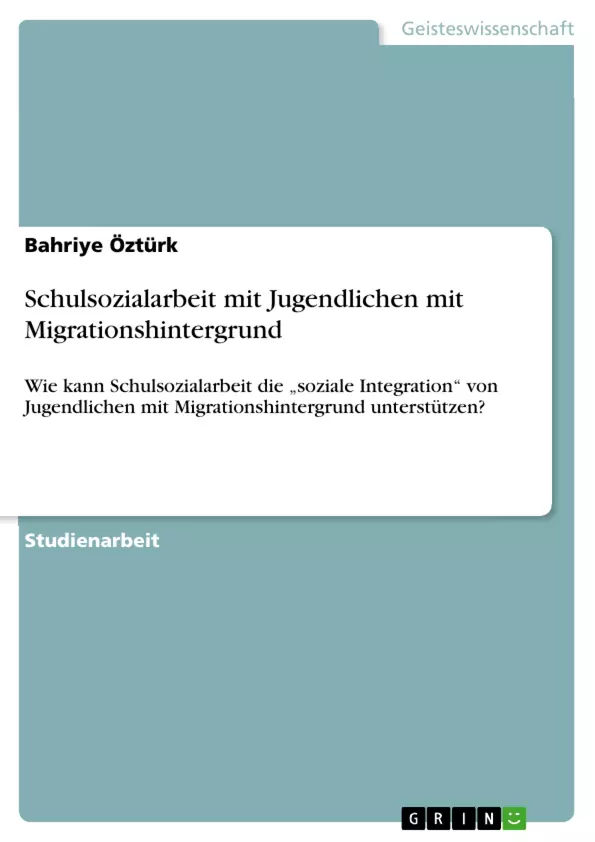Das Thema Integrationsforderungen, Integrationsprobleme, sowie Integrationsverweigerung sind Schlagwörter des 21. Jahrhunderts. Durch die Zunahme ethnisch heterogener Gruppen und die dadurch entstandenen Probleme für Politik und Staat, als auch für das Bildungssystem und die Soziale Arbeit ergeben sich neue Herausforderungen. Deutschland gilt als Einwanderungsland. Migranten verlassen ihre Heimat, um ein Neuanfang in ihrem Leben zu starten, indem sie sich in einem neuen Ort niederlassen. Manche von ihnen wollen sich dort nur für kurze Zeit aufhalten, manche jedoch für immer. Viele von ihnen verlassen ihr Heimat aufgrund Gewalt, wirtschaftlicher und politischer Probleme oder auch um Vorteile der globalen Mobilität zu nutzen. Gerade Familien verlassen ihr Heimatland, damit sie ihren Kindern ein besseres Leben bieten können. Doch die Einwanderung in ein fremdes Land bringt Schwierigkeiten mit sich, denn die Eltern, als auch die Kinder müssen sich in eine neue Kultur und Gesellschaft des jeweiligen Landes integrieren. Vor allem bedeutet dies für Jugendliche mit Migrationshintergrund große Probleme, die sie erstmals bewältigen müssen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Soziale Arbeit
- 2.1 Definition
- 2.2 Schulsozialarbeit
- 2.2.1 Definition
- 2.2.2 Funktion und Angebote der Schulsozialarbeit
- 3. Soziale Integration
- 3.1 Definition
- 3.2 Kontakte und Milieus Jugendlicher mit Migrationshintergrund
- 4. Migration/Migrationshintergrund
- 4.1 Definition
- 4.2 Kultur und Ethnizität
- 4.3 Jugendliche und Migration
- 4.3.1 Auswirkungen der Migration auf die Identität der Jugendlichen
- 4.3.2 Soziale Probleme Jugendlicher mit Migrationshintergrund
- 4.4 Schulsozialarbeit und Migration
- 4.4.1 Migrationspädagogische Kompetenz
- 4.4.2 Praxisbeispiel aus der Schulsozialarbeit
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rolle der Schulsozialarbeit bei der Unterstützung der sozialen Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Sie untersucht die Herausforderungen, denen diese Jugendlichen im Bildungssystem und in der Gesellschaft gegenüberstehen, und beleuchtet die Möglichkeiten, wie Schulsozialarbeit dazu beitragen kann, diese Herausforderungen zu meistern.
- Definition und Bedeutung der sozialen Integration im Kontext von Migration
- Herausforderungen und Chancen für Jugendliche mit Migrationshintergrund im Bildungssystem
- Die Rolle der Kultur und Identität in der Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Möglichkeiten und Grenzen der Schulsozialarbeit bei der Förderung der sozialen Integration
- Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen für die Schulsozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der sozialen Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ein und stellt die Forschungsfrage: „Wie kann Schulsozialarbeit die soziale Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund unterstützen?“.
Kapitel 2 definiert die Soziale Arbeit und die Schulsozialarbeit, wobei der Fokus auf der Funktion und den Angeboten der Schulsozialarbeit liegt.
Kapitel 3 behandelt die Definition und Bedeutung der sozialen Integration im Kontext von Migration und beleuchtet die besonderen Herausforderungen, denen Jugendliche mit Migrationshintergrund in diesem Bereich gegenüberstehen.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Thema Migration und Migrationshintergrund, wobei die Auswirkungen der Migration auf die Identität der Jugendlichen und die sozialen Probleme, die damit verbunden sein können, im Mittelpunkt stehen.
Kapitel 4.4 untersucht die Rolle der Schulsozialarbeit in Bezug auf Migration und beleuchtet die Bedeutung der migrationspädagogischen Kompetenz.
Schlüsselwörter
Soziale Integration, Schulsozialarbeit, Migration, Migrationshintergrund, Jugendliche, Identität, Kultur, Ethnizität, Bildung, Benachteiligung, Inklusion, Praxisbeispiel, Handlungsempfehlung.
- Arbeit zitieren
- Bahriye Öztürk (Autor:in), 2013, Schulsozialarbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285200