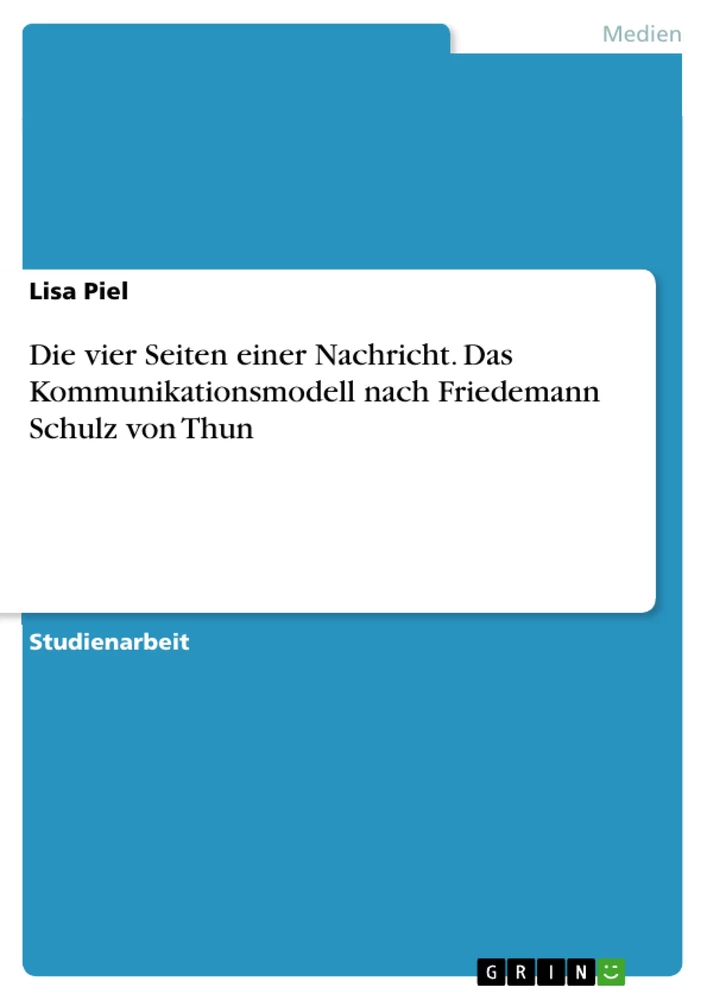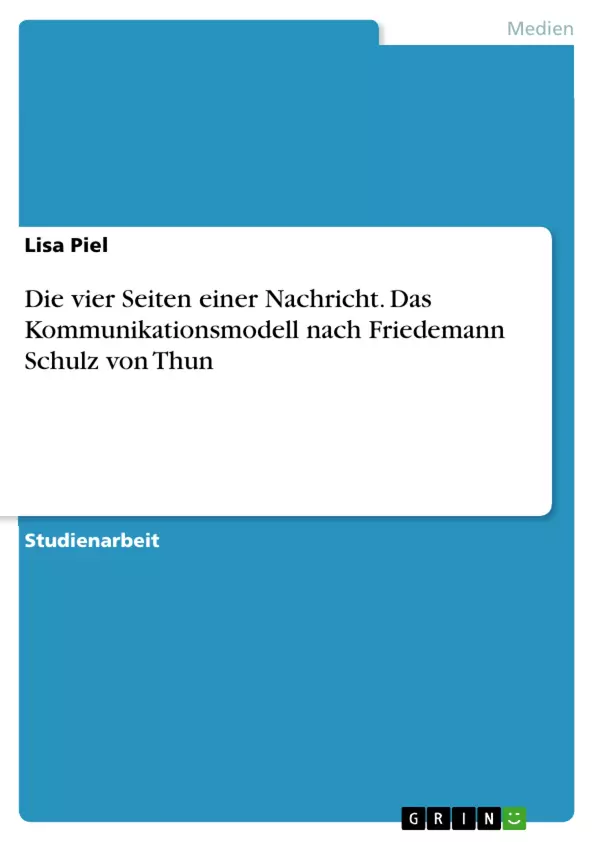Diese Arbeit erläutert das Kommunikationsmodell „Quadrat einer Nachricht“ nach Friedemann Schulz von Thun und zeigt auf, was genau geschieht, wenn man miteinander kommuniziert. Dabei werden die vier Seiten einer Nachricht nach Thun betrachtet und die Idee des „vierohrigen Empfängers“ vorgestellt.
Die Kommunikation ist zweifelsohne eine der komplexesten und wichtigsten Fähigkeiten des Menschen. Leider ist eine gelungene zwischenmenschliche Kommunikation oft nicht die Regel. Um zu verstehen warum es häufig zu Störungen, und in deren Folge auch zu Konflikten, kommt muss man verstehen was genau passiert, wenn man kommuniziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Friedemann Schulz von Thun - Kurzbiographie
- Das Kommunikationsquadrat
- Die vier Seiten einer Nachricht
- Der Sachinhalt
- Die Selbstoffenbarung
- Der Beziehungshinweis
- Der Appell
- Mit vier Ohren empfangen
- Das „Sach-Ohr“
- Das „Selbstoffenbarungs-Ohr“
- Das „Beziehungs-Ohr“
- Das „Appell-Ohr“
- Beispiel
- Die vier Seiten einer Nachricht
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Kommunikationsmodell „Quadrat einer Nachricht“ von Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun. Ziel ist es, das Modell detailliert zu erläutern und aufzuzeigen, welche Prozesse bei der Kommunikation zwischen Menschen stattfinden.
- Die vier Seiten einer Nachricht: Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehungshinweis, Appell
- Die vier Ohren des Empfängers: Sach-Ohr, Selbstoffenbarungs-Ohr, Beziehungs-Ohr, Appell-Ohr
- Die Bedeutung der „Quadratischen Klarheit“ für eine gelungene Kommunikation
- Beispiele für die Anwendung des Kommunikationsquadrats in verschiedenen Situationen
- Die Bedeutung des Modells für die Vermeidung von Missverständnissen und Konflikten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Kommunikation und die Bedeutung des Kommunikationsmodells von Friedemann Schulz von Thun ein. Das erste Kapitel widmet sich der Kurzbiographie des Autors, während das zweite Kapitel das Kommunikationsquadrat im Detail vorstellt. Hier werden die vier Seiten einer Nachricht und die vier Ohren des Empfängers erklärt.
Schlüsselwörter
Kommunikationsmodell, Quadrat einer Nachricht, Vier-Ohren-Modell, Friedemann Schulz von Thun, Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehungshinweis, Appell, Sach-Ohr, Selbstoffenbarungs-Ohr, Beziehungs-Ohr, Appell-Ohr, Kommunikationsschwierigkeiten, Missverständnisse, Konflikte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun?
Das Kommunikationsquadrat, auch Vier-Seiten-Modell genannt, beschreibt, dass jede Nachricht vier Botschaften gleichzeitig enthält: Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehungshinweis und Appell.
Was bedeutet die Seite der Selbstoffenbarung?
Auf der Seite der Selbstoffenbarung gibt der Sprecher – gewollt oder ungewollt – Informationen über seine Persönlichkeit, seine Gefühle oder seine Verfassung preis.
Was ist mit dem „vierohrigen Empfänger“ gemeint?
Der Empfänger einer Nachricht kann diese mit vier verschiedenen „Ohren“ wahrnehmen: dem Sach-Ohr, dem Selbstoffenbarungs-Ohr, dem Beziehungs-Ohr oder dem Appell-Ohr, je nachdem, worauf er seinen Fokus legt.
Warum entstehen Missverständnisse in der Kommunikation?
Missverständnisse entstehen oft, wenn der Sender eine Nachricht auf einer bestimmten Seite (z. B. Appell) betont, der Empfänger sie aber mit einem anderen Ohr (z. B. Beziehungs-Ohr) aufnimmt.
Was ist der Beziehungshinweis einer Nachricht?
Der Beziehungshinweis sagt etwas darüber aus, wie der Sender zum Empfänger steht und was er von ihm hält, oft vermittelt durch Mimik, Gestik oder Tonfall.
- Quote paper
- Lisa Piel (Author), 2011, Die vier Seiten einer Nachricht. Das Kommunikationsmodell nach Friedemann Schulz von Thun, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285226