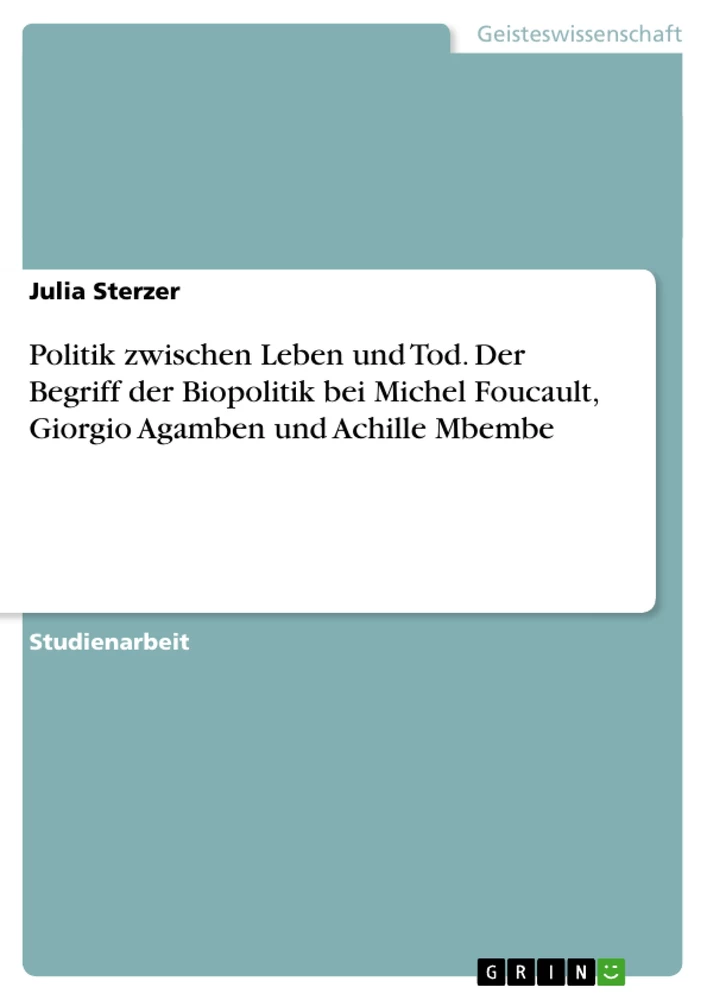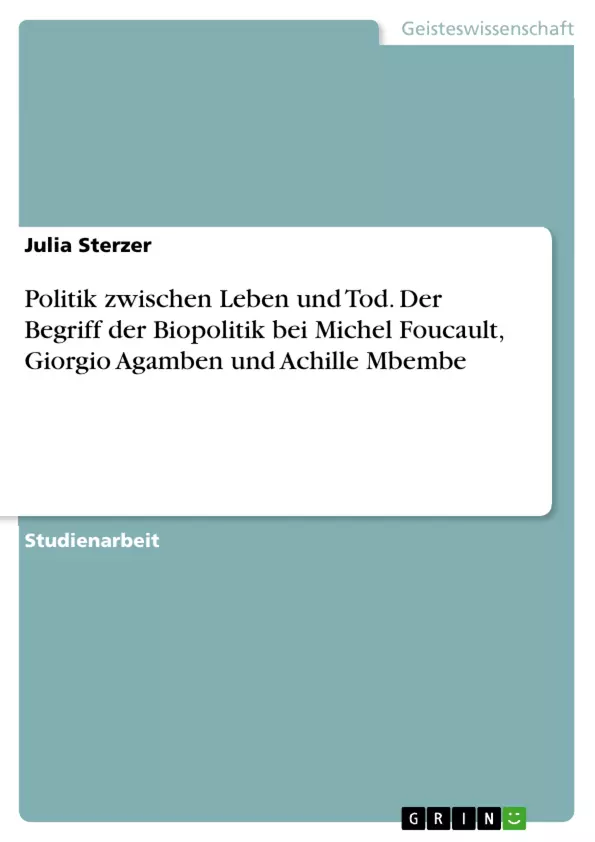Die vorliegende Arbeit behandelt die Thematik der Biopolitik und deren Verhältnis von Leben und Tod. Hierbei werden exemplarisch die unterschiedlichen Genealogien der Biopolitik nach Michel FOUCAULT, Giorgio AGAMBEN und Achille MBEMBE herangezogen. Da der Begriff der Biopolitik im wissenschaftlichen Diskurs in einer Vielzahl von Disziplinen und Thematiken Verwendung findet, darunter auch Mikrokredite und Entwicklungspolitik, Geschlecht und Macht, Asylpolitik und HIV- Prävention ist sicherlich die Herausarbeitung dessen notwendig, was genau Biopolitik meint, worin die Unterschiede verschiedener Lesarten der Biopolitik bestehen und inwiefern sich diese in ihrem Verhältnis von souveräner Todesmacht und biopolitischer Gestaltung des Lebens unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff der Biopolitik bei Foucault
- Der Eintritt des Lebens in die Politik
- Die Genealogie der Biopolitik
- Der Tod im Dienste des Lebens
- Thanatopolitik – Das heilige und das nackte Leben in der Biopolitik
- Agambens alternative Genealogie der Biopolitik
- Das Lager als biopolitischer Raum
- Nekropolitik – Die „verallgemeinerte Instrumentalisierung der menschlichen Existenz“
- Die Entwicklung der Bio-Macht nach MBEMBE
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Begriff der Biopolitik und sein Verhältnis zu Leben und Tod. Dabei werden exemplarisch die unterschiedlichen Genealogien der Biopolitik nach Michel Foucault, Giorgio Agamben und Achille Mbembe betrachtet. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Lesarten des Begriffs der Biopolitik und ihre Unterschiede im Verhältnis von souveräner Todesmacht und biopolitischer Gestaltung des Lebens.
- Die verschiedenen Lesarten des Begriffs der Biopolitik
- Die Zäsur zwischen Souveränitätsmacht und Bio-Macht
- Das Verhältnis von Leben und Tod in der Biopolitik
- Die Rolle des Rassismus in der Biopolitik
- Die Erweiterung des biopolitischen Begriffs durch die Thanatopolitik und Nekropolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2.1 stellt einführend verschiedene Lesarten des Begriffs der Biopolitik vor, wobei die Argumentation auf Lemke (2007a) sowie Folkers/Lemke (2014) aufbaut. Kapitel 2.2 beleuchtet Foucaults Ausführungen zur Genealogie der Biopolitik, mit Schwerpunkt auf dem Verhältnis zwischen Leben und Tod. Es werden die Unterschiede zwischen souveräner Macht und Bio-Macht sowie die Transformation der Machtmechanismen von der Todesmacht zur Macht des Lebens hervorgehoben. Kapitel 2.3 analysiert die Rolle des Todes in einer Politik des Lebens und stellt die Bedeutung des Rassismus in der Biopolitik dar. Kapitel 3 beleuchtet Agambens Theorie der „Thanatopolitik“ und ihre Unterschiede zur Foucaultschen Lesart der Biopolitik. Kapitel 4 stellt MBEMBEs Konzept der „Nekropolitik“ vor und erweitert den biopolitischen Begriff um die postkoloniale Perspektive.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Begriff der Biopolitik, der Bio-Macht, Souveränitätsmacht, Todesmacht, Thanatopolitik, Nekropolitik, Rassismus, Leben und Tod. Weitere wichtige Themen sind die Genealogien der Biopolitik nach Foucault, Agamben und Mbembe, sowie der Ausnahmezustand, die Kolonialgeschichte und die Kriegsführung der Globalisierungsära.
- Citar trabajo
- Julia Sterzer (Autor), 2014, Politik zwischen Leben und Tod. Der Begriff der Biopolitik bei Michel Foucault, Giorgio Agamben und Achille Mbembe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285237