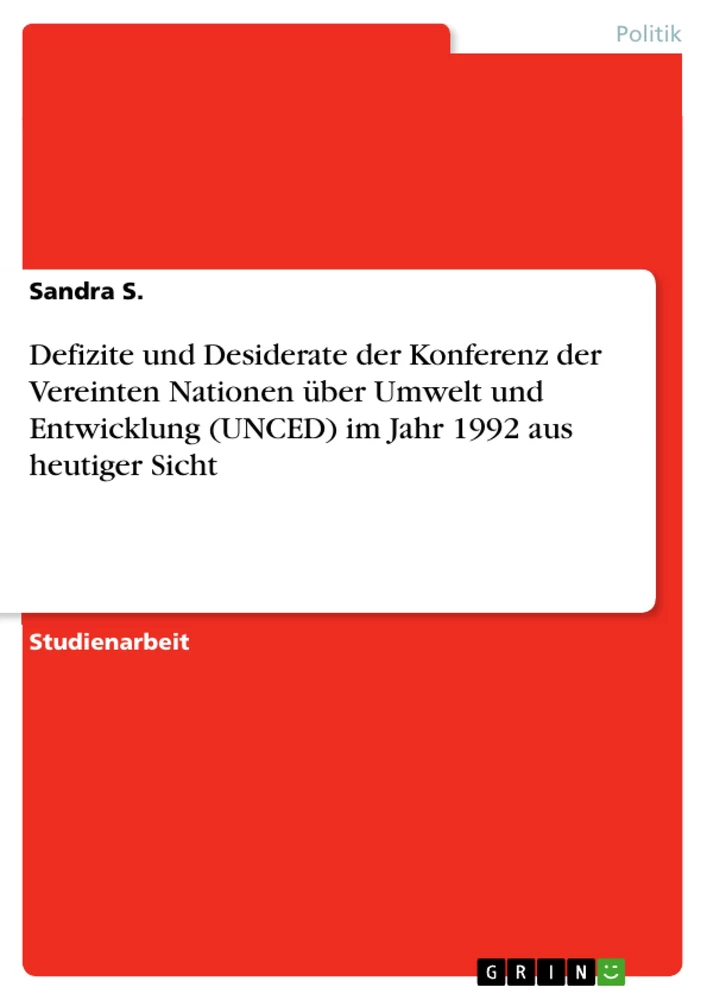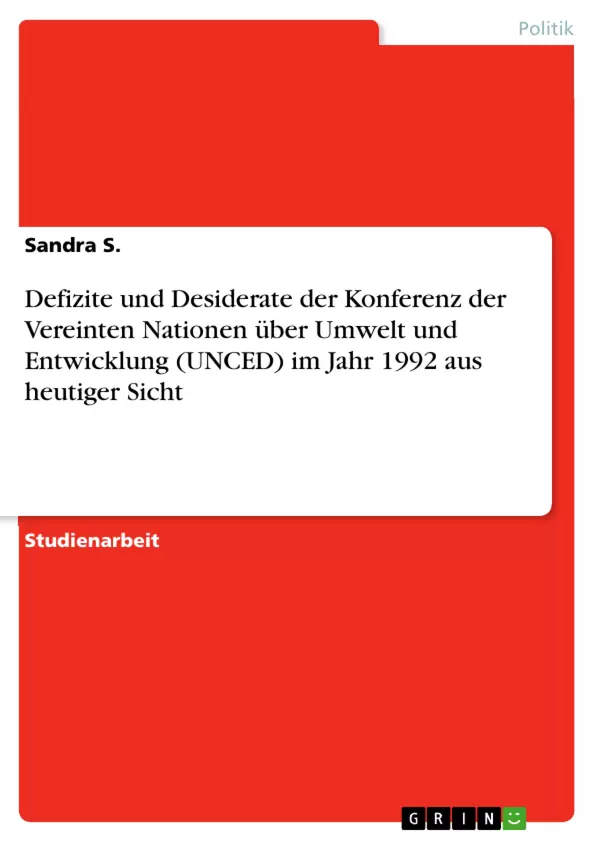Täglich sterben hunderte Tier- und Pflanzenarten aus, der Klimawandel wird beschleunigt, der Meeresspiegel steigt an, verheerende Umweltkatastrophen bedrohen Menschenleben. Doch die weltweise Umweltkrise ist kein neues Phänomen. Bereits 1972 trafen sich erstmals Regierungsvertreter zu einem globalen Umweltgipfel, um über mögliche Lösungen zu diskutieren.
Zwanzig Jahre später kam es in Rio de Janeiro erneut zu einem internationalen Gipfeltreffen zum Thema Umwelt und Entwicklung – ein zweiter Meilenstein der globalen Umweltpolitik. Neun Tage lang wurde im Juni 1992 in Rio de Janeiro nach Lösungen für globale Umweltprobleme gesucht. Bei der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung ging es vor allem um die Bekämpfung des Klimawandels und nachhaltige internationale Entwicklung. Delegationen aus 170 Ländern kamen zusammen, um Ziele für Umwelt und Entwicklung zu generieren.
Zu ihren wichtigsten Ergebnissen kann die Konferenz die Agenda 21, die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, die Klimarahmenkonvention und die Biodiversitäts-Konvention zählen.
Doch sind die Ergebnisse der Konferenz aus heutiger Sicht, über 20 Jahre nach dem Gipfel, positiv zu bewerten? Sind Erfolge im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung, Erhalt der Biodiversität oder Klimawandel zu verzeichnen? Oder muss die Konferenz sowie ihre Ergebnisse viel mehr als ein Misserfolg angesehen werden?
Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden, indem zunächst die Konferenz im Allgemeinen vorgestellt wird. Im Anschluss werden die einzelnen Ziele und deren Ergebnisse genauer betrachtet, um Erfolge und Grenzen in den Plänen zu analysieren. Hierbei konzentriert sich die Arbeit auf die Ziele und Ergebnisse im Bereich der Umweltpolitik.
Abschließend soll es darum gehen, ob die UNCED grundsätzlich als ein Erfolg für die globale Umweltpolitik gesehen werden kann oder ob sie in ihren Ergebnissen an ihre Grenzen gestoßen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED)-Rio-Konferenz
- Ablauf und Hintergründe
- Inhalte und Zielsetzungen
- Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt
- Agenda 21
- Einordnung in die globale Umweltpolitik
- Ergebnisse der UNCED
- Die Klimarahmenkonvention
- Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt
- Agenda 21
- Defizite und Desiderate der UNCED
- Klimarahmenkonvention
- Defizite
- Definitorische Probleme
- Unterscheidung Entwicklungsländer und Industriestaaten
- Desiderate
- Das Kyoto-Protokoll
- Entwicklung der Treibhausgasemissionen
- Defizite
- Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt
- Defizite
- Desiderate
- Klimarahmenkonvention
- Schlussbetrachtungen/Fazit
- Literaturverzeichnis
- Primärquellen
- Sekundärquellen
- Literatur
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) aus dem Jahr 1992, auch bekannt als Rio-Konferenz, aus heutiger Sicht. Ziel ist es, die Defizite und Desiderate der Konferenz im Hinblick auf die globale Umweltpolitik zu beleuchten und deren Relevanz für die nachhaltige Entwicklung zu bewerten. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Klimarahmenkonvention und die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt, zwei zentrale Ergebnisse der UNCED.
- Bewertung der Ergebnisse der UNCED im Kontext der globalen Umweltpolitik
- Analyse der Defizite und Desiderate der Klimarahmenkonvention
- Bewertung der Wirksamkeit der Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt
- Bedeutung der UNCED für die nachhaltige Entwicklung
- Relevanz der Ergebnisse der UNCED für die heutige Umweltpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der globalen Umweltkrise ein und stellt die Rio-Konferenz als wichtigen Meilenstein der internationalen Umweltpolitik vor. Sie beleuchtet die Hintergründe und Ziele der Konferenz und stellt die wichtigsten Ergebnisse, wie die Klimarahmenkonvention, die Biodiversitäts-Konvention und die Agenda 21, vor. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse der Defizite und Desiderate der UNCED im Hinblick auf die Umweltpolitik.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Rio-Konferenz im Detail. Es werden der Ablauf und die Hintergründe der Konferenz sowie die Inhalte und Zielsetzungen der UNCED erläutert. Dabei wird insbesondere auf die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt und die Agenda 21 eingegangen. Das Kapitel beleuchtet auch die Einordnung der Rio-Konferenz in die globale Umweltpolitik und stellt die Bedeutung der Konferenz für die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Umweltpolitik heraus.
Das dritte Kapitel präsentiert die wichtigsten Ergebnisse der UNCED, darunter die Klimarahmenkonvention, die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt und die Agenda 21. Es werden die Inhalte und Zielsetzungen dieser Ergebnisse kurz zusammengefasst.
Das vierte Kapitel analysiert die Defizite und Desiderate der UNCED im Hinblick auf die Klimarahmenkonvention und die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt. Es werden die definitorischen Probleme und die Unterscheidung zwischen Entwicklungsländern und Industriestaaten im Kontext der Klimarahmenkonvention beleuchtet. Zudem werden die Entwicklung der Treibhausgasemissionen und das Kyoto-Protokoll als wichtige Desiderate der Klimarahmenkonvention betrachtet. Im Bereich der Biodiversitäts-Konvention werden die Defizite und Desiderate im Hinblick auf die Umsetzung der Konvention und die Erhaltung der biologischen Vielfalt analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED), die Rio-Konferenz, die Klimarahmenkonvention, die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt, die Agenda 21, Defizite, Desiderate, globale Umweltpolitik, nachhaltige Entwicklung, Klimawandel, Biodiversität, Entwicklungsländer, Industriestaaten, Kyoto-Protokoll, Treibhausgasemissionen.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Hauptziel der UNCED-Konferenz 1992 in Rio de Janeiro?
Das Hauptziel der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) war die Suche nach globalen Lösungen für Umweltprobleme, insbesondere die Bekämpfung des Klimawandels und die Förderung einer nachhaltigen internationalen Entwicklung.
Welche zentralen Ergebnisse gingen aus der Rio-Konferenz hervor?
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen die Agenda 21, die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, die Klimarahmenkonvention sowie die Biodiversitäts-Konvention.
Welche Defizite weist die Klimarahmenkonvention aus heutiger Sicht auf?
Kritisiert werden vor allem definitorische Probleme sowie die schwierige Unterscheidung zwischen den Verpflichtungen von Entwicklungsländern und Industriestaaten.
Was versteht man unter der Agenda 21?
Die Agenda 21 ist ein umfassendes Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert, das Leitlinien für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft festlegt.
Wie wird der Erfolg der Biodiversitäts-Konvention bewertet?
Obwohl sie ein Meilenstein war, zeigen die Analysen deutliche Grenzen bei der praktischen Umsetzung und der tatsächlichen Erhaltung der biologischen Vielfalt auf.
Welche Rolle spielt das Kyoto-Protokoll im Kontext der UNCED?
Das Kyoto-Protokoll wird als wichtiges Desiderat (erwünschtes Ziel) der Klimarahmenkonvention betrachtet, um verbindliche Ziele für die Reduktion von Treibhausgasemissionen zu setzen.
- Quote paper
- Sandra S. (Author), 2014, Defizite und Desiderate der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Jahr 1992 aus heutiger Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285528