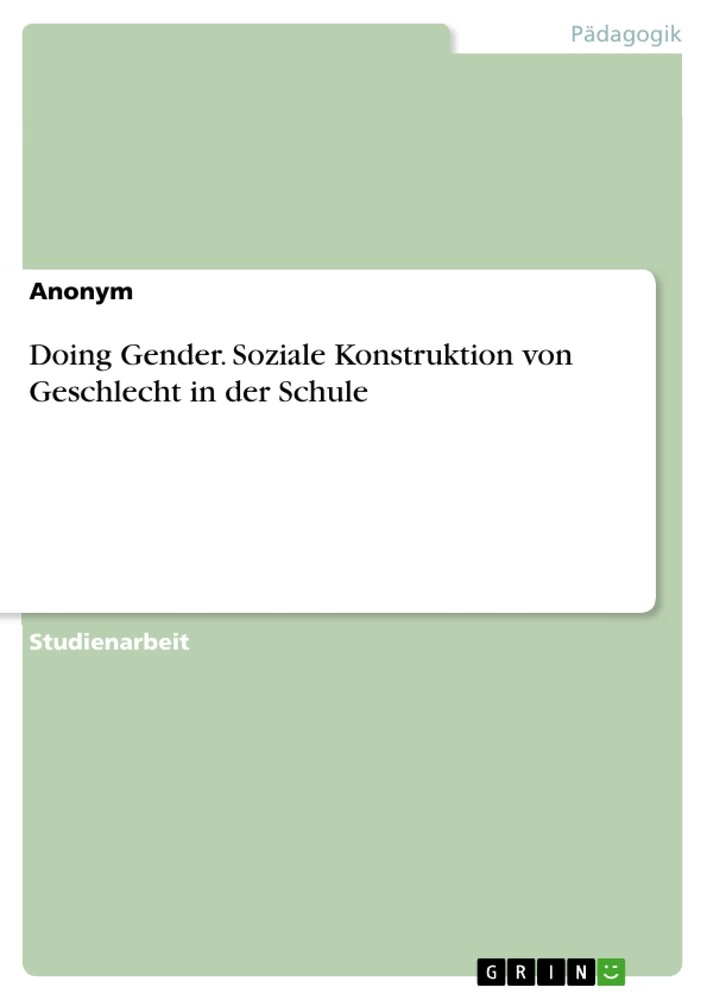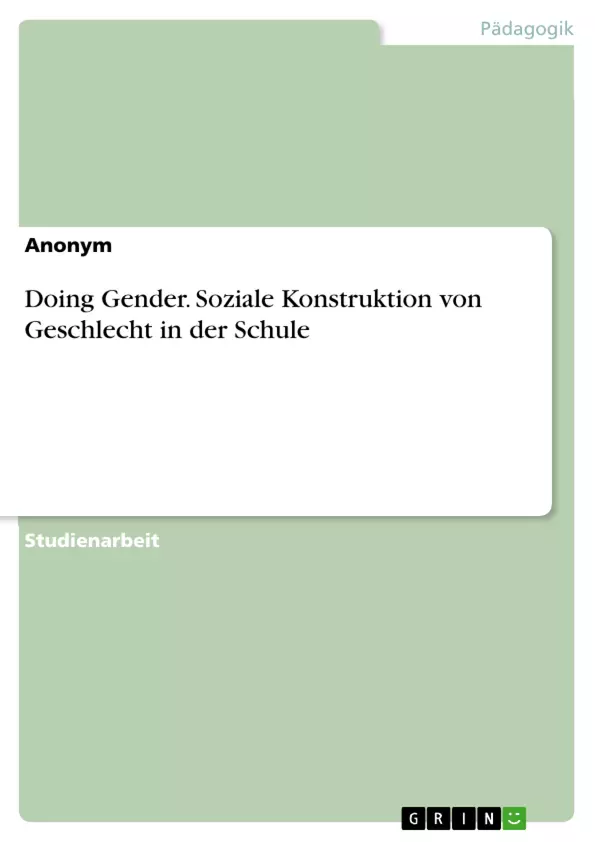Geschlechtsrollenverhalten wird von klein auf gelernt und durch die Rollenerwartungen des Umfelds bestärkt. Das Denken in zwei Geschlechtern hat in jedem Menschen Vorstellungen und Erwartungen zur Folge, wie das eigene oder das andere Geschlecht zu sein oder sich zu verhalten hat. Diese Vorstellungen sind ein gestaltendes und prägendes Element in der Interaktion und Kommunikation. So wird „Gender“ als soziale Konstruktion im Alltag ständig hergestellt. Dieser Prozess wird als „Doing Gender“ bezeichnet. Auch die Institution Schule ist ein soziales System, in der die Konstruktion von Geschlecht eine wichtige Rolle spielt.
Im Rahmen dieser Arbeit wird sich mit dem Thema „Doing Gender“ in der Grundschule auseinandergesetzt. Es soll herausgearbeitet werden, wie die Lehrkräfte zur Konstruktion von Geschlecht in der Grundschule beitragen. Zu diesem nicht ganz unkomplizierten Feld der Schulforschung existieren bis heute erst wenige Studien. Dies erstaunt, da Lehrkräften ein wichtiger Anteil bei der Gestaltung des schulischen Alltags zukommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Einführung: Geschlechtertheoretische Grundlagen
- 1.1 Definition „Gender“
- 1.2 Definition „Doing Gender“
- 1.3 Zusammenfassung
- 2 Gender in der Grundschule
- 2.1 Geschlechterdifferenzen in der Schule
- 2.1.1 Geschlechtertypische Schulleistungen der Schüler und Schülerinnen
- 2.1.2 Geschlechterbezogene Interaktionen in der Schule
- 2.2 Doing Gender im Schulalltag – Unterrichtsbeispiele
- 2.3 Zusammenfassung
- 2.1 Geschlechterdifferenzen in der Schule
- 3 Wege zu mehr Geschlechtergleichheit
- 3.1 Geschlechtersensible Schule
- 3.1.1 Herausforderung für die Lehrkräfte
- 3.1.2 Chancen und Blockaden zur geschlechtersensiblen Schulkultur
- 3.2 Zusammenfassung
- 3.1 Geschlechtersensible Schule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen „Doing Gender“ im Kontext der Grundschule. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Lehrkräfte unbewusst zur Konstruktion von Geschlecht im schulischen Alltag beitragen und welche Rolle Geschlechterdifferenzen in Leistungen und Interaktionen spielen. Die Arbeit beleuchtet zudem Wege zu mehr Geschlechtergleichheit durch eine geschlechtersensible Schulkultur.
- Doing Gender in der Grundschule
- Geschlechterdifferenzen in Schulleistungen und Interaktionen
- Einfluss von Lehrkräften auf die Konstruktion von Geschlecht
- Geschlechtersensible Schulkultur
- Herausforderungen und Chancen für Lehrkräfte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik von Geschlechterrollen und deren Konstruktion im Alltag ein. Sie betont die Bedeutung von „Doing Gender“ und dessen Relevanz für die Institution Schule. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Lehrkräfte bei der Gestaltung des schulischen Alltags und der knapp gehaltenen Forschung zu diesem Thema. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die einzelnen Kapitel.
1 Einführung: Geschlechtertheoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es definiert die Begriffe „Gender“ und „Doing Gender“, wobei „Gender“ als sozial konstruiertes Geschlecht und „Doing Gender“ als der Prozess der alltäglichen Herstellung von Geschlecht in Interaktionen verstanden wird. Die Kapitel erläutert die Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht (Sex) und sozialem Geschlecht (Gender) und beleuchtet die Rolle von gesellschaftlichen Normen und institutionellen Regelungen bei der Konstruktion von Geschlecht.
2 Gender in der Grundschule: Dieses Kapitel untersucht „Doing Gender“ in der Grundschule. Es beleuchtet zunächst Geschlechterdifferenzen in Schulleistungen und Interaktionen zwischen Schülern und Schülerinnen sowie mit Lehrkräften. Anhand von Unterrichtsbeispielen wird veranschaulicht, wie „Doing Gender“ im Schulalltag stattfindet. Der scheinbare Widerspruch zwischen formalem Gleichberechtigungsanspruch und tatsächlichen Geschlechterdifferenzen wird thematisiert.
3 Wege zu mehr Geschlechtergleichheit: Das Kapitel befasst sich mit dem Konzept der geschlechtersensiblen Schule. Es beschreibt die Herausforderungen für Lehrkräfte, die Chancen und Blockaden für eine geschlechtergleiche Schulkultur. Es geht darum, wie Geschlechterdifferenzen und Stereotypisierungen durch eine bewusste Gestaltung des schulischen Umfelds vermieden werden können.
Schlüsselwörter
Doing Gender, Gender, Geschlechtergleichheit, Grundschule, Geschlechterdifferenzen, Schulkultur, Lehrkräfte, Geschlechterstereotype, geschlechtersensible Schule, soziale Konstruktion.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Doing Gender in der Grundschule
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht das Phänomen „Doing Gender“ im Kontext der Grundschule. Er analysiert, wie Lehrkräfte unbewusst zur Konstruktion von Geschlecht im schulischen Alltag beitragen und welche Rolle Geschlechterdifferenzen in Leistungen und Interaktionen spielen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Wegen zu mehr Geschlechtergleichheit durch eine geschlechtersensible Schulkultur.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind: Doing Gender in der Grundschule, Geschlechterdifferenzen in Schulleistungen und Interaktionen, der Einfluss von Lehrkräften auf die Konstruktion von Geschlecht, geschlechtersensible Schulkultur, Herausforderungen und Chancen für Lehrkräfte im Umgang mit Gender-Aspekten.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Der Text basiert auf geschlechtertheoretischen Grundlagen, insbesondere den Begriffen „Gender“ (als sozial konstruiertes Geschlecht) und „Doing Gender“ (als Prozess der alltäglichen Herstellung von Geschlecht in Interaktionen). Es wird die Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht (Sex) und sozialem Geschlecht (Gender) erläutert.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und ein Kapitel mit Schlüsselbegriffen und Zusammenfassung. Kapitel 1 legt die theoretischen Grundlagen dar. Kapitel 2 untersucht Doing Gender in der Grundschule anhand von Geschlechterdifferenzen in Leistungen und Interaktionen. Kapitel 3 befasst sich mit Wegen zu mehr Geschlechtergleichheit und der geschlechtersensiblen Schule.
Welche konkreten Beispiele werden im Text genannt?
Der Text verwendet Unterrichtsbeispiele, um zu veranschaulichen, wie „Doing Gender“ im Schulalltag stattfindet. Konkrete Beispiele werden im Kapitel „Gender in der Grundschule“ vorgestellt, um den scheinbaren Widerspruch zwischen formalem Gleichberechtigungsanspruch und tatsächlichen Geschlechterdifferenzen aufzuzeigen.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass Lehrkräfte eine wichtige Rolle bei der Konstruktion von Geschlecht im schulischen Alltag spielen. Er betont die Notwendigkeit einer geschlechtersensiblen Schulkultur, um Geschlechtergleichheit zu fördern und Geschlechterdifferenzen und Stereotypisierungen zu vermeiden.
Welche Herausforderungen werden für Lehrkräfte genannt?
Der Text benennt Herausforderungen für Lehrkräfte im Umgang mit Gender-Aspekten im Schulalltag. Es werden Chancen und Blockaden für eine geschlechtergleiche Schulkultur beleuchtet.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Doing Gender, Gender, Geschlechtergleichheit, Grundschule, Geschlechterdifferenzen, Schulkultur, Lehrkräfte, Geschlechterstereotype, geschlechtersensible Schule, soziale Konstruktion.
Für wen ist der Text bestimmt?
Der Text richtet sich an Personen, die sich mit Gender-Aspekten in der Bildung auseinandersetzen möchten, insbesondere an Lehrkräfte, Studierende der Pädagogik und Wissenschaftler*innen im Bereich Gender Studies.
Wo kann ich den vollständigen Text finden?
Der vollständige Text ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieser Auszug dient lediglich als Übersicht.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2011, Doing Gender. Soziale Konstruktion von Geschlecht in der Schule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285614