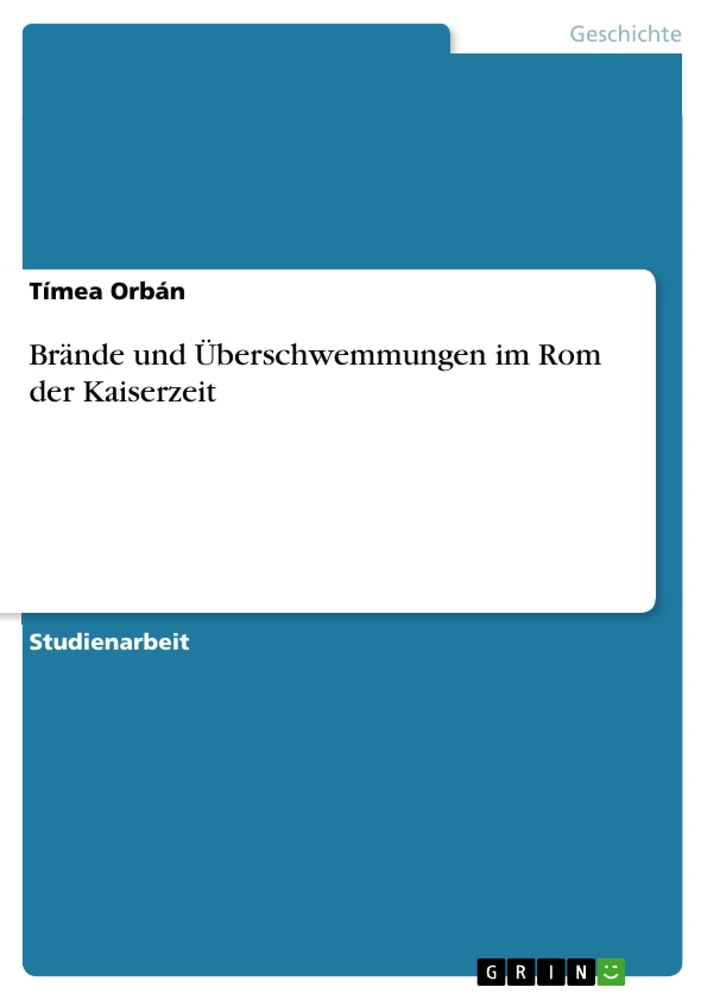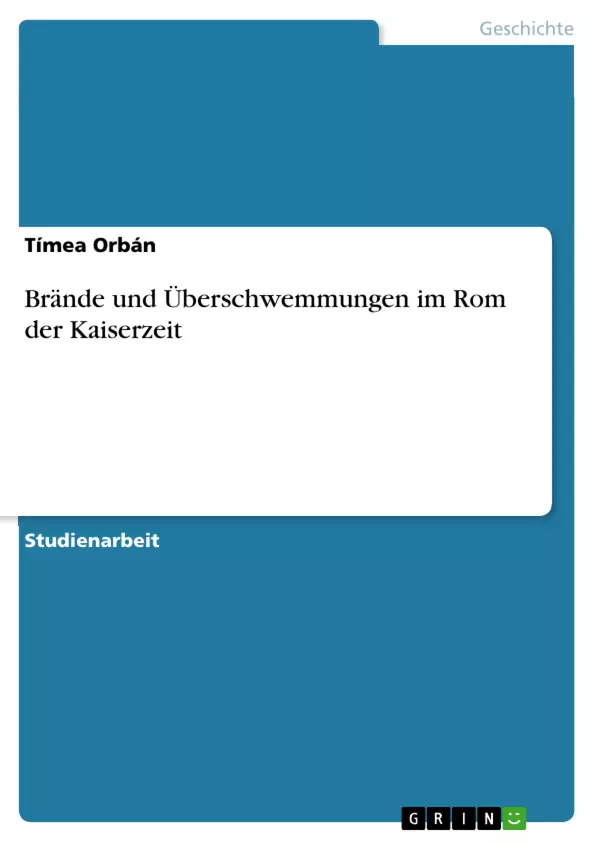Brände und Überschwemmungen werden von den antiken Autoren wie Seneca, Tacitus und Juvenal zu den ganz alltäglichen Gefahren in der Großstadt Rom zugeordnet. Diese zwei Schicksalsschläge stellen bloß einen Teil von den insgesamt vorhandenen Risikofaktoren dar. Der soziale Stress in Rom hatte weitere vielseitige Quellen wie Menschengewühl, Krach, ständige Lebensgefahr (beim Achsenbruch von Lastfuhrwerken kam es schnell zu tödlichen Verletzungen, Müll und Nachttöpfe werden einfach aus den Fenstern geworfen), Kriminalität, Luftverschmutzung, schlechte Wohnqualität und regelmässige Hauseinstürze.
Besonders die Häufigkeit von Bränden und Hauseinstürzen scheint erstaunlich hoch gewesen zu sein. Es sollen jeden Tag mehrere kleinere Brände in der Stadt ausgebrochen sein. Es wurden sogar immer wieder größere Stadtteile und Viertel in Asche verwandelt.
Der Tiber überstieg in regelmäßigen Abständen seine Ufer und flutete große Teile der Stadt. Gegen seine Flutwellen schienen sich die Römer nicht wehren zu können oder zu wollen.
In der vorliegenden Arbeit soll versucht werden, Deutungs- und Wahrnehmungsmuster der römischen Bevölkerung zu den Brand- und Überschwemmungkatastrophen anhand von Primärquellen zu entschlüsseln. Die Erwartung ist, dass aufgezeigt werden kann, dass unterschiedliche soziale Schichten von den Folgen verschieden betroffen waren. Es muss danach gefragt werden, ob dem jeweiligen Kaiser die Katastrophenbewältigung als Mittel der Machtsicherung und der Popularitätszunahme hätte dienen können. Es wird danach beobachtet, ob es Gruppen gab, denen die Vernichtung von Wohnhäusern und Stadtvierteln sogar zugute kam. War eine Art Solidarität schon in der römischen Gesellschaft der Kaiserzeit vorhanden, die heutzutage nach Naturkatastrophen als typische Erscheinung auftaucht? War das Verhalten von den Betroffenen einheitlich?
Inwiefern war das Großstadtleben – wie wir es in unserer Zeit auch kennen – selbst verantwortlich für die Brände? Um diese Frage beantworten zu können, muss man auf die Ursachen von Feuersbrünsten einen Blick werfen. Interessant ist ausserdem, wieso die präventiven Maßnahmen wenig zur Steigerung der Lebensqualität beitragen konnten. Aus heutiger Sicht ist der Verzicht auf die Verteidigung der Stadt gegen die Überschwemmungen merkwürdig. (...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in das Thema, Fragestellungen und mögliche Thesen
- Quellenlage und Forschungsstand
- Gründe
- Brände in Rom
- Überschwemmungen des Tibers
- Folgen (und Ablauf)
- Fallbeispiel Brand Roms in 64 n. Chr. unter Nero
- Ablauf
- Folgen
- Fallbeispiel Hochwasser in 15 n. Chr. unter Tiberius
- Präventive Maßnahmen
- Brandschutz
- Hochwasserschutz
- Die römische Gesellschaft im Spiegel der Brand- und Überschwemmungskatastrophen
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Wahrnehmung, Deutung und sozialen Auswirkungen von Brand- und Überschwemmungskatastrophen im antiken Rom während der Kaiserzeit. Ziel ist es, anhand von Primärquellen die Reaktionen der römischen Bevölkerung auf diese Ereignisse zu analysieren und zu untersuchen, inwiefern die verschiedenen sozialen Schichten von den Folgen betroffen waren. Darüber hinaus wird untersucht, ob die Kaiser die Katastrophenbewältigung als Mittel zur Machtsicherung und Popularitätszunahme nutzten, und ob es Gruppen gab, die von der Zerstörung von Wohnhäusern und Stadtvierteln profitierten.
- Wahrnehmungs- und Deutungsmuster der römischen Bevölkerung gegenüber Brand- und Überschwemmungskatastrophen
- Soziale Auswirkungen von Katastrophen auf verschiedene Schichten der römischen Gesellschaft
- Rolle des Kaisers bei der Katastrophenbewältigung und Machtsicherung
- Mögliche Nutzung von Katastrophen durch bestimmte Gruppen
- Solidarität und Verhaltensmuster der Betroffenen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Fragestellungen sowie mögliche Thesen der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Quellenlage und den Forschungsstand zum Thema Brand- und Überschwemmungskatastrophen im antiken Rom. Die Kapitel "Gründe" und "Folgen (und Ablauf)" befassen sich mit den Ursachen und Folgen der Katastrophen und präsentieren anhand von Fallbeispielen die Auswirkungen von Bränden und Überschwemmungen auf die Stadt Rom. Im Kapitel "Präventive Maßnahmen" werden die Maßnahmen zum Brand- und Hochwasserschutz in Rom untersucht. Schließlich beleuchtet das Kapitel "Die römische Gesellschaft im Spiegel der Brand- und Überschwemmungskatastrophen" die sozialen Aspekte der Katastrophen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft im antiken Rom.
Schlüsselwörter
Brand- und Überschwemmungskatastrophen, antikes Rom, Kaiserzeit, Wahrnehmung, Deutung, soziale Auswirkungen, Kaiser, Machtsicherung, Solidarität, Quellenlage, Forschungsstand, Fallbeispiele, Präventive Maßnahmen, Hochwasserschutz, Brandschutz.
Häufig gestellte Fragen
Wie häufig waren Brände im antiken Rom?
Brände gehörten zum Alltag. Es wird berichtet, dass täglich mehrere kleinere Feuer ausbrachen und regelmäßig ganze Stadtviertel durch Großbrände vernichtet wurden.
Warum war Rom so anfällig für Feuersbrünste?
Die dichte Bebauung, die Verwendung brennbarer Materialien (Holz), offene Feuerstellen zum Kochen und Heizen sowie die Höhe der Mietshäuser (Insulae) begünstigten die schnelle Ausbreitung von Flammen.
Welche Auswirkungen hatten die Tiber-Überschwemmungen?
Der Tiber trat regelmäßig über die Ufer und flutete tiefergelegene Stadtteile, was zu Gebäudeschäden, Krankheiten und Nahrungsmittelknappheit führte.
Nutzen Kaiser Katastrophen für ihre Machtpolitik?
Ja, die Katastrophenbewältigung durch Getreidespenden oder Wiederaufbauprogramme war ein wichtiges Mittel zur Sicherung der Popularität und Machtsicherung (z.B. unter Nero oder Tiberius).
Gab es im antiken Rom Brandschutzmaßnahmen?
Unter Augustus wurde die „Vigiles“ (Feuerwehr) gegründet. Zudem gab es Bauvorschriften zur Begrenzung der Hausshöhen und zum Abstand zwischen Gebäuden.
- Citar trabajo
- Tímea Orbán (Autor), 2013, Brände und Überschwemmungen im Rom der Kaiserzeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285617