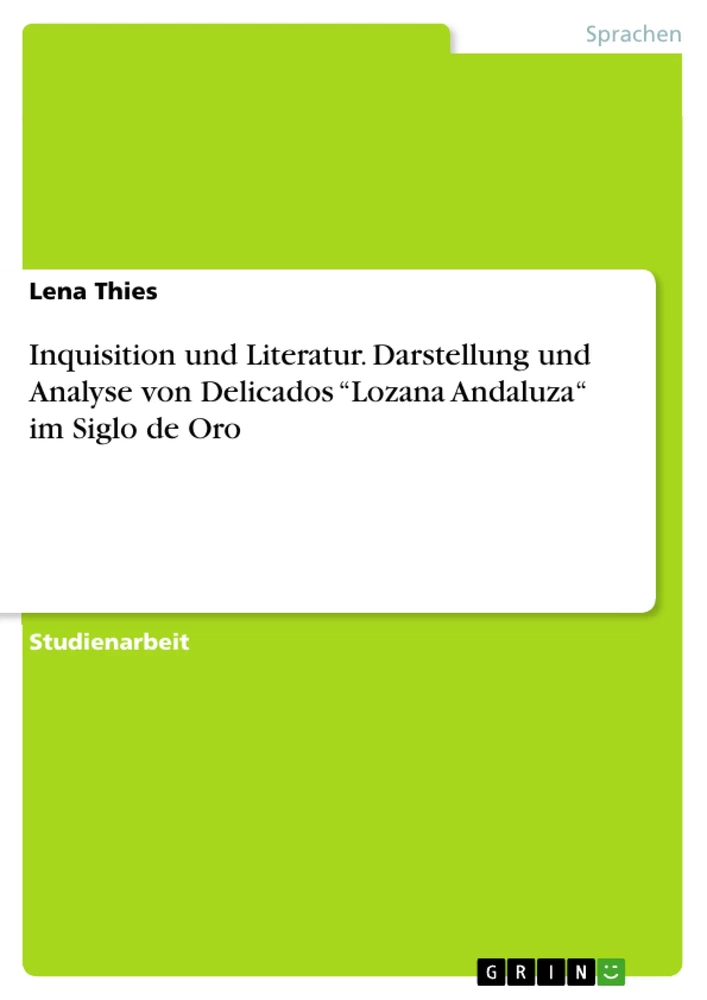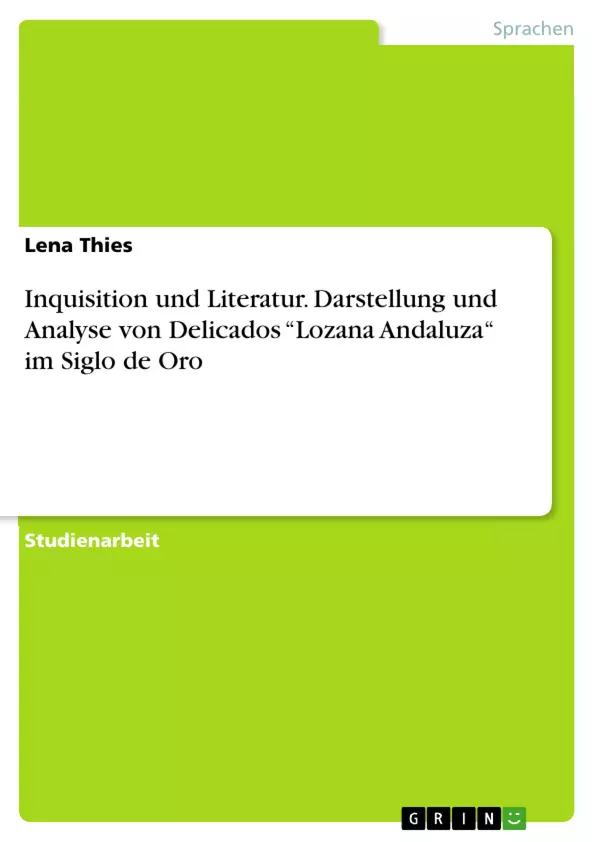Im Rahmen des Hauptseminars „Spanische Mythen VI: Inquisition und Literatur“ habe ich mich dem Werk “La Lozana Andaluza“ von Francisco Delicado gewidmet und es im Hinblick darauf untersucht, warum es in Spanien des 16. Jahrhunderts unter der Inquisition nicht erscheinen konnte. Zentrale Fragestellung ist hierbei, welche Gründe es gegeben haben könnte, dass “La Lozana Andaluza“ zwar in Italien, aber nicht in Delicados Heimatland Spanien veröffentlicht wurde.
Im ersten Teil dieser Arbeit gebe ich zunächst eine kurze Übersicht über die Inquisition in Spanien und die damit einhergehende Problematik bezüglich Literatur. Der zweite Teil bietet eine kurze Zusammenfassung der zentralen Handlung sowie Informationen zur Entstehung des Werks, welches der Bibliothek der erotischen Weltliteratur zugeschrieben wird. Einhergehend werden auch Interpretationsmöglichkeiten sowie interpretatorische Schwierigkeiten aufgezeigt, sowie relevante Informationen zum Autor und seiner Biografie betrachtet. Insbesondere dessen Rolle als Instanz innerhalb der Handlung stellt einen interessanten Aspekt dar. Weiterhin werden intertextuelle Bezüge angesprochen, die im Werk eine gewisse Rolle spielen. Darauf folgt der eigentliche Mittelpunkt der Arbeit, nämlich die Analyse des Werks im Hinblick auf die Problematik bezüglich der Inquisition zur damaligen Zeit in Spanien. Dabei werde ich mich auf die in meinen Augen wichtigsten und zentralsten Aspekte beschränken.
In einer abschließenden Bemerkung wird das zuvor Genannte zusammengefasst und bewertet. Es wird sich zeigen, dass “La Lozana Andaluza“ eine breite Angriffsfläche für die Inquisitoren des Siglo de Oro bot und es unter den genannten Gesichtspunkten durchaus nachvollziehbar ist, warum dieses literarisch sehr wertvolle Werk auf dem Index in Spanien landete. Darüber hinaus biete ich einen Ausblick auf weitere zu untersuchende Punkte im Zusammenhang mit dem hier behandelten Werk, die allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden und daher nur kurz angeschnitten werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die spanische Inquisition
- "La Lozana Andaluza“ – Entstehung und Handlung
- Die Entstehung des Werks
- Die Handlung
- Interpretation und interpretatorische Schwierigkeiten
- Die Rolle des Autors
- Intertextuelle Bezüge
- Delicados Werk und die spanische Inquisition
- Abschließende Bemerkungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Francisco Delicados "La Lozana Andaluza" im Kontext der spanischen Inquisition des 16. Jahrhunderts. Sie untersucht, warum das Werk in Italien veröffentlicht wurde, aber nicht in Spanien erscheinen konnte.
- Die spanische Inquisition und ihre Auswirkungen auf Literatur
- Die Entstehung und Handlung von "La Lozana Andaluza"
- Interpretationsmöglichkeiten und Schwierigkeiten des Werks
- Die Rolle des Autors Francisco Delicado
- Die Beziehung zwischen Delicados Werk und der spanischen Inquisition
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die zentrale Fragestellung dar: Warum konnte "La Lozana Andaluza" in Italien, aber nicht in Spanien veröffentlicht werden?
Das Kapitel "Die spanische Inquisition" bietet einen kurzen Überblick über die Inquisition in Spanien und ihre Auswirkungen auf Literatur. Es beleuchtet die historische Entwicklung der Inquisition und ihre Rolle als Kontrollinstrument der Regierung.
Das Kapitel "La Lozana Andaluza" – Entstehung und Handlung" fasst die Handlung des Werks zusammen und beleuchtet die Entstehung des Romans. Es werden Interpretationsmöglichkeiten und Schwierigkeiten des Werks sowie relevante Informationen zum Autor und seiner Biografie betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die spanische Inquisition, "La Lozana Andaluza", Francisco Delicado, Literatur im Siglo de Oro, Zensur, Erotik, Intertextualität, Konverso, und die Rolle des Autors. Die Arbeit analysiert die Gründe, warum Delicados Werk in Spanien verboten wurde und beleuchtet die Auswirkungen der Inquisition auf die Literaturproduktion der Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Werk "La Lozana Andaluza"?
Es ist ein Werk von Francisco Delicado, das der erotischen Weltliteratur zugeschrieben wird und das Leben einer andalusischen Kurtisane im Rom des 16. Jahrhunderts beschreibt.
Warum wurde das Buch in Spanien verboten?
Aufgrund der strengen Zensur der spanischen Inquisition im Siglo de Oro landete das Werk wegen seiner erotischen Inhalte und gesellschaftskritischen Töne auf dem Index.
Warum konnte es in Italien erscheinen, aber nicht in Spanien?
Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen religiösen und politischen Kontrollmechanismen; Italien bot zur damaligen Zeit ein liberaleres Umfeld für die Veröffentlichung solcher Literatur.
Welche Rolle spielt der Autor Francisco Delicado selbst im Werk?
Interessanterweise tritt der Autor als Instanz innerhalb der Handlung auf, was die interpretatorische Komplexität des Romans erhöht.
Was ist ein "Konverso" im Kontext dieser Arbeit?
Der Begriff bezieht sich auf zum Christentum konvertierte Juden, eine Gruppe, die unter der spanischen Inquisition besonders unter Beobachtung stand, was auch für den Autor relevant war.
- Quote paper
- Lena Thies (Author), 2014, Inquisition und Literatur. Darstellung und Analyse von Delicados “Lozana Andaluza“ im Siglo de Oro, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285794