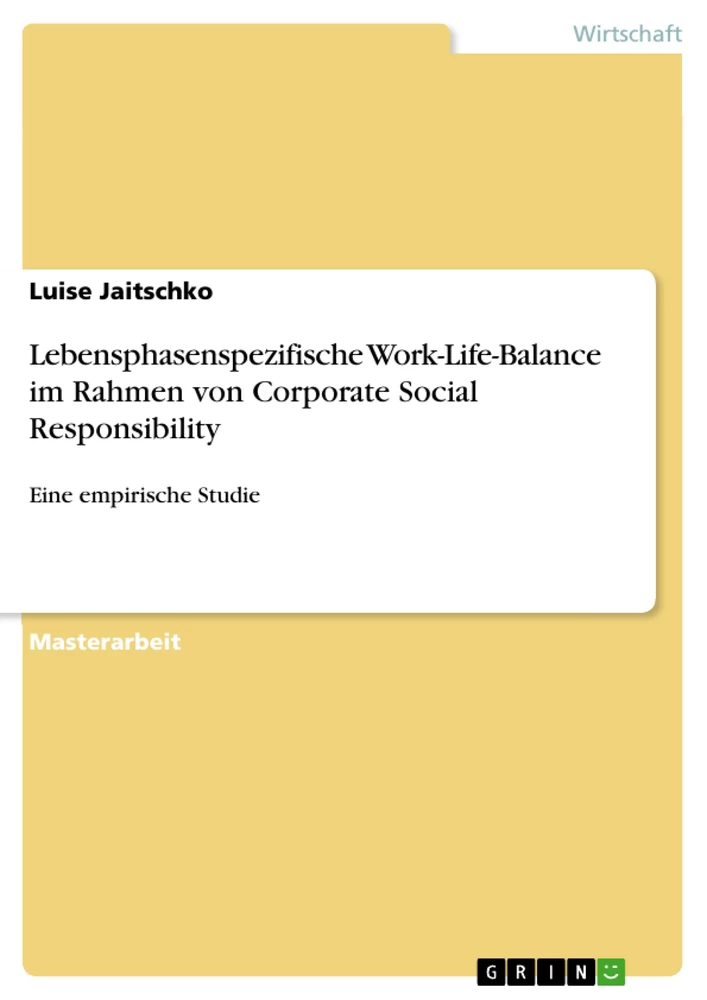Ungebremst rasen wir in eine High-Speed-Gesellschaft: „Rasch agieren anstelle langsam reagieren“ so lautet die akzeptierte Leitlinie des wirtschaftlichen Geschehens in unserer Zeit. Die Unternehmen wollen je nach wirtschaftlicher Lage „atmen“, wir sollen uns daran anpassen. Wir haben flexibel zu sein, am besten seien wir doch Tag und Nacht erreichbar: 24 Stunden, 7 Tage die Woche!
Diese hohe Anforderung führt nicht nur zu einer dauernden beruflichen Belastung, sondern auch zu einer zunehmend verschwimmenden Abgrenzung von Arbeitswelt und Privatleben. Wann ist etwas Arbeitstätigkeit, wann ist etwas Privatleben? Die ehemals festgelegten Rollen gehen – wie es manchmal scheint und oft gefordert wird - Schritt für Schritt ineinander über. Diese Vorgaben haben Folgen für die meisten der Erwerbstätigen, vor allem wenn sie sich zu bestimmten Zeiten ihres Lebens weiterbilden oder etwa eine Familie gründen wollen.
Die vorliegende Masterthesis setzt sich mit einigen spezifischen Lebensphasen der Gesellschaft auseinander und erörtert, welche eventuellen betrieblichen und privaten Empfehlungen im Zusammenhang mit einem angepassten Gesundheitsmanagement getroffen werden können. Es wird untersucht, in wie weit betriebliche Maßnahmen zur Förderung einer Work-Life-Balance in der heutigen Arbeitswelt beitragen und welche Auswirkungen diese eventuell auf das Wohlbefinden der AkteurInnen haben.
Der Begriff „Work-Life-Balance“ wird von einigen kritisiert und als „schillernd und wenig präzise“ (vgl. Bornewasser/Zülch 2013: 199) angesehen, die Verfasserin dieser Arbeit sieht es aber als nicht richtig an, das Modell als Ganzes aufzugeben. Anzustreben wäre vielmehr, es aus seiner „individualistischen Verengung“ (ebd.) herauszuholen. Dies war auch ein wesentlicher Grund, die unternehmerische Seite mittels der Konzepte betriebliches Gesundheitsmanagement und Corporate Social Responsibility in das Forschungsvorhaben mit einzubeziehen.
Zwei Forschungsfragen wurden daher gestellt. Sie bezogen sich auf 1. die gegenwärtige Situation des Verhältnisses zwischen Arbeitswelt und Privatleben und wie dieses Verhältnis durch die Unternehmen oder den Einzelnen gestaltet wird und das betriebliche Gesundheitsmanagement und gehandhabter Inhalte des Corporate Social Responsibility der Unternehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Fragestellung und Vorgehensweise
- 2.1. Ausgangssituation
- 2.2. Forschungsfragen
- 2.3. Hypothese
- 2.4 Operationalisierung
- 3. Begriffe und Modelle
- 3.1. Work: Gegenwärtige Arbeit
- 3.1.1. Die Globalisierung
- 3.1.2. Das Anforderungsprofil seitens der Wirtschaft
- 3.2. Life: Lebensphasen
- 3.2.1. Die demographische Entwicklung
- 3.2.2. Die Veränderung des Familienbildes
- 3.2.3. Das gegenwärtige Bild
- 3.3. Work-Life-Balance
- 3.3.1. Die Themengebiete von Work-Life-Balance
- 3.3.2. Das Zeit-Balance-Modell
- 3.3.3. Die fünf Säulen der Identität
- 3.3.4. Das dynamische Work-Life-Balance-Modell
- 3.3.5. Das Modell nach Philipp Mayring
- 3.3.6. Aktuelle Entwicklung der Work-Life-Balance
- 3.3.7. Zusammenfassung, Kritik und Diskussion der verschiedenen Modelle
- 3.4. Betriebliches Gesundheitsmanagement
- 3.5. Corporate Social Responsibility (CSR)
- 3.5.1 Gewählte Definitionen von Corporate Social Responsibility
- 3.5.2 Erkorene Modelle von Corporate Social Responsibility
- 3.5.2.1 Die CSR-Pyramide nach Carroll
- 3.5.2.2 Three-Domain Approach
- 3.5.2.3 Das Stakeholderkonzept
- 3.5.3 Zusammenfassung, Kritik und Diskussionen der verschiedenen Modelle
- 3.5.4 CSR in Österreich
- 4. Analysemethode
- 4.1. Quantitative Analyse
- 4.2. Qualitative Analyse
- 5. Ergebnisse
- 5.1. Datenentstehung
- 5.2. Demographische Beschreibung
- 5.2.1. Vergleich Stichprobe zur Grundgesamtheit
- 5.2.2. Das Verhältnis von Abgebrochenen zu Abgeschlossen
- 5.3. Das Verhältnis von Arbeit zum Privatleben
- 5.3.1. Veränderung des Verhältnisses
- 5.3.2. Zusätzliche Aufgliederungen zu den Veränderungen
- 5.3.3. Private Gründe für Veränderungen
- 5.3.4. Arbeitsbezogene Gründe für Veränderungen
- 6. Diskussion
- 7. Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Work-Life-Balance in verschiedenen Lebensphasen im Kontext von Corporate Social Responsibility (CSR). Die Arbeit basiert auf einer empirischen Studie, die mittels einer Online-Befragung in Ostösterreich durchgeführt wurde. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen der Work-Life-Balance in unterschiedlichen Lebensphasen zu beleuchten und den Einfluss von CSR-Maßnahmen auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu analysieren.
- Work-Life-Balance in verschiedenen Lebensphasen
- Einfluss von CSR auf die Work-Life-Balance
- Herausforderungen und Chancen der Work-Life-Balance
- Empirische Analyse der Work-Life-Balance in Ostösterreich
- Bedeutung von betrieblichem Gesundheitsmanagement für die Work-Life-Balance
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Work-Life-Balance im Kontext von CSR ein und stellt die Forschungsfragen und die Hypothese der Arbeit vor. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Work-Life-Balance und CSR, wobei verschiedene Modelle und Definitionen vorgestellt und diskutiert werden. Kapitel 3 beschreibt die Analysemethode der Arbeit, die sowohl quantitative als auch qualitative Elemente beinhaltet. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der empirischen Studie, die auf einer Online-Befragung in Ostösterreich basiert. Die Ergebnisse werden anhand verschiedener demographischer Merkmale und Lebensphasen analysiert. Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse der Studie im Kontext der theoretischen Grundlagen und beleuchtet die Implikationen für die Praxis. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Work-Life-Balance, Corporate Social Responsibility (CSR), Lebensphasen, Betriebliches Gesundheitsmanagement, empirische Forschung, Online-Befragung, Ostösterreich, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Herausforderungen und Chancen, demographische Entwicklung, Familienbild, Globalisierung, Anforderungsprofil, Stakeholderkonzept, CSR-Pyramide, Three-Domain Approach, Zeit-Balance-Modell, dynamische Work-Life-Balance, Modell nach Philipp Mayring.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Work-Life-Balance und CSR zusammen?
Corporate Social Responsibility (CSR) umfasst die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Die Förderung der Work-Life-Balance ist ein Teilbereich davon, um das Wohlbefinden der Mitarbeiter in verschiedenen Lebensphasen zu sichern.
Was ist das "Zeit-Balance-Modell"?
Es ist ein Modell zur Analyse der Zeitverteilung zwischen Erwerbsarbeit und anderen Lebensbereichen wie Familie, Freizeit und Gesundheit.
Welche Auswirkungen hat die Globalisierung auf die Work-Life-Balance?
Die Globalisierung führt zu einem erhöhten Anforderungsprofil, ständiger Erreichbarkeit (24/7-Gesellschaft) und einer verschwimmenden Grenze zwischen Arbeitswelt und Privatleben.
Was besagt die CSR-Pyramide nach Carroll?
Das Modell unterteilt unternehmerische Verantwortung in vier Ebenen: ökonomische, rechtliche, ethische und philanthropische Verantwortung.
Warum ist lebensphasenspezifische Förderung wichtig?
Bedürfnisse ändern sich je nach Lebensphase, etwa bei der Familiengründung, Weiterbildung oder im Alter. Unternehmen müssen ihre Maßnahmen (z. B. Gesundheitsmanagement) flexibel an diese Phasen anpassen.
- 3.1. Work: Gegenwärtige Arbeit
- Quote paper
- Luise Jaitschko (Author), 2014, Lebensphasenspezifische Work-Life-Balance im Rahmen von Corporate Social Responsibility, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285886