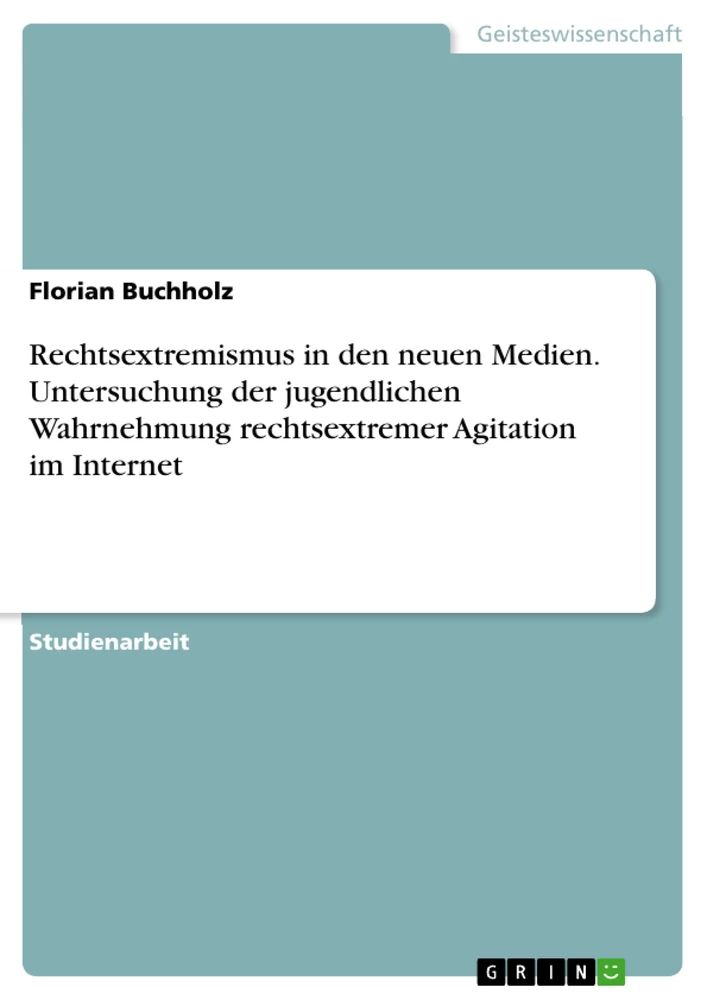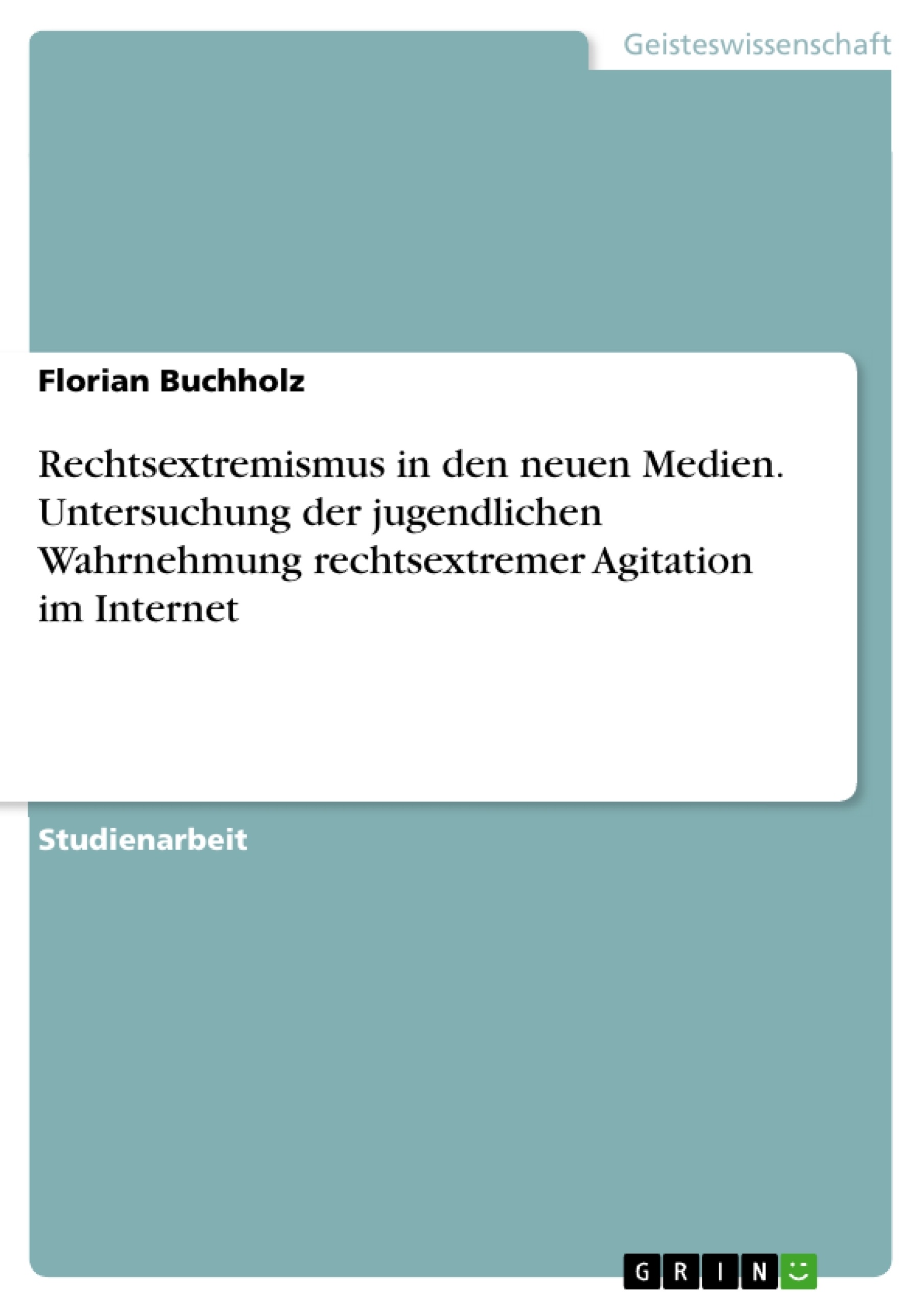Jugendliche und junge Erwachsene stellen seit jeher eine wichtige und attraktive Zielgruppe für die Verbreitung rechtsextremer und menschenfeindlicher Inhalte dar: Sie gelten als weniger resistent gegenüber rechtsextremer Agitation als Erwachsene, da sie in ihrer politischen Meinung oftmals noch nicht gefestigt sind und über ein großes Aktionspotenzial verfügen. Rechtsextreme Parteien, Vereine und auch Einzelpersonen verbreiten daher oftmals einschlägige Inhalte zeitgemäß und auf Jugendliche zugeschnitten. Eine klassische Strategie von Neonazis ist es, Tonträger mitnationalistischen und ausländerfeindlichen Musikstücken auf Schulhöfen und an Jugendtreffpunkten zu verteilen. Mit einem stetigen Wandel der Mediennutzung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ändern sich auch die Strategien der Verbreitung von rechtsextremen Inhalten. Als Medium der Kommunikation, des Austausches und der Informationsbeschaffung ist das Internet für viele Jugendliche nicht mehr wegzudenken. In der Freizeitgestaltung von Jugendlichen nimmt das Internet, nach dem Konsum von Musik, einen hohen Stellenwert ein.Deshalb wird das Internet auch zunehmend wichtiger, als Rekrutierungsbasis für rechtsextreme Strömungen und Gruppierungen. Die Verbreitungsstrategien von rechtsextremen Inhalten werdenzunehmend und vielfältiger an die digitale Lebenswelt Jugendlicher angepasst. Zur internen Kommunikation verwenden rechtsextreme Gruppierungen eher geschlossene Foren und Kommunikationsnetzwerke.4 Demgegenüber ermöglichen bei Jugendlichen beliebte sozialeNetzwerke im Internet, wie Facebook, Twitter, Youtube und Co, jedem, seine Meinung zu aktuellen Themen an viele Menschen auf einmal zu verbreiten und auf andere Einträge zu antworten. Zudem beeinflusst die Anonymität im Netz die Hemmschwelle Parolen und Einstellungen kundzutun, die in der Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht geäußert würden. Die für die Nutzer der sozialen Netzwerke im Internet offensichtlichen Vorteile wurden auch von rechtsextremen Agitatoren erkannt.
Inhaltsverzeichnis:
Thema: Seitenzahl:
1. Thema
2. Theorie
2.1 Begriffsdefinition Rechtsextremismus
2.2 Trends rechtsextremer Internetnutzung
2.3 Ausgewählte Gruppierungen und Strategien
2.4 Internetnutzung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
2.5 Hypothesen
3. Untersuchung
3.1. Operationalisierung
3.1.1. Items
3.1.2. Erhebung
3.1.3. Stichprobe
3.2. Auswertung
3.2.1. Rechtsextreme und menschenfeindliche Aussagen im Netz
3.2.2. Plattformen
3.2.3. Selbsteinschätzung im Erkennen rechtsextremer Inhalte
3.2.4. Politische Zuordnung von Symbolen
3.2.5 Selbsteinschätzung und tatsächliches Erkennen von Symbolen
4. Diskussion
5. Resümee
6. Erfahrungsbericht Lehrforschung
7. Literaturverzeichnis
8. Webseiten
9. Anhang
Häufig gestellte Fragen
Warum nutzen Rechtsextreme das Internet für ihre Agitation?
Das Internet ermöglicht eine anonyme, kostengünstige und schnelle Verbreitung von Inhalten direkt in die digitale Lebenswelt von Jugendlichen.
Warum sind Jugendliche besonders anfällig für rechtsextreme Inhalte?
Jugendliche sind in ihrer politischen Meinung oft noch nicht gefestigt und verfügen über ein großes Aktionspotenzial, was sie für Rekrutierungsversuche attraktiv macht.
Welche Rolle spielen soziale Netzwerke wie Facebook und YouTube?
Diese Plattformen erlauben es Agitatoren, menschenfeindliche Parolen an viele Menschen gleichzeitig zu verbreiten und durch Interaktion Hemmschwellen abzubauen.
Können Jugendliche rechtsextreme Symbole im Netz sicher erkennen?
Die Untersuchung analysiert die Selbsteinschätzung gegenüber dem tatsächlichen Erkennen von Symbolen und zeigt oft Diskrepanzen in der Wahrnehmung auf.
Was ist eine klassische Strategie der "Schulhof-Agitation"?
Eine bekannte Strategie ist das Verteilen von Tonträgern mit nationalistischer Musik an Schulen, die heute durch digitale Downloads und Playlists ergänzt wird.
- Arbeit zitieren
- Florian Buchholz (Autor:in), 2014, Rechtsextremismus in den neuen Medien. Untersuchung der jugendlichen Wahrnehmung rechtsextremer Agitation im Internet, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285958