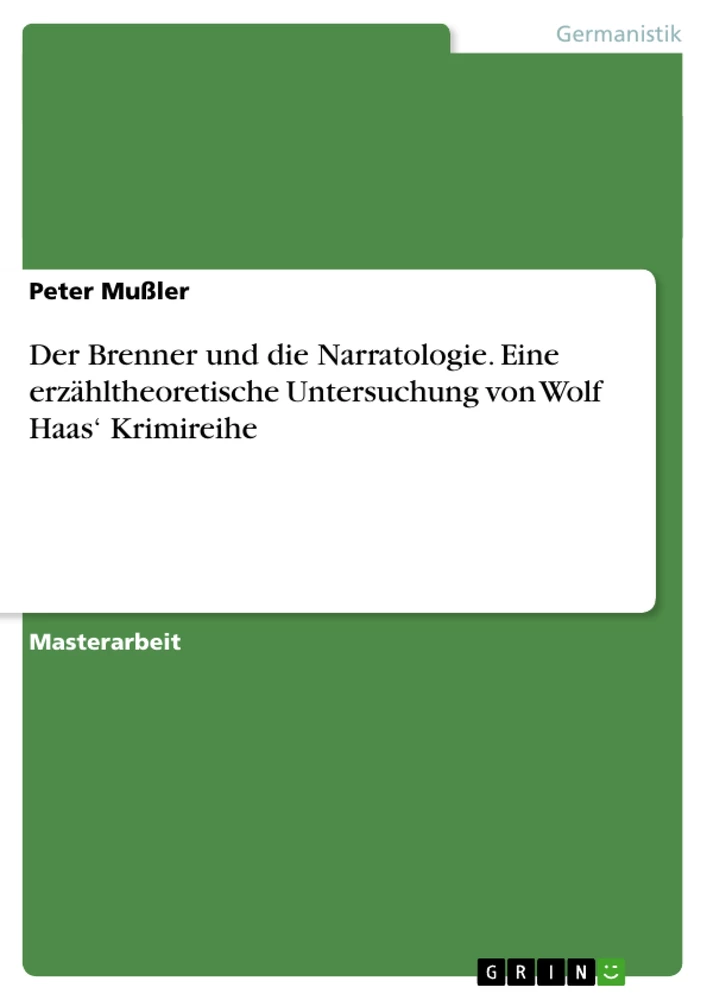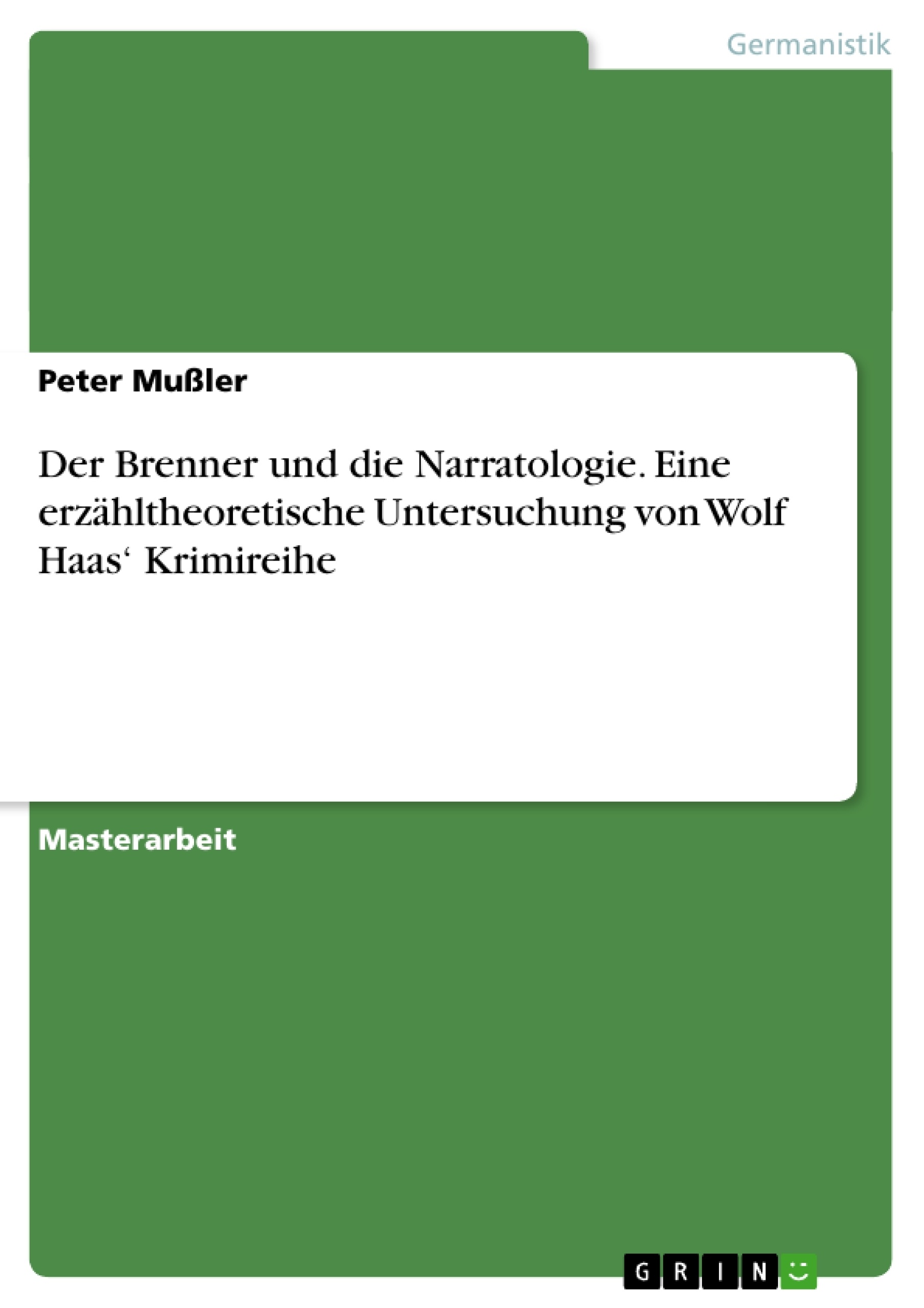Dieser Beitrag beschäftigt sich umfassend mit der Erzähltechnik der „Brenner“-Romane von Wolf Haas. Diese werden mit dem Instrumentarium einer auf Gérard Genette basierenden Systematik erzähltheoretisch analysiert. Auffallend ist dabei der omni- und überpräsente Erzähler im Zentrum der Erzählung, der sich und sein Erzählen oft der Handlung überordnet. Erst nur beobachtend, greift er später ins Geschehen ein, stirbt und ersteht wiederauf, womit die klare Unterscheidbarkeit zwischen homo-, hetero- und autodiegetischem Erzählen verneint und die für einen Erzähltext zwingende Trennung zwischen histoire und discours überwunden wird. Die Ubiquität des Erzählers und seine Allwissenheit sind unüblich für die Kriminalliteratur, ein maßvoller Umgang mit diesem Wissen unterminiert die Spannungserwartung jedoch nicht. Die Arbeit macht deutlich, dass die Verbindung zwischen Erzählung und Erzähltem stark fluktuiert: Sowohl die Kategorien Zeit, Modus als auch Stimme sind von großer Dynamik gekennzeichnet. Der Erzähler stellt sich nicht nur als äußerst präsent dar, sondern nimmt in seiner Wandelbarkeit auch außergewöhnlich starken Einfluss auf die Wirkung des Geschehens beim Publikum.
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Präambel: Premiere Hilfsausdruck
- 1 Einleitung: Von der Impression zur Kompression
- 2 Begriffe, Markierungen und Abkürzungen
- Forschungsstand und Methodik
- 4 Erzähler und Erzählen
- 4.1 Erzählsituation
- 4.1.1 Die Erzählung als Transskript mündlicher Kommunikation: Tradierte Mündlichkeit
- 4.1.2 Illusion der Echtzeit: Bruch mit echtem Erzählen
- 4.1.3 Der Erzähler: Zuhörer oder Zeuge?
- 4.1.4 Erzählreflexion im Text
- 4.1.5 Versuchte Grenzüberschreitung: Mediale Variation und Reflexion
- 4.1.6 Erzählerpräsenz in Zahlen
- 4.2 Modus
- 4.2.1 Distanz
- 4.2.1.1 Distanzminimierung durch Beschreibungsverzicht
- 4.2.1.2 Distanzvariation durch Tempowechsel
- 4.2.2 Perspektive - Fokalisierung: Wer sieht was wann von wo?
- 4.2.2.1 Auktoriales Krimi-Erzählen: sporadische Allwissenheit
- 4.2.2.2 Personales Krimi-Erzählen: Mitsicht nur beim Ermittler?
- 4.2.2.3 Neutrales Krimi-Erzählen: Außensicht des Lesers
- 4.2.2.4 Interaktives Krimi-Erzählen: Miteinbeziehung des Lesers
- 4.2.1 Distanz
- 4.3 Stimme & Stimmen: Textinterferenz polyphon und unisono
- 4.3.1 Serielle Mehrstimmigkeit: Textwechsel
- 4.3.1.1 Autointerferenz: Der Erzähler in doppelter Funktion
- 4.3.1.2 Interferenz invers: Erzählertext in der Figurenrede
- 4.3.1.3 Interferenz konventionell: Figuren sprechen durch den Erzähler
- 4.3.1.4 Interferenz extern: Lesertext in der Erzählerrede
- 4.3.2 Konstruierte Einstimmigkeit: Der Erzähler und seine Hauptfigur
- 4.1 Erzählsituation
- 5.1 Erzählung als Produkt des Erzählten: Spielart konkreter Poesie?
- 5.1.1 Peripheres Erzählen: Nebensächliches im Fokus
- 5.1.2 Induktives Erzählen: Aufwändiges Hinleiten
- 5.1.3 Oszillierendes Erzählen: Fokuswechsel
- 5.2.1 Analepsen: Vorgeschichte, Erinnerungen, Nachreichungen
- 5.2.2 Prolepsen: Andeutungen, Ankündigungen, Vorwegnahmen
- 5.2.3 Invertierung von Ursache und Wirkung: Spannung & Komik
- 9.1 Deutsch
- 9.2 Englisch (Abstract in English)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der erzähltheoretischen Analyse der Krimireihe von Wolf Haas, insbesondere mit der Figur des Ermittlers Simon Brenner. Ziel ist es, die spezifischen erzähltechnischen Merkmale der Reihe zu identifizieren und zu analysieren, um so ein tieferes Verständnis für die narrative Struktur und die erzählerische Gestaltung der Geschichten zu gewinnen.
- Die Rolle des Erzählers und seine Interaktion mit den Figuren
- Die Verwendung von Zeit und Raum in der Erzählung
- Die Bedeutung von Sprache und Humor in der Konstruktion der Geschichte
- Die Darstellung von Gewalt und Kriminalität in der Reihe
- Die Einbindung des Lesers in die narrative Konstruktion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Relevanz der erzähltheoretischen Analyse für die Untersuchung von Wolf Haas' Krimireihe. Sie stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor und skizziert den methodischen Ansatz.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Erzähler und dem Erzählen in Wolf Haas' Krimireihe. Es werden die verschiedenen Aspekte der Erzählsituation, des Modus und der Stimme analysiert, um die spezifischen Merkmale der Erzählweise zu identifizieren. Die Analyse zeigt, wie der Erzähler durch seine besondere Art des Erzählens die Geschichte prägt und den Leser in die narrative Konstruktion einbezieht.
Kapitel 5 untersucht weitere erzähltechnische Besonderheiten der Reihe, die als „Methode Brenner“ bezeichnet werden können. Es werden die spezifischen Merkmale des Erzählens in Bezug auf Zeit, Raum, Sprache und Humor analysiert. Die Analyse zeigt, wie diese Merkmale die narrative Struktur der Reihe prägen und den Leser in die Geschichte einbeziehen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die erzähltheoretische Analyse, die Krimireihe von Wolf Haas, die Figur Simon Brenner, Erzählsituation, Modus, Stimme, Zeit, Raum, Sprache, Humor, Gewalt, Kriminalität, Leserintegration.
- Citar trabajo
- B.A. Peter Mußler (Autor), 2014, Der Brenner und die Narratologie. Eine erzähltheoretische Untersuchung von Wolf Haas‘ Krimireihe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285994