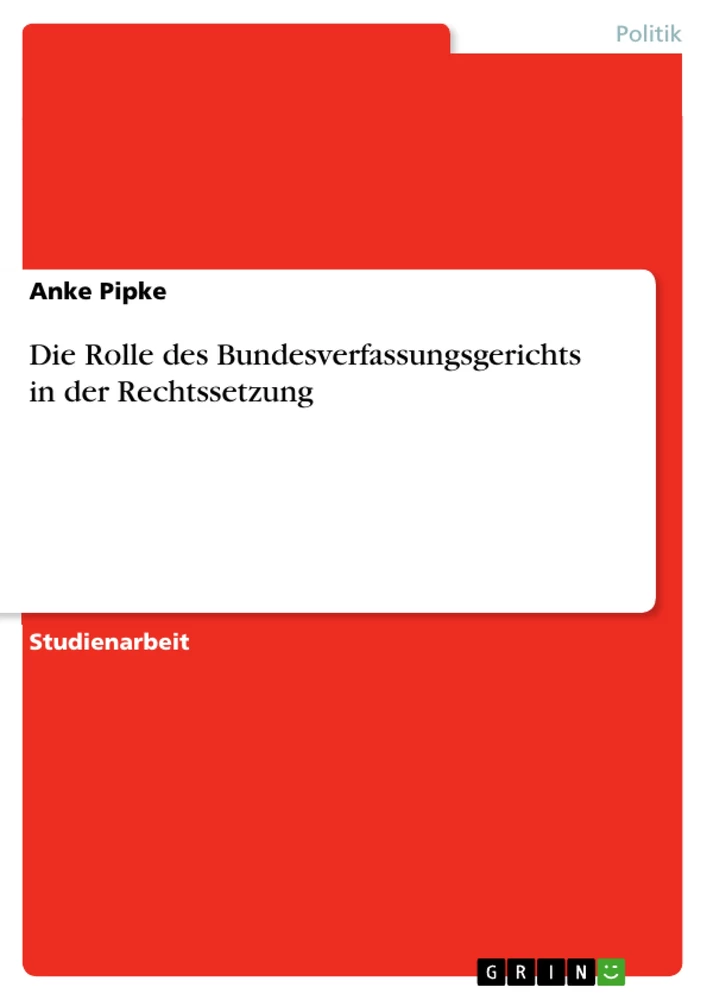I. EINLEITUNG
Das Bundesverfassungsgericht ist ein Verfassungsorgan im politischen System der BRD, das sich auf der Gratwanderung zwischen Recht und Politik bewegt. In Anbetracht dessen beschäftigt sich die vorliegende Arbeit schwerpunktmäßig mit der Einflussnahme
des Bundesverfassungsgerichtes auf die Rechtssetzung.
Zunächst setzt die Hausarbeit einen Akzent auf das Prinzip der richterlichen Selbstbeschränkung, auch „judicial self-restraint“ genannt. Dieses findet am amerikanische Supreme Court seinen Ausdruck in der „political question“-Doktrin. Warum diese Doktrin
nicht auch in der deutschen verfassungsgerichtsbarkeit ihren Platz finden könnte, wird im Folgenden die Fragestellung sein.
Im zweiten Kapitel wird die richterliche Selbstbeschränkung anhand von drei Beispielen dargelegt. Dabei geht die Verfasserin zunächst auf Urteile zum Parteiverbot, anschließend auf ein solches zu „out of area“-Einsätzen der Bundeswehr und zuletzt auf die Einwirkung des Bundesverfassungsgerichtes auf Grundrechte, und dabei insbesondere
auf Gleichheitssätze, ein. Damit stellt sich die unterschiedliche Zurückhaltungspraxis des Bundesverfassungsgerichtes auf der Ebene des Verfassungsschutzes, der Bundeswehr-Einsätze im Ausland und der Einfluss auf die Grundrechte dar. Inwieweit die Wirkung des Bundesverfassungsgerichtes bis auf die Ebene der EU reicht, wird nicht Inhalt dieser Argumentation sein, da eine solche Ausführung den Umfang der Arbeit bei Weitem sprengen würde.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Richterliche Selbstbeschränkung bzw. judicial self-restraint
- Was ist „richterliche Selbstbeschränkung“?
- Die „political question“-Doktrin in der Rechtssetzung des Supreme Court
- Die Diskussion um die Übernahme der „political question“-Doktrin in das politische System der Bundesrepublik Deutschland
- Zusammenfassung
- praktische Beispiele zur richterlichen Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichtes
- Das Bundesverfassungsgericht und das Parteiverbot
- Das Verbot der SRP 1952
- Das Verbot der KPD 1956
- Sind dies optimal geeignete Beispiele für „judicial self-restraint“?
- Zwischenergebnis
- Das Bundesverfassungsgericht und „out of area“-Einsätze der Bundeswehr
- Zwischenergebnis
- Das Bundesverfassungsgericht und Grundrechte
- Der Schutz der Gleichheit
- Zwischenergebnis
- Zusammenfassung
- Das Bundesverfassungsgericht und das Parteiverbot
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle des Bundesverfassungsgerichtes im deutschen politischen System und analysiert dessen Einflussnahme auf die Rechtssetzung. Dabei wird insbesondere auf das Prinzip der richterlichen Selbstbeschränkung, auch „judicial self-restraint“ genannt, fokussiert und die Frage gestellt, ob die „political question“-Doktrin, die im amerikanischen Supreme Court Anwendung findet, auch in der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit relevant sein könnte.
- Das Prinzip der „judicial self-restraint“ und dessen Bedeutung für die deutsche Verfassungsgerichtsbarkeit
- Die „political question“-Doktrin und deren Übertragbarkeit auf das deutsche Rechtssystem
- Die praktische Anwendung der richterlichen Zurückhaltung durch das Bundesverfassungsgericht anhand von Beispielen aus verschiedenen Bereichen des Rechts
- Die Rolle des Bundesverfassungsgerichtes im Bereich der Grundrechte, insbesondere in Bezug auf den Schutz der Gleichheit
- Die Grenzen der richterlichen Kontrolle und die Bedeutung der politischen Gestaltungsfreiheit von Regierung und Parlament
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Bundesverfassungsgericht als ein Verfassungsorgan im politischen System der Bundesrepublik Deutschland vor, das sich auf der Gratwanderung zwischen Recht und Politik bewegt. Sie skizziert die Schwerpunkte der Arbeit, die sich auf die Einflussnahme des Bundesverfassungsgerichtes auf die Rechtssetzung konzentrieren.
- Das zweite Kapitel behandelt das Prinzip der richterlichen Selbstbeschränkung, auch „judicial self-restraint“ genannt, und beleuchtet die „political question“-Doktrin, die im amerikanischen Supreme Court Anwendung findet. Die Frage nach der Übertragbarkeit dieser Doktrin auf das deutsche politische System steht im Vordergrund.
- Im dritten Kapitel werden konkrete Beispiele für die richterliche Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichtes in verschiedenen Bereichen des Rechts aufgezeigt. Dazu zählen Urteile zum Parteiverbot, zu „out of area“-Einsätzen der Bundeswehr und zur Einflussnahme auf Grundrechte, insbesondere auf Gleichheitssätze.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der richterlichen Selbstbeschränkung, der „political question“-Doktrin, der Rechtssetzung, dem Bundesverfassungsgericht, dem deutschen politischen System, dem Parteiverbot, „out of area“-Einsätzen der Bundeswehr, dem Schutz der Grundrechte, der Gleichheit, der verfassungskonformen Auslegung und der Gestaltungsfreiheit von Regierung und Parlament.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „richterlicher Selbstbeschränkung“?
Es ist das Prinzip, nach dem sich Gerichte (wie das Bundesverfassungsgericht) bei politischen Fragen zurückhalten, um die Gestaltungsfreiheit von Parlament und Regierung zu wahren.
Was ist die „political question“-Doktrin?
Eine im US-amerikanischen Recht (Supreme Court) verankerte Doktrin, die besagt, dass rein politische Fragen nicht von Gerichten entschieden werden sollten.
Wie verhält sich das Bundesverfassungsgericht bei Parteiverboten?
Die Arbeit untersucht historische Beispiele wie das SRP- (1952) und KPD-Verbot (1956) im Kontext der richterlichen Zurückhaltung.
Darf das Gericht über Auslandseinsätze der Bundeswehr entscheiden?
Das Bundesverfassungsgericht hat in Urteilen zu „out of area“-Einsätzen die Grenzen zwischen rechtlicher Kontrolle und politischer Entscheidungskompetenz definiert.
Welchen Einfluss hat das Gericht auf die Gleichheitssätze?
Das Gericht greift häufig korrigierend ein, wenn es um den Schutz der Grundrechte und die Wahrung der Gleichbehandlung durch den Gesetzgeber geht.
- Quote paper
- Anke Pipke (Author), 2000, Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts in der Rechtssetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286