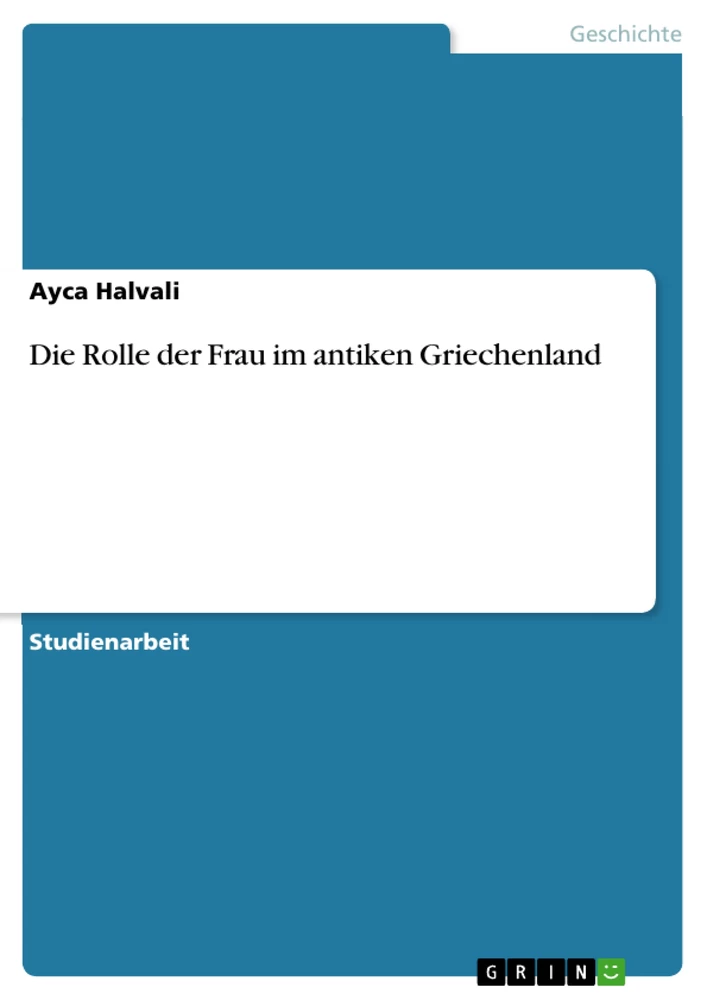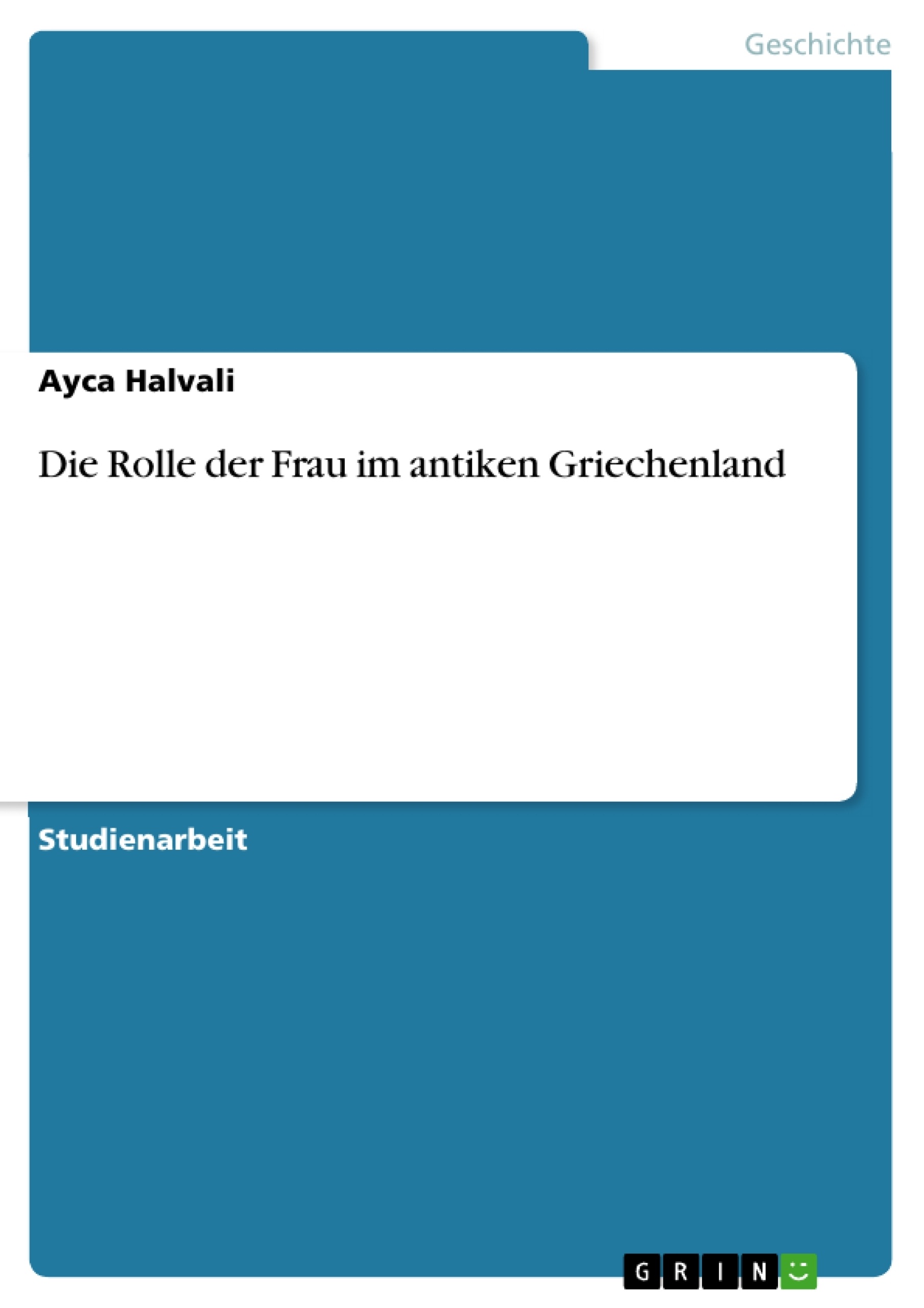Unter Einbeziehung der antiken Autoren und der neueren Forschung wird in der vorliegenden Arbeit untersucht, worin die Unterschiede der Rolle und Stellung der Frau im klassischen Griechenland zwischen den zwei Stadtstaaten Athen und Sparta lagen und wodurch diese begründet wurden. Um dies darzustellen, wird das Augenmerk auf zwei Aspekte des Frauenlebens gerichtet. Zum einen auf die Stellung der Frau im Oikos (Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft) in der jeweiligen Polis in Athen und zum anderen auf die Erziehung der Frau in Sparta.
Die folgende Arbeit ist in drei Teile unterteilt. Zunächst wird kurz das gesellschaftliche System Athens skizziert, um dann die Thematik des Lebens einer dort lebenden Frau aufzugreifen. In dem folgenden Teil wird das Leben der spartiatischen Frau nach eben beschriebener Vorgangsweise illustriert. Abschließend werden beide gesellschaftlichen Frauenrollen gegenübergestellt und eine Erklärung für diese gesellschaftlichen Entwicklungen aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Literarische Quellengrundlagen
- 3 Frauen in Athen
- 3.1 Politische und gesellschaftliche Ordnung Athens
- 3.2 Heirat und Eheleben
- 3.3 Ehebruch
- 3.4 Prostitution
- 4 Frauen in Sparta
- 4.1 Politische und gesellschaftliche Ordnung Spartas
- 4.2 Erziehung und Ausbildung
- 4.3 Heirat und Eheleben
- 5 Vergleich und Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede in der Rolle und Stellung von Frauen im klassischen Griechenland, speziell in Athen und Sparta. Sie konzentriert sich auf die Position der Frau innerhalb der Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft (Oikos) und auf die Erziehung der Frauen in Sparta. Die Analyse basiert auf antiken Autoren und moderner Forschung.
- Die politische und gesellschaftliche Ordnung Athens und Spartas
- Das Leben der Frauen im Oikos in Athen und Sparta
- Die Erziehung und Ausbildung von Frauen in Sparta
- Vergleich der Frauenrollen in Athen und Sparta
- Die Quellenlage und deren Herausforderungen für die Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die scheinbaren Widersprüche in der Stellung der Frauen im klassischen Griechenland dar: Mächtige Göttinnen im Gegensatz zur politischen Rechtlosigkeit sterblicher Frauen. Sie nennt als zentrale Quellen Xenophon, Aristoteles und Plutarch und verweist auf die besondere Quellenproblematik und die Aufarbeitung des Themas im 20. Jahrhundert, insbesondere im Kontext der Frauenbewegung. Die Arbeit konzentriert sich auf den Vergleich der Frauenrolle in Athen und Sparta, wobei der Oikos und die Erziehung in Sparta im Mittelpunkt stehen. Die Arbeit ist dreigeteilt: Skizzierung des athenischen Gesellschaftssystems, Darstellung des Lebens spartiatischer Frauen und abschließender Vergleich beider Rollen.
2 Literarische Quellengrundlagen: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Quellen zur Situation der Frau in Athen, darunter literarische Quellen wie Tragödien, Reden und Abhandlungen (vorwiegend von Männern verfasst) und nicht-literarische Quellen wie Vasen und Geschirr. Es wird betont, dass die Arbeit sich hauptsächlich auf literarische Quellen konzentriert, insbesondere auf die Schriften von Xenophon, Aristoteles und Plutarch. Die unterschiedlichen Perspektiven und die zeitliche Distanz (besonders bei Plutarch) werden als Quellenproblematik hervorgehoben. Xenophons Sparta-Bewunderung und Aristoteles' Kritik werden als gegensätzliche Positionen dargestellt, wodurch die zeitgenössischen Aussagen von Xenophon und Aristoteles (4. Jahrhundert v. Chr.) hervorgehoben werden.
3 Frauen in Athen: Dieses Kapitel beginnt mit einer Beschreibung der politischen und gesellschaftlichen Ordnung Athens im 5. bis 3. Jahrhundert v. Chr. – einer direkten Demokratie, die jedoch Frauen, Metöken und Sklaven ausschloss. Es werden die Institutionen der Volksversammlung (Eklesia), des Volksgerichts (Heliaia) und des Rates der 500 beschrieben und deren Funktionsweise erläutert. Der Ausschluss der Frauen wird als integraler Bestandteil des athenischen Systems dargestellt, der von den Athenern nicht als problematisch angesehen wurde. Die Kapitel 3.2, 3.3, und 3.4 (Heirat und Eheleben, Ehebruch, Prostitution) werden hier nicht separat zusammengefasst, da der Fokus auf dem Kapitel 3 als Ganzes liegt. Die Reformen von Solon und Kleisthenes und deren Auswirkungen auf die politische Beteiligung werden erwähnt.
4 Frauen in Sparta: Das Kapitel beschreibt die politische und gesellschaftliche Ordnung Spartas im Vergleich zu Athen. Es wird die Erziehung und Ausbildung der Frauen in Sparta beleuchtet, die sich deutlich von der athenischen unterscheidet. Die Rolle der Frauen im Oikos wird ebenso erörtert wie die Eigenheiten ihrer Heirat und Ehe. Das Kapitel 4.1 (Politische und gesellschaftliche Ordnung Spartas), 4.2 (Erziehung und Ausbildung), und 4.3 (Heirat und Eheleben) werden nicht einzeln zusammengefasst, sondern im Kontext des gesamten Kapitels betrachtet.
Schlüsselwörter
Frauenrolle, klassisches Griechenland, Athen, Sparta, Oikos, politische Partizipation, Erziehung, Quellenkritik, Xenophon, Aristoteles, Plutarch, Gesellschaftssystem.
Häufig gestellte Fragen (FAQs): Studie zur Rolle der Frauen im klassischen Griechenland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Rolle und Stellung von Frauen im klassischen Griechenland, insbesondere in Athen und Sparta. Der Fokus liegt auf der Position der Frau innerhalb der Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft (Oikos), der Erziehung der Frauen in Sparta und der Analyse antiker Quellen und moderner Forschung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf literarische Quellen wie Tragödien, Reden und Abhandlungen antiker Autoren (vorwiegend Männer), darunter Xenophon, Aristoteles und Plutarch. Nicht-literarische Quellen wie Vasen und Geschirr werden ebenfalls erwähnt, spielen aber eine untergeordnete Rolle. Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen und die unterschiedlichen Perspektiven dieser Quellen, insbesondere die zeitliche Distanz, besonders bei Plutarch, und die unterschiedlichen Positionen von Xenophon (Sparta-Bewunderer) und Aristoteles (kritisch).
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die politische und gesellschaftliche Ordnung Athens und Spartas, das Leben der Frauen im Oikos in beiden Städten, die Erziehung und Ausbildung von Frauen in Sparta, einen Vergleich der Frauenrollen in Athen und Sparta, sowie die Quellenlage und deren Herausforderungen für die Forschung. Spezifische Aspekte in Athen umfassen Heirat, Eheleben, Ehebruch und Prostitution. In Sparta wird die Erziehung und Ausbildung der Frauen besonders hervorgehoben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, die die Problematik und die Quellenlage skizziert; ein Kapitel über die literarischen Quellengrundlagen; ein Kapitel über Frauen in Athen (einschließlich der politischen und gesellschaftlichen Ordnung, Heirat, Ehebruch und Prostitution); ein Kapitel über Frauen in Sparta (einschließlich der politischen und gesellschaftlichen Ordnung, Erziehung und Heirat); und schließlich ein Kapitel mit Vergleich und Konklusion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Frauenrolle, klassisches Griechenland, Athen, Sparta, Oikos, politische Partizipation, Erziehung, Quellenkritik, Xenophon, Aristoteles, Plutarch, Gesellschaftssystem.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Unterschiede in der Rolle und Stellung von Frauen in Athen und Sparta. Sie analysiert die Position der Frau im Oikos und die Erziehung der Frauen in Sparta, und beleuchtet die scheinbaren Widersprüche zwischen mächtigen Göttinnen und der politischen Rechtlosigkeit sterblicher Frauen im klassischen Griechenland.
Wie werden die Kapitel zusammengefasst?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt detailliert den Inhalt jedes Kapitels, beginnend mit der Einleitung, die die Fragestellung und die Quellenlage einführt. Die Kapitel zu Athen und Sparta erläutern die jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Systeme und den Alltag der Frauen. Der Fokus liegt dabei auf den Unterschieden zwischen den beiden Stadtstaaten. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und vergleicht die Erkenntnisse.
- Quote paper
- Ayca Halvali (Author), 2014, Die Rolle der Frau im antiken Griechenland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286446