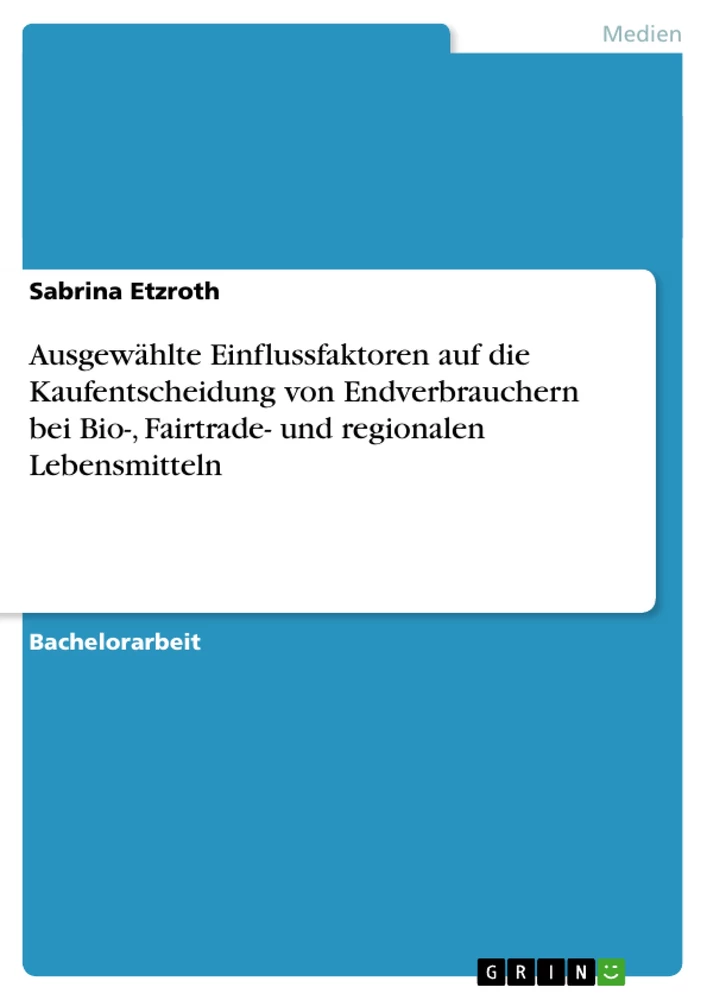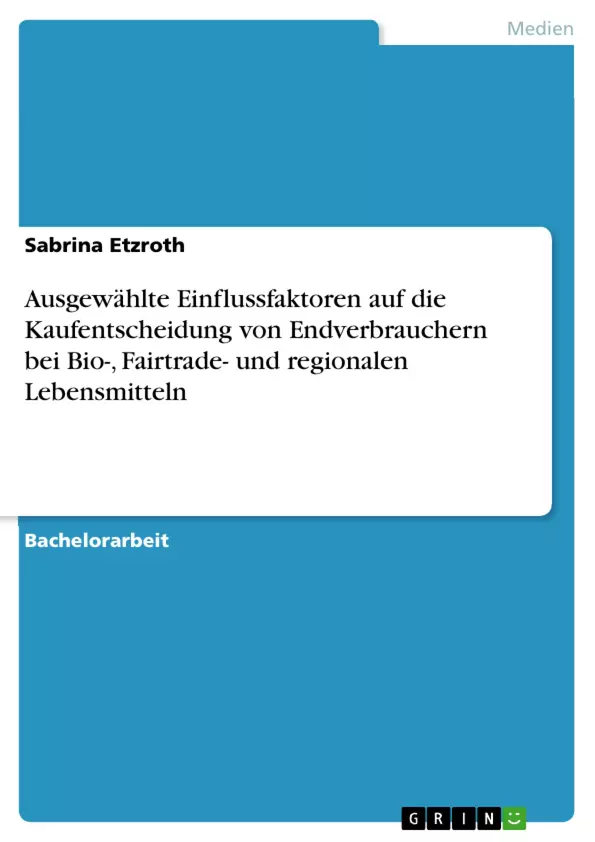Die steigende Nachfrage von Bio-, Fairtrade- und regionalen Lebensmitteln hat eine Ausweitung der Distribution dieser Produkte auf nahezu alle Vertriebskanäle zur Folge. Um auf besondere ökologische und soziale Eigenschaften von Produkten hinzuweisen, werden Güte- und Qualitätssiegel genutzt. Bei der Vielzahl existierender Siegel scheint interessant, ob sie dem Verbraucher tatsächlich als Hilfestellung dienen. Diese Arbeit kommt der Frage nach, wie sich Gütesiegel auf das Kaufverhalten von Endverbrauchern auswirken und welche weiteren Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Dafür wurden qualitative Leitfaden-Interviews mit sechs Personen durchgeführt, die sich in ihrer Einstellung und Kaufintensität von biologischen Lebensmitteln unterscheiden. Die qualitative Inhaltsanalyse brachte hervor, dass sich die Bekanntheit und das Vertrauen in Siegel sowie Regal-Kennzeichnungen am Point of Sale nur teilweise auf die Kaufentscheidung auswirken. Wichtiger erscheint die Grundeinstellung der Person gegenüber einer Produktgruppe. Insgesamt wird deutlich, dass ein geringer Kenntnisstand über die Vorteile dieser Produkte eine große Kaufbarriere darstellt. Konsumenten zeigen Bereitschaft, sich mehr Wissen anzueignen, wenn Informationen aktiv an sie herangetragen werden. Daraus leitet sich als empfohlene Marketingmaßnahme ab, durch Transparenz und Aufklärung über diese Produktgruppen und ihre Siegel weitere Umsatzsteigerungen zu erzielen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemhintergrund und Zielsetzung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 1.3 Erhebungsmethode
- 2 Definitionen und Begriffsabgrenzungen
- 2.1 Siegel
- 2.2 Ökologischer/biologischer Landbau
- 2.3 Regionale Lebensmittel
- 2.4 Fairtrade
- 3 Der Markt für alternativ erzeugte Lebensmittel
- 3.1 Entstehung des Marktes für Bio-Lebensmittel
- 3.2 Marktentwicklung: Distribution und Nachfrage
- 3.2.1 Marktentwicklung für Bio-Lebensmittel
- 3.2.2 Marktentwicklung für Fairtrade-Lebensmittel
- 3.2.3 Marktentwicklung für regionale Lebensmittel
- 3.3 Kennzeichnung von Lebensmitteln
- 3.3.1 Klassifizierung von Siegeln
- 3.3.2 Bio-Siegel
- 3.3.3 Regional-Siegel
- 3.3.4 Fairtrade-Siegel
- 3.3.5 Weitere Kennzeichnungen
- 3.4 Zwischenfazit
- 4 Konsumtheoretische Grundlagen der Kaufentscheidungs- und Verhaltensforschung
- 4.1 Konsumentenverhaltensforschung
- 4.2 Das neo-behavioristische S-O-R-Modell
- 4.3 Einflussfaktoren auf das Konsumentenverhalten
- 4.3.1 Psychische Faktoren
- 4.3.2 Soziale Faktoren
- 4.3.3 Soziodemografische Faktoren
- 4.3.4 Situative Einflüsse
- 4.4 Der Kaufentscheidungsprozess
- 4.5 Umweltorientiertes Konsumentenverhalten
- 4.6 Zwischenfazit
- 5 Der Einfluss ausgewählter Faktoren auf das Kaufverhalten
- 5.1 Aktueller Stand der Forschung
- 5.2 Qualitative Forschung
- 5.2.1 Methode und Zielsetzung
- 5.2.2 Untersuchungsdesign und Durchführung
- 5.2.3 Datenaufbereitung und Auswertung
- 5.3 Ergebnisse der qualitativen Untersuchung
- 5.3.1 Bekanntheit von Siegeln
- 5.3.2 Glaubwürdigkeit der Siegel
- 5.3.3 Kommunikation am Point of Sale
- 5.3.4 Präferenzen von Bio-, Fairtrade- und regionalen Lebensmitteln
- 5.3.5 Lebensmittelskandale
- 5.3.6 Arbeitsbedingungen
- 5.4 Zwischenfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht den Einfluss von Gütesiegeln und weiterer Faktoren auf die Kaufentscheidung von Endverbrauchern bei Bio-, Fairtrade- und regionalen Lebensmitteln. Ziel ist es, die Bedeutung von Siegeln im Kaufprozess zu evaluieren und weitere Einflussfaktoren zu identifizieren.
- Einfluss von Gütesiegeln auf das Kaufverhalten
- Bedeutung des Kenntnisstands über Bio-, Fairtrade- und regionale Produkte
- Rolle der Konsumenteneinstellung gegenüber den Produktgruppen
- Wirkung von Informationen am Point of Sale
- Identifikation weiterer relevanter Einflussfaktoren
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt den Problemhintergrund der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmitteln und die damit verbundene Bedeutung von Gütesiegeln. Es definiert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den methodischen Ansatz.
2 Definitionen und Begriffsabgrenzungen: Hier werden zentrale Begriffe wie Siegel, ökologischer/biologischer Landbau, regionale Lebensmittel und Fairtrade präzise definiert und voneinander abgegrenzt, um eine einheitliche Terminologie für die gesamte Arbeit zu gewährleisten. Dies legt den Grundstein für eine fundierte Analyse.
3 Der Markt für alternativ erzeugte Lebensmittel: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Märkte für Bio-, Fairtrade- und regionale Lebensmittel. Es analysiert die Marktentwicklung hinsichtlich Distribution und Nachfrage und beschreibt verschiedene Kennzeichnungsformen und Siegel. Der Fokus liegt auf dem Wachstum dieser Märkte und den Herausforderungen im Bereich der transparenten Kommunikation.
4 Konsumtheoretische Grundlagen der Kaufentscheidungs- und Verhaltensforschung: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung. Es werden relevante konsumtheoretische Modelle und Einflussfaktoren auf das Konsumentenverhalten vorgestellt, wie das neo-behavioristische S-O-R-Modell und die Berücksichtigung psychischer, sozialer, soziodemografischer und situativer Einflüsse. Die Kapitel beschreibt den Kaufentscheidungsprozess und umweltorientiertes Konsumentenverhalten.
5 Der Einfluss ausgewählter Faktoren auf das Kaufverhalten: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer qualitativen Studie, die den Einfluss ausgewählter Faktoren auf das Kaufverhalten von Endverbrauchern untersucht. Es beschreibt die Methodik (qualitative Leitfadeninterviews), die Datenauswertung und die Ergebnisse bezüglich Bekanntheit und Glaubwürdigkeit von Siegeln, die Kommunikation am Point of Sale sowie die Präferenzen der Konsumenten.
Schlüsselwörter
Bio-Lebensmittel, Fairtrade-Produkte, regionale Lebensmittel, Gütesiegel, Kaufentscheidung, Konsumentenverhalten, qualitative Forschung, Marktentwicklung, Nachhaltigkeit, Transparenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Einfluss von Gütesiegeln auf die Kaufentscheidung von Bio-, Fairtrade- und regionalen Lebensmitteln
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Einfluss von Gütesiegeln und weiterer Faktoren auf die Kaufentscheidung von Konsumenten bei Bio-, Fairtrade- und regionalen Lebensmitteln. Im Mittelpunkt steht die Evaluierung der Bedeutung von Siegeln im Kaufprozess und die Identifizierung weiterer relevanter Einflussfaktoren.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Abgrenzung zentraler Begriffe (Siegel, Bio-Landbau, regionale Lebensmittel, Fairtrade), eine Analyse der Marktentwicklung für alternativ erzeugte Lebensmittel, die Darstellung konsumtheoretischer Grundlagen (inkl. des S-O-R-Modells und Einflussfaktoren auf das Konsumentenverhalten), und die Ergebnisse einer qualitativen Studie zum Einfluss ausgewählter Faktoren auf das Kaufverhalten.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit kombiniert eine deskriptive Markt- und Literaturanalyse mit einer qualitativen empirischen Untersuchung. Die qualitative Forschung basiert auf Leitfadeninterviews, die die Bekanntheit und Glaubwürdigkeit von Siegeln, die Kommunikation am Point of Sale und die Präferenzen der Konsumenten bezüglich Bio-, Fairtrade- und regionaler Lebensmittel beleuchten.
Welche Faktoren beeinflussen die Kaufentscheidung laut der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Gütesiegeln, den Kenntnisstand der Konsumenten über die Produktgruppen, die Konsumenteneinstellung, die Informationen am Point of Sale (POS) und weitere relevante Faktoren auf die Kaufentscheidung.
Welche Ergebnisse liefert die qualitative Studie?
Die qualitative Studie liefert Ergebnisse zur Bekanntheit und Glaubwürdigkeit verschiedener Siegel, zur Wirkung der Kommunikation am Point of Sale, zu den Präferenzen der Konsumenten für Bio-, Fairtrade- und regionale Lebensmittel sowie zu den Auswirkungen von Lebensmittelskandalen und Arbeitsbedingungen auf die Kaufentscheidung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung (Problemhintergrund, Zielsetzung, Methodik), Definitionen und Begriffsabgrenzungen, Der Markt für alternativ erzeugte Lebensmittel, Konsumtheoretische Grundlagen der Kaufentscheidungs- und Verhaltensforschung, und Der Einfluss ausgewählter Faktoren auf das Kaufverhalten (inkl. Ergebnisse der qualitativen Studie).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Bio-Lebensmittel, Fairtrade-Produkte, regionale Lebensmittel, Gütesiegel, Kaufentscheidung, Konsumentenverhalten, qualitative Forschung, Marktentwicklung, Nachhaltigkeit, Transparenz.
Wo finde ich detailliertere Informationen zum Aufbau und den Ergebnissen der Arbeit?
Detailliertere Informationen zum Aufbau und den Ergebnissen der Arbeit finden sich im vollständigen Text der Bachelorarbeit, der das Inhaltsverzeichnis, die Kapitelzusammenfassungen und die Ergebnisse der empirischen Untersuchung beinhaltet.
- Quote paper
- Sabrina Etzroth (Author), 2013, Ausgewählte Einflussfaktoren auf die Kaufentscheidung von Endverbrauchern bei Bio-, Fairtrade- und regionalen Lebensmitteln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286615