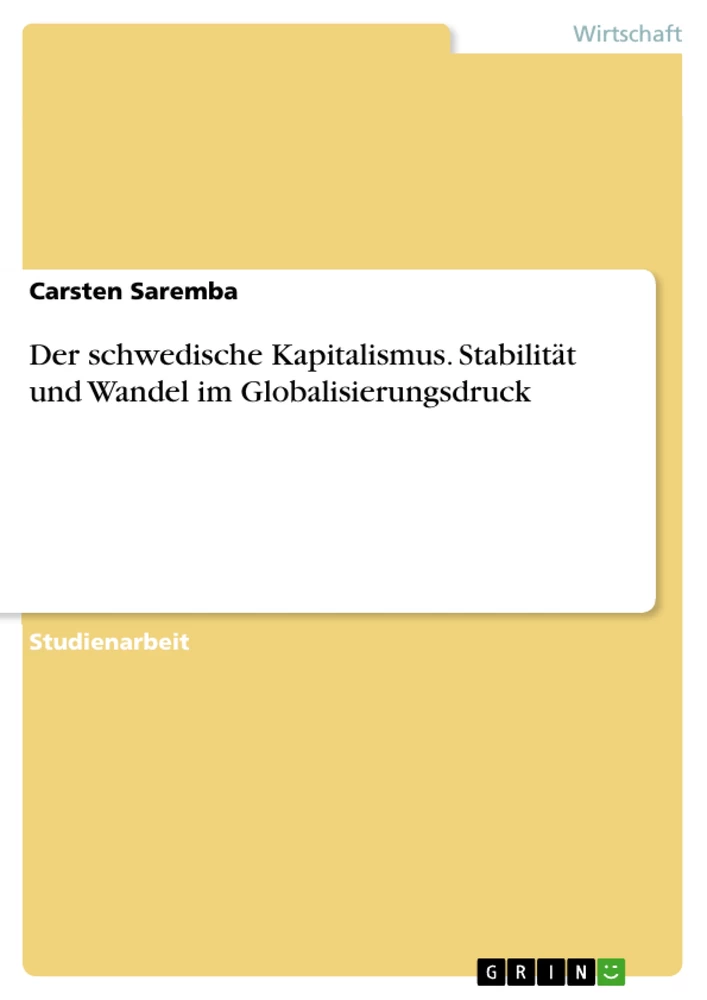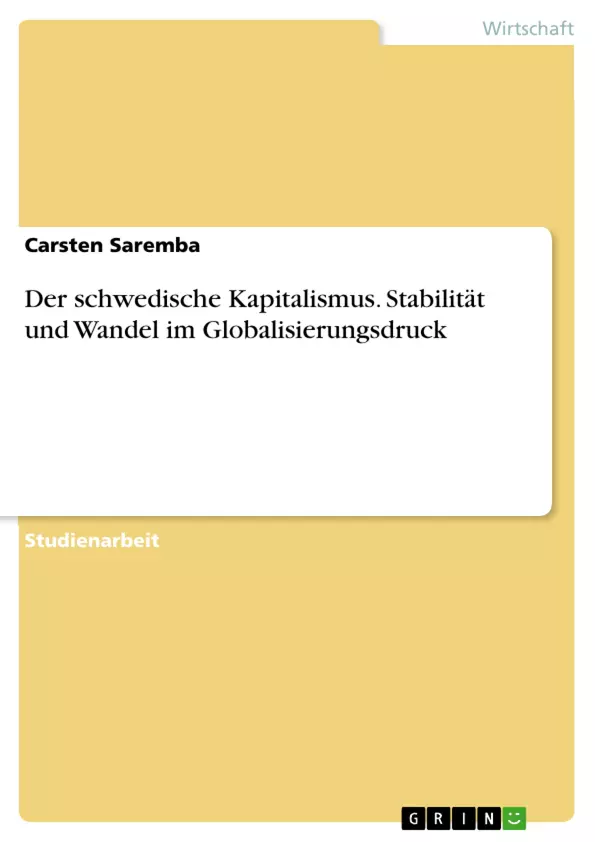Mit den Überlegungen Heraklits von Ephesus, „dass alles in beständiger Veränderung und beständigem Wechsel begriffen wäre“(Schäfer 1902: 85), erkannte man bereits in der Antike (ca. 500 v. Chr.), dass nichts von Dauerhaftigkeit ist. So wird man nie gesetzesartig vorhersagen können, wie die Dinge sind und wie sie sich entwickeln. Dies gilt zumindest für die soziale Welt. Bei der Untersuchung dieser ist es allerdings schon möglich, Veränderungen zu erkennen und Tendenzen für die künftige Entwicklung anzudeuten, auch wenn immer ein Rest Unsicherheit bleibt.
In Europa spüren wir eine Reihe von Umstrukturierungen, die im Hintergrund der allgegenwärtigen und medial überstrapaziert dargestellten Weltwirtschaftskrise stärker bewusst werden. Genau genommen sind viele Reformbestrebungen zu erkennen, die in den Bereichen der Sozial- und Wirtschaftspolitik seit den 1990er-Jahren auf die Herausforderungen einer zusammenwachsenden Welt ausgerichtet sind. Die nationale Berichterstattung europäischer Staaten stellt besonders in den letzten Jahren durch den exogenen „Schock“ der Krise, das Zusammenwachsen eines supranationalen Staates, die Veränderung von Systemen, sowie die Fragen nach dem gemeinsamen Willen und den möglichen Strategien, um Probleme auf höherer Ebene zu lösen, in den Mittelpunkt. Durch eine solch ausgelöste mediale Thematisierung, werden Veränderungen noch stärker vorangetrieben und der öffentliche Diskurs zu den Grenzen der Solidarität eines gemeinsamen „Europas“ entsteht auf einer bedeutenderen politischen Ebene. Wie verändern sich Systeme durch die Globalisierung? Welche Reformen im Bereich der Sozial- und Wirtschaftspolitik werden auf nationaler Ebene angestrebt? Welche Wirkungen haben diese auf das jeweilige wohlfahrtsstaatliche Regime? Welche Rolle spielen Krisen bei Veränderungen der oben genannten Politikbereiche? Wie ist der Kotext der internationalen Staatenwelt zu bewerten? Werden sich die Systeme ähnlicher, durch ein „Mehr“ an Zusammenarbeit und gemeinsamen Zielen? Erzeugen Globalisierungsprozesse vielleicht auch nur unbedeutende systemische Veränderungen? Diese Fragen werde ich versuchen im Rahmen dieser Arbeit anhand der Veränderungen eines ausgewählten Systems zu klären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Die Spielarten des Kapitalismus
- 2 Das Wirtschaftssystem Schwedens
- 2.1 Geschichtliche Grundlegungen
- 2.2 Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände
- 3 Die wirtschaftliche Entwicklung Schwedens seit 1990
- 4 Wandel der Politik - Wandel des Systems?
- 4.1 Politische Maßnahmen 1990-2006
- 4.2 Von Sozialdemokratie zu Neoliberaler Politik
- 4.3 Die Politik der ersten Krise
- 5 Fazit: Ein neuer Pfad Schwedens?
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Schwedische Modell als Beispiel für die Veränderungen eines sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaates im Kontext der Globalisierung. Sie analysiert die Entwicklung des Systems seit den 1990er-Jahren, insbesondere die Auswirkungen politischer Reformen auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Schwedens. Die Arbeit stützt sich auf den Varieties-of-Capitalism-Ansatz, um die spezifischen Merkmale des Schwedischen Modells zu erklären und die Auswirkungen der Globalisierung auf das System zu analysieren.
- Die Entwicklung des Schwedischen Modells im Kontext der Globalisierung
- Die Auswirkungen politischer Reformen auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Schwedens
- Die Rolle des Varieties-of-Capitalism-Ansatzes bei der Analyse des Schwedischen Modells
- Die Herausforderungen und Chancen des Schwedischen Modells in der Reflexiven Moderne
- Die Frage nach dem Erhalt, Umbruch oder Hybridisierung des Schwedischen Wirtschaftssystems
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den theoretischen Rahmen der Arbeit vor. Sie erläutert die Relevanz des Schwedischen Modells als Beispiel für die Veränderungen eines sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaates im Kontext der Globalisierung. Das erste Kapitel stellt den Varieties-of-Capitalism-Ansatz vor und erläutert die verschiedenen Spielarten des Kapitalismus. Das zweite Kapitel beschreibt die geschichtliche Entwicklung des Schwedischen Modells bis zum Ende der 1980er-Jahre und ordnet es in die Typologien des Varieties-of-Capitalism-Ansatzes ein. Das dritte Kapitel analysiert die wirtschaftliche Entwicklung Schwedens seit 1990 und beleuchtet die Auswirkungen der Globalisierung auf das System. Das vierte Kapitel untersucht die politischen Reformen in Schweden seit den 1990er-Jahren und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Das fünfte Kapitel zieht ein Fazit und beantwortet die Forschungsfrage: Erhalt, Umbruch oder Hybridisierung des Schwedischen Wirtschaftssystems?
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Schwedische Modell, den Varieties-of-Capitalism-Ansatz, die Globalisierung, den Wohlfahrtsstaat, die Sozialdemokratie, die wirtschaftliche Entwicklung, die politische Entwicklung, die Reformen, die Herausforderungen und Chancen des Schwedischen Modells in der Reflexiven Moderne.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet das „Schwedische Modell“ traditionell aus?
Es ist bekannt für einen starken Sozialstaat, hohe soziale Sicherheit, eine aktive Arbeitsmarktpolitik und eine enge Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern.
Wie hat die Globalisierung Schweden seit den 1990ern verändert?
Der globale Wettbewerbsdruck führte zu Reformen, die Elemente des Neoliberalismus einführten, das System flexibilisierten und teilweise den Staatssektor verkleinerten.
Was ist der „Varieties of Capitalism“-Ansatz?
Dieser theoretische Rahmen unterscheidet zwischen verschiedenen Typen von Marktwirtschaften (z. B. liberal vs. koordiniert), um zu analysieren, wie Länder auf wirtschaftliche Herausforderungen reagieren.
Erlebt Schweden einen Systembruch oder eine Hybridisierung?
Die Arbeit untersucht, ob Schweden seinen sozialdemokratischen Kern aufgibt oder ob eine Mischform (Hybrid) aus traditioneller Wohlfahrtspolitik und modernen Marktmechanismen entsteht.
Welche Rolle spielten Wirtschaftskrisen für die Reformen?
Krisen wie die in den frühen 1990er-Jahren fungierten oft als Katalysatoren für tiefgreifende politische und wirtschaftliche Umstrukturierungen.
- Citation du texte
- Carsten Saremba (Auteur), 2012, Der schwedische Kapitalismus. Stabilität und Wandel im Globalisierungsdruck, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286631