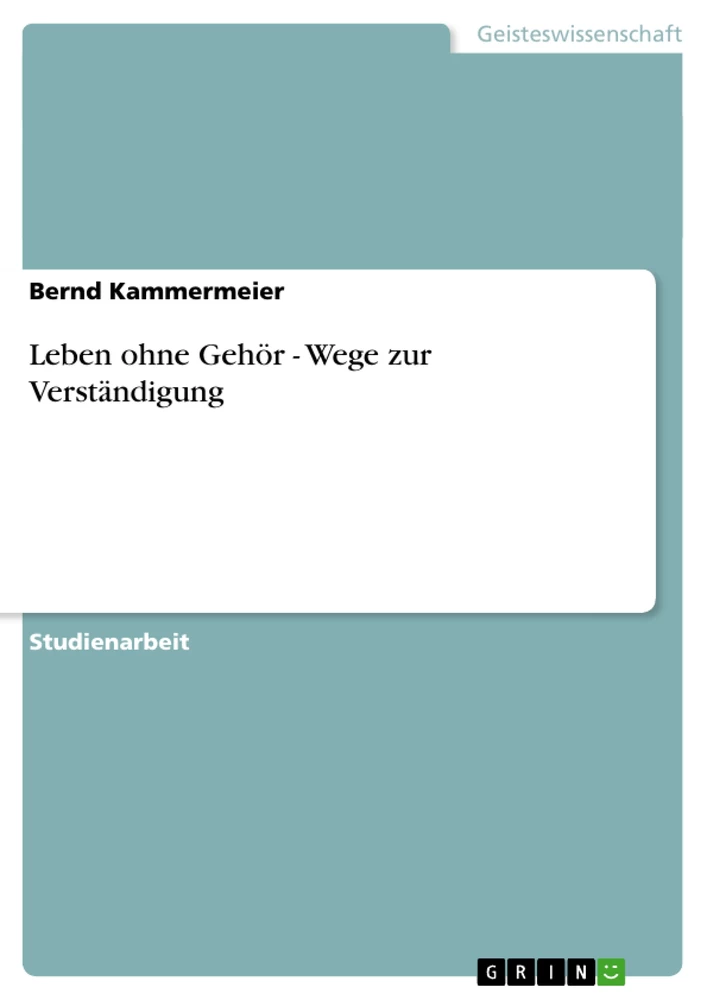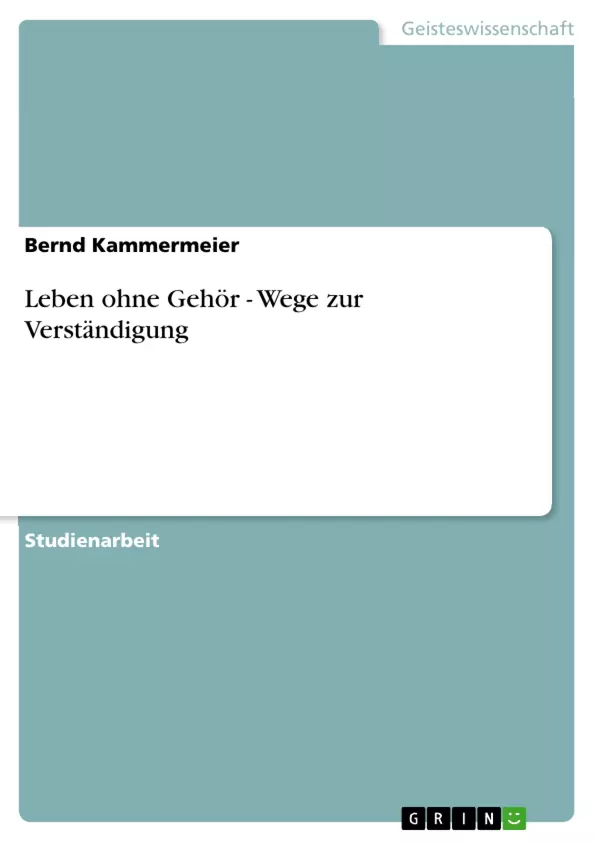Den Anlass dieses Referats brauchte ich nicht lange zu suchen. Ich habe im Oktober 2003 mit einer Gruppe von Studenten aus unserem Fachbereich Sozialwesen und unserem Professor Dr. jur. Hubertus Lauer an einem Studentenaustausch mit der Gallaudet University in Washington teilgenommen. Um diese Erlebnisse und Eindrücke bestmöglich zu verarbeiten, schien mir und letztendlich natürlich auch meinen Prüfern, ein Referat als angebracht. Der Umgang mit dem Thema Gehörlosigkeit und den Folgen dieser Einschränkung war für mich zum damaligen Zeitpunkt praktisch unbekannt. Dies mag sich bestimmt für die meisten von uns genauso darstellen. Genau an diesem Punkt aber möchte ich anknüpfen. Gehörlosigkeit ist ein Thema, was gerade in der Sozialarbeit einen unheimlich hohen Stellenwert haben müsste. Die Problemlagen und Ängste dieser Menschen sind praktisch auf Sozialarbeit gemünzt. Sei es bei der schulischen und beruflichen Ausbildung, beim Umgang mit Ämtern oder auch nur beim Einkaufen. Gehörlose Menschen müssen einen Weg in die Gesellschaft finden können, wenn sie das wollen. Wir müssen sie dabei unterstützen, dass ist unsere Aufgabe als Sozialarbeiter.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Was hat das mit Amerika und unserem Austausch zu tun? In Amerika haben wir gelernt, wie ein möglicher Umgang mit Gehörlosigkeit weitestgehend ohne öffentliche Diskriminierung stattfinden kann. Sei es beim Fernsehen, dass zu 90 Prozent untertitelt ist, beim Bahn fahren mit speziellen Leuchtsignalen, beim Eintreffen der Bahn oder bei dem Buchfestival auf der „Mall“, bei dem bei jeder Rede auch ein Gebärdensprachdolmetscher übersetzt. Gehörlose könne am öffentlichen Leben teilnehmen, wenn Sie das wollen. Sie haben die Möglichkeit in einer hörenden Welt zu bestehen. Ich bin der Meinung, dass dies in Deutschland nicht in diesem Maße der Fall ist. Es ist wohl in den vergangenen Jahren viel passiert, die Gebärdensprache, die Sprache der Gehörlosen wurde anerkannt. Ich finde aber, gerade an uns allen kann es liegen, dass noch mehr getan wird. Es benötigt sicher mancher Diskussion, was man als sinnvoll und gut ansehen und was man als Unsinn abtun kann. Amerika ist nicht Deutschland und nicht alles was man in Deutschland in Sachen Gehörlosenpädagogik unternommen hat ist schlecht. Allein durch Informationen lassen sich Vorurteile abbauen und Grenzen einreisen. Genau das ist es auch, was ich mit diesem Referat erreichen möchte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Biografie: Mein Leben als Gehörloser
- 3 Durch Verständnis zur Verständigung - Wege in die Gemeinschaft
- 4 Was ist Gehörlosigkeit?
- 4.1 Die Gehörlosigkeit: Eine Kommunikationsstörung
- 4.2 Der Versuch einer Begriffsbestimmung
- 4.3 Die Hörschädigung in der medizinischen Sichtweise
- 4.3.1 Die Schallleitungsschwerhörigkeit
- 4.3.2 Die Innenohrschwerhörigkeit
- 4.3.3 Die zentrale Schwer- und Fehlhörigkeit
- 4.4 Die Beurteilung des Schweregrades der Schädigung
- 4.4.1 Der Grad des Hörverlustes
- 4.4.2 Der Zeitpunkt der Schädigung
- 4.4.3 Die Sozialisationsbedingungen
- 4.4.3.1 Der Zeitpunkt des Erkennens der Hörschädigung
- 4.4.3.2 Die Förderkonzepte
- 4.4.3.3 Die technische Versorgung
- 4.4.3.4 Selbstbild: Kulturelle Minderheit contra Behinderung
- 4.4.4 Die intellektuellen Kompensationsmöglichkeiten des Einzelnen
- 4.5 Was ist Gehörlosigkeit – eine Zusammenfassung
- 5 Das Leben mit Gehörlosigkeit: „Folgen, Probleme, Perspektiven“
- 5.1 Die Laut- und Schriftsprache in der Kommunikation gehörloser Menschen
- 5.2 Die Gebärdensprache: Sprache der Gehörlosen
- 5.3 Der Alltag gehörloser Menschen
- 5.4 Die Perspektiven gehörloser Menschen in einer hörenden Welt
- 5.5 Das Cochlea Implant
- 5.5.1 Das Cochlea Implant: Die ideale Hörhilfe für spät ertaubte Menschen
- 5.5.2 Die Gehörlosenkultur und das Cochlea Implant
- 6 Der Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat zielt darauf ab, das Thema Gehörlosigkeit aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und das Verständnis für die Lebensrealität gehörloser Menschen zu fördern. Es basiert auf persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen während eines Studentenaustauschs an der Gallaudet University. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und Möglichkeiten der Kommunikation, der Integration in die hörende Gesellschaft und den unterschiedlichen Ansätzen der Förderung gehörloser Menschen.
- Die Kommunikationsmöglichkeiten und -barrieren gehörloser Menschen
- Der Einfluss der Sozialisationsbedingungen auf die Entwicklung gehörloser Menschen
- Die Rolle der Gebärdensprache und der oralen Kommunikation
- Der Vergleich der Gehörlosenversorgung in Deutschland und den USA
- Die Perspektiven gehörloser Menschen in einer hörenden Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Anlass des Referats, nämlich einen Studentenaustausch an der Gallaudet University. Der Autor betont die Bedeutung des Themas Gehörlosigkeit für die Sozialarbeit und den Unterschied im Umgang mit Gehörlosigkeit zwischen Deutschland und den USA. Der Autor hebt hervor, dass in Amerika die Integration gehörloser Menschen in das öffentliche Leben weit fortgeschrittener ist als in Deutschland, und er möchte mit seinem Referat dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und das Bewusstsein für die Bedürfnisse gehörloser Menschen zu schärfen.
2 Biografie: Mein Leben als Gehörloser: Dieses Kapitel präsentiert die persönliche Erfahrung eines gehörlosen Menschen, Peter Sch., der seit seiner Geburt gehörlos ist. Es beschreibt die Herausforderungen der oralen Erziehung, die Schwierigkeiten in der Kommunikation mit hörenden Menschen und die Isolation, die er in seiner hörenden Familie erlebt. Im Gegensatz dazu findet er in der Gemeinschaft gehörloser Menschen Akzeptanz und Unterstützung durch die gemeinsame Gebärdensprache. Der Text unterstreicht den Unterschied zwischen der Erfahrung der Zugehörigkeit in der Gehörlosengemeinschaft und der Isolation in der hörenden Welt. Die Schwierigkeiten im Berufsleben und der Informationszugang in der hörenden Gesellschaft werden als weitere Aspekte seiner Benachteiligung dargestellt.
3 Durch Verständnis zur Verständigung - Wege in die Gemeinschaft: (Anmerkung: Der Inhalt dieses Kapitels ist nicht im bereitgestellten Text enthalten und muss daher aus der vollständigen Arbeit entnommen werden.)
4 Was ist Gehörlosigkeit?: Dieses Kapitel behandelt die Definition von Gehörlosigkeit und die unterschiedlichen Arten der Hörschädigung aus medizinischer Perspektive (Schallleitungs-, Innenohr- und zentrale Schwerhörigkeit). Es analysiert die Faktoren, die den Schweregrad der Hörschädigung beeinflussen (Grad des Hörverlustes, Zeitpunkt der Schädigung und Sozialisationsbedingungen). Dabei werden Förderkonzepte, technische Versorgung und das Selbstbild der Betroffenen ("Kulturelle Minderheit contra Behinderung") thematisiert. Abschließend wird versucht, eine umfassende Zusammenfassung des Begriffs "Gehörlosigkeit" zu geben.
5 Das Leben mit Gehörlosigkeit: „Folgen, Probleme, Perspektiven“: Dieses Kapitel untersucht die Folgen von Gehörlosigkeit. Die Laut- und Schriftsprache sowie die Gebärdensprache als Kommunikationsmittel werden beleuchtet. Es wird der Alltag gehörloser Menschen im Kontext einer hörenden Welt beschrieben. Schließlich widmet es sich den Perspektiven gehörloser Menschen, unter anderem der Rolle des Cochlea-Implantats, seiner Vor- und Nachteile sowie dessen Einordnung in den Kontext der Gehörlosenkultur.
Schlüsselwörter
Gehörlosigkeit, Kommunikation, Gebärdensprache, Hörschädigung, Integration, Sozialisation, Cochlea-Implantat, Inklusion, Kommunikationsbarrieren, Gehörlosenkultur, Soziale Teilhabe, Förderkonzepte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Mein Leben als Gehörloser"
Was ist der Inhalt des Dokuments "Mein Leben als Gehörloser"?
Das Dokument ist eine umfassende Übersicht über das Thema Gehörlosigkeit. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und Möglichkeiten der Kommunikation, der Integration in die hörende Gesellschaft und den unterschiedlichen Ansätzen der Förderung gehörloser Menschen. Der Text basiert teilweise auf persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen während eines Studentenaustauschs an der Gallaudet University.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument umfasst folgende Kapitel: 1. Einleitung, 2. Biografie: Mein Leben als Gehörloser, 3. Durch Verständnis zur Verständigung - Wege in die Gemeinschaft, 4. Was ist Gehörlosigkeit?, 5. Das Leben mit Gehörlosigkeit: „Folgen, Probleme, Perspektiven“, 6. Der Schluss. Kapitel 3 enthält im vorliegenden Auszug keine Informationen.
Welche Themen werden im Kapitel "Was ist Gehörlosigkeit?" behandelt?
Dieses Kapitel definiert Gehörlosigkeit und beschreibt verschiedene Arten der Hörschädigung aus medizinischer Sicht (Schallleitungs-, Innenohr- und zentrale Schwerhörigkeit). Es analysiert Faktoren, die den Schweregrad der Hörschädigung beeinflussen (Grad des Hörverlustes, Zeitpunkt der Schädigung und Sozialisationsbedingungen), einschließlich Förderkonzepte, technischer Versorgung und dem Selbstbild Betroffener ("Kulturelle Minderheit contra Behinderung"). Abschließend fasst es den Begriff "Gehörlosigkeit" zusammen.
Was wird im Kapitel "Das Leben mit Gehörlosigkeit" besprochen?
Dieses Kapitel beleuchtet die Folgen von Gehörlosigkeit, untersucht Laut- und Schriftsprache sowie Gebärdensprache als Kommunikationsmittel und beschreibt den Alltag gehörloser Menschen in einer hörenden Welt. Es widmet sich den Perspektiven gehörloser Menschen, einschließlich der Rolle des Cochlea-Implantats, seinen Vor- und Nachteilen und seiner Einordnung in den Kontext der Gehörlosenkultur.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, Gehörlosigkeit aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und das Verständnis für die Lebensrealität gehörloser Menschen zu fördern. Es möchte Vorurteile abbauen und das Bewusstsein für die Bedürfnisse gehörloser Menschen schärfen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich der Gehörlosenversorgung in Deutschland und den USA.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Gehörlosigkeit, Kommunikation, Gebärdensprache, Hörschädigung, Integration, Sozialisation, Cochlea-Implantat, Inklusion, Kommunikationsbarrieren, Gehörlosenkultur, Soziale Teilhabe, Förderkonzepte.
Gibt es eine persönliche Perspektive im Dokument?
Ja, das Dokument enthält die persönliche Erfahrung eines gehörlosen Menschen (Peter Sch.), der seit seiner Geburt gehörlos ist. Es beschreibt seine Herausforderungen mit oraler Erziehung, Kommunikation mit hörenden Menschen, Isolation in seiner hörenden Familie und die Akzeptanz innerhalb der Gehörlosengemeinschaft.
Wie wird die Gehörlosenversorgung in Deutschland und den USA verglichen?
Der Text erwähnt, dass die Integration gehörloser Menschen in das öffentliche Leben in den USA weit fortgeschrittener ist als in Deutschland. Ein detaillierterer Vergleich wird jedoch nicht im vorliegenden Auszug präsentiert.
- Quote paper
- Bernd Kammermeier (Author), 2004, Leben ohne Gehör - Wege zur Verständigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28669