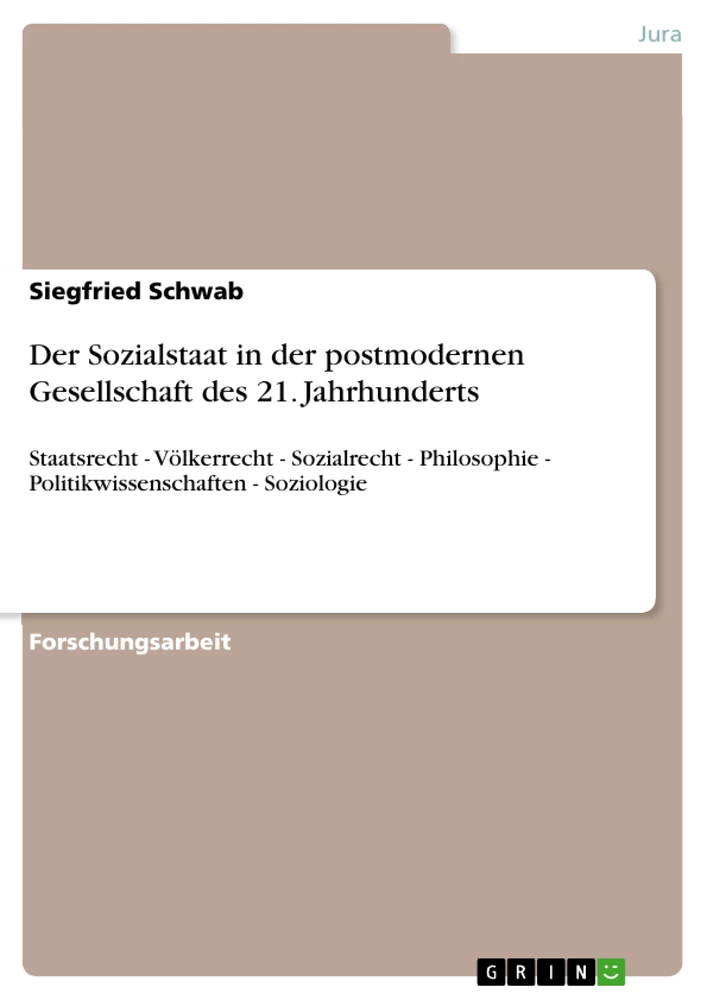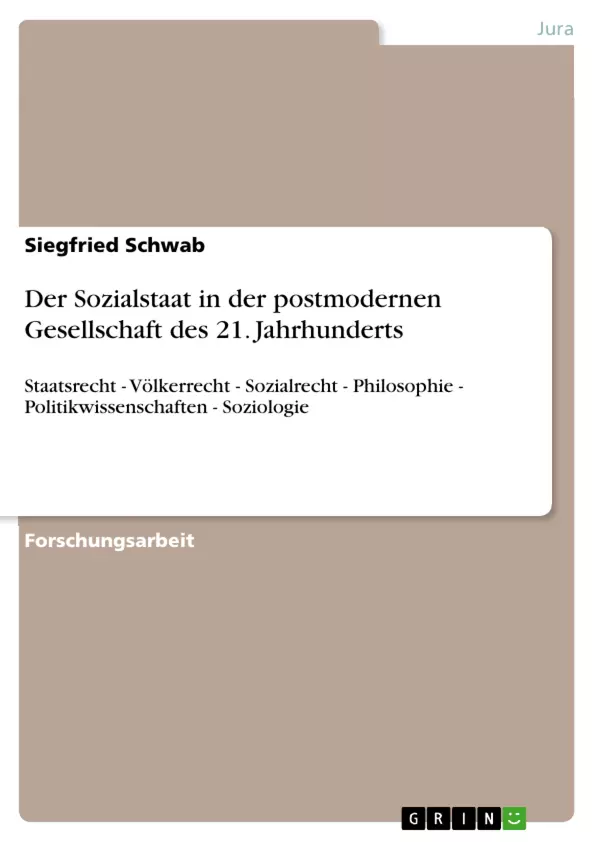Das einzige, was die Armut beseitigen kann, ist miteinander zu teilen - Mutter Teresa.
Deutschland altert! Schattenseiten dieser unbestreitbaren Erkenntnis sind die hierzulande steigenden Zahlen von Pflegebedürftigen. Verantwortung haben wir für uns selbst u. für andere. Beides ist nicht zu trennen, beides spielt ineinander. Das ist deshalb so, weil wir in erster Linie für unsere Handlungen verantwortlich sind, die oftmals auch andere betreffen. Für meine Handlungen bin ich verantwortlich; ich könnte sie anders oder gar nicht ausführen. Der demografische Wandel gehört zu den „Megatrends“ unserer Zeit. Der Anteil der älteren gegenüber den jüngeren Menschen wächst beständig. Das „Bestandserhaltungsniveau“ wurde auch durch politische Maßnahmen wie dem Elterngeld, der angestrebten besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Work-Life-Balance; Beruf und Familie Programme) nicht annähernd erreicht. Der Sozialstaat blickt auf eine lange u. etablierte Kooperation mit nichtstaatlichen Akteuren zurück. Lange bevor er die Institutionen schuf, die heute die sozialen Sicherungssysteme tragen und verantworten, hatten sich Kirchen und Gemeinden, humanitäre und berufsbezogene Vereinigungen und Betriebe sozialer Problemlagen angenommen, die der Einzelne zu bewältigen nicht in der Lage war. „Wenn wir die Zukunft gestalten wollen, wenn wir sie menschlich gestalten wollen, brauchen wir Zweierlei. Vertrauen in die, die für uns Verantwortung tragen und die Bereitschaft, selbst Verantwortung zu übernehmen- Johannes Rau.
Ein Gefühl ist in einer demokratisch verfassten Gesellschaft geradezu von systemrelevanter Wichtigkeit: Vertrauen. Ohne das Vertrauen der BürgerInnen darauf, dass ihre Grundrechte geschützt werden, dass Demokratie und Rechtsstaat funktionieren, fehlt dem Staat seine wichtigste legitimatorische Grundlage.
Die wichtigste und folgenreichste Weichenstellung des BVerfG im Umgang mit der Menschenwürde liegt darin, Art. 1 Abs. 1 GG als individuelles subjektives Grundrecht zu verstehen und anzuwenden. Aus der Unantastbarkeit der Menschenwürde ergibt sich aber noch nicht zwingend, was der zu schützende Inhalt der Menschenwürde ist, oder wann im konkreten Fall die Menschenwürde verletzt wird.
Toleranz ist mehr als bloßes Erdulden und Ertragen. Gelebte Toleranz ist Anerkennung des Anderen als zwar anders, aber wertvoll und gleichberechtigt. Bloßes Dulden heißt beleidigen- von Goethe.
Das Wir gewinnt. In diesem Satz schwingt alles mit, was Inklusion kennzeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- Deutschland altert!
- Der demografische Wandel
- Der vorsorgende, aktivierende und absichernde Sozialstaat in der Postmoderne
- Die Sozialstaatsklausel
- Der aktivierende Sozialstaat
- Grenzen der Daseinsvorsorge
- Sozialstaat: Ein Rückbau ist nicht verboten
- Grundlagen und Herausforderungen des Sozialstaates
- Visionen zeitgenössischer Sozialreformen
- Das bedingungslose Grundeinkommen
- Rationalität im Recht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk analysiert die Herausforderungen des alternden Deutschlands im Kontext des Sozialstaats. Es untersucht den demografischen Wandel, die Entwicklung des Sozialstaatsmodells, und die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen als möglichen Lösungsansatz. Die Analyse stützt sich auf verschiedene Perspektiven und berücksichtigt sowohl verfassungsrechtliche als auch sozialpolitische Aspekte.
- Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf den Sozialstaat
- Die Entwicklung des Sozialstaatsmodells in Deutschland
- Die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen
- Die Rolle des Staates und die Eigenverantwortung des Bürgers
- Rationalität und Recht im Kontext des Sozialstaats
Zusammenfassung der Kapitel
Deutschland altert!: Der einleitende Abschnitt beschreibt den demografischen Wandel Deutschlands und seine Auswirkungen, insbesondere die steigenden Zahlen von Pflegebedürftigen und Demenzkranken. Er betont die Notwendigkeit, sich auf die alternde Gesellschaft einzustellen und Lösungsansätze zu entwickeln.
Der demografische Wandel: Dieses Kapitel analysiert den demografischen Wandel als Megatrend und seine Folgen für den Arbeitsmarkt und die Sozialsysteme. Es wird die unzureichende Wirkung politischer Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie kritisiert und die Notwendigkeit einer realistischen Einstellung auf die "alternde Arbeitsgesellschaft" hervorgehoben.
Der vorsorgende, aktivierende und absichernde Sozialstaat in der Postmoderne: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Konzepten des Sozialstaats, vom vorsorgenden zum aktivierenden Modell. Es diskutiert die Rolle des Staates in der sozialen Sicherung und die Bedeutung der Selbsthilfe. Das bedingungslose Grundeinkommen wird als ein möglicher, radikaler Ansatz im Kontext der Postmoderne vorgestellt.
Die Sozialstaatsklausel: Dieser Abschnitt analysiert die verfassungsrechtliche Grundlage des Sozialstaats und seine Grenzen. Er diskutiert die Interpretation der Sozialstaatsklausel und die Verantwortung des Staates für die Förderung des sozialen Zusammenhalts. Die Verantwortung des Staates zur Daseinsvorsorge und deren Grenzen werden beleuchtet.
Der aktivierende Sozialstaat: Hier wird das Konzept des aktivierenden Sozialstaats im Detail erläutert. Es wird der Fokus auf die soziale Aktivierung des Hilfebedürftigen und seine Befähigung zur Selbsthilfe betont, im Gegensatz zum traditionellen, vorsorgenden Modell.
Grenzen der Daseinsvorsorge: Dieses Kapitel setzt sich kritisch mit den Grenzen der staatlichen Daseinsvorsorge auseinander. Es diskutiert die Balance zwischen staatlicher Fürsorge und individueller Freiheit und greift dabei auf den Ansatz von Lorenz von Stein zurück.
Sozialstaat: Ein Rückbau ist nicht verboten: Der Abschnitt präsentiert eine Debatte über die Zukunft des Sozialstaats und die Möglichkeit eines Rückbaus. Es wird argumentiert, dass ein Rückbau unter Beachtung der Grundrechte und rechtsstaatlichen Prinzipien möglich ist, und die Notwendigkeit einer Neujustierung des Verhältnisses von Solidarität und Eigenverantwortung betont.
Grundlagen und Herausforderungen des Sozialstaates: Dieser Abschnitt beleuchtet die Herausforderungen des Sozialstaats im Kontext des wirtschaftlichen Wandels und neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Schwierigkeiten der Rechtsfindung und die Notwendigkeit von Anpassungen an neue soziale Probleme werden hervorgehoben.
Visionen zeitgenössischer Sozialreformen: Hier werden verschiedene Visionen und Ziele von Sozialreformen diskutiert, und die unterschiedlichen Perspektiven von liberalen und sozialstaatlichen Ansätzen werden verglichen.
Das bedingungslose Grundeinkommen: Dieses Kapitel widmet sich der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen, insbesondere der Frage nach der Bedingungslosigkeit und der Entkoppelung von Arbeit und Einkommen. Die Kritikpunkte und die unterschiedlichen Standpunkte in der Debatte werden ausführlich dargestellt.
Rationalität im Recht: Der Schlussteil des Vorschaues befasst sich mit dem Prinzip der Rationalität im Recht und seiner Bedeutung für den Sozialstaat. Es wird betont, dass staatliche Entscheidungen nachvollziehbar und von sachfremden Zwecken frei sein müssen.
Schlüsselwörter
Sozialstaat, demografischer Wandel, Altersarmut, bedingungsloses Grundeinkommen, aktivierender Sozialstaat, Daseinsvorsorge, Eigenverantwortung, Solidarität, Rationalität im Recht, Sozialpolitik, Verfassungsrecht.
Häufig gestellte Fragen zum Werk: Herausforderungen des alternden Deutschlands im Kontext des Sozialstaats
Was ist der zentrale Gegenstand dieses Werkes?
Das Werk analysiert die Herausforderungen des demografischen Wandels in Deutschland und dessen Auswirkungen auf den Sozialstaat. Es untersucht die Entwicklung des Sozialstaatsmodells, die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen und die Rolle des Staates im Kontext einer alternden Gesellschaft.
Welche Themen werden im Buch behandelt?
Die behandelten Themen umfassen den demografischen Wandel und seine Folgen, verschiedene Konzepte des Sozialstaats (vorsorgend, aktivierend, absichernd), die Sozialstaatsklausel, die Grenzen der Daseinsvorsorge, die Diskussion um einen möglichen Rückbau des Sozialstaats, zeitgenössische Sozialreformen und das bedingungslose Grundeinkommen. Verfassungsrechtliche und sozialpolitische Aspekte werden gleichermaßen berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst das Buch?
Das Buch beinhaltet Kapitel zu folgenden Themen: Deutschland altert!, Der demografische Wandel, Der vorsorgende, aktivierende und absichernde Sozialstaat in der Postmoderne, Die Sozialstaatsklausel, Der aktivierende Sozialstaat, Grenzen der Daseinsvorsorge, Sozialstaat: Ein Rückbau ist nicht verboten, Grundlagen und Herausforderungen des Sozialstaates, Visionen zeitgenössischer Sozialreformen, Das bedingungslose Grundeinkommen und Rationalität im Recht.
Welche Kernfragen werden im Buch behandelt?
Kernfragen sind die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Sozialstaat, die Zukunft des Sozialstaatsmodells in Deutschland, die Rolle von Eigenverantwortung und staatlicher Fürsorge, die Grenzen der staatlichen Daseinsvorsorge und die Bewertung des bedingungslosen Grundeinkommens als mögliche Lösung für die Herausforderungen der alternden Gesellschaft.
Welche Perspektiven werden eingenommen?
Das Werk betrachtet die Thematik aus verfassungsrechtlicher und sozialpolitischer Perspektive. Es werden verschiedene Konzepte des Sozialstaats diskutiert und unterschiedliche Standpunkte zur Zukunft des Sozialstaats und zur Rolle des Staates gegenüber dem Bürger präsentiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis des Buches?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Sozialstaat, demografischer Wandel, Altersarmut, bedingungsloses Grundeinkommen, aktivierender Sozialstaat, Daseinsvorsorge, Eigenverantwortung, Solidarität, Rationalität im Recht, Sozialpolitik und Verfassungsrecht.
Für wen ist dieses Buch gedacht?
Dieses Buch richtet sich an alle, die sich mit den Herausforderungen des demografischen Wandels und der Zukunft des Sozialstaats auseinandersetzen möchten. Es ist relevant für Wissenschaftler, Studierende, Politiker und alle Bürger, die sich für soziale und politische Fragen interessieren.
Wie wird das bedingungslose Grundeinkommen im Buch behandelt?
Das bedingungslose Grundeinkommen wird als ein möglicher, radikaler Lösungsansatz im Kontext der Herausforderungen des alternden Deutschlands und des sich verändernden Sozialstaatsmodells diskutiert. Die Debatte um die Bedingungslosigkeit, die Entkopplung von Arbeit und Einkommen, sowie die Kritikpunkte und unterschiedlichen Standpunkte werden ausführlich dargestellt.
- Quote paper
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Author), 2014, Der Sozialstaat in der postmodernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286695