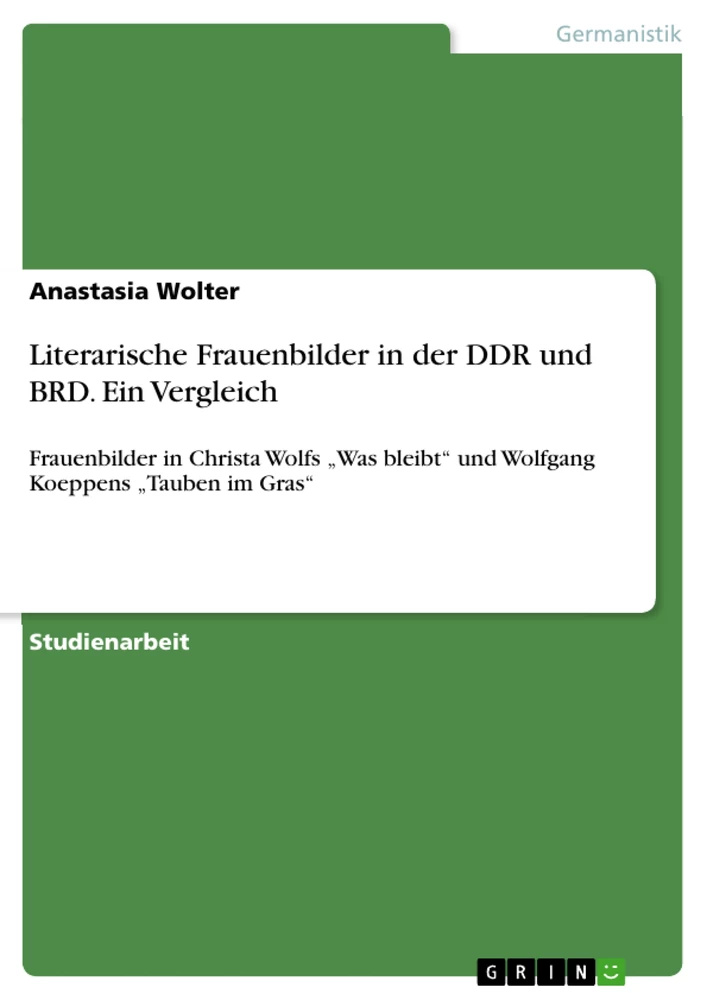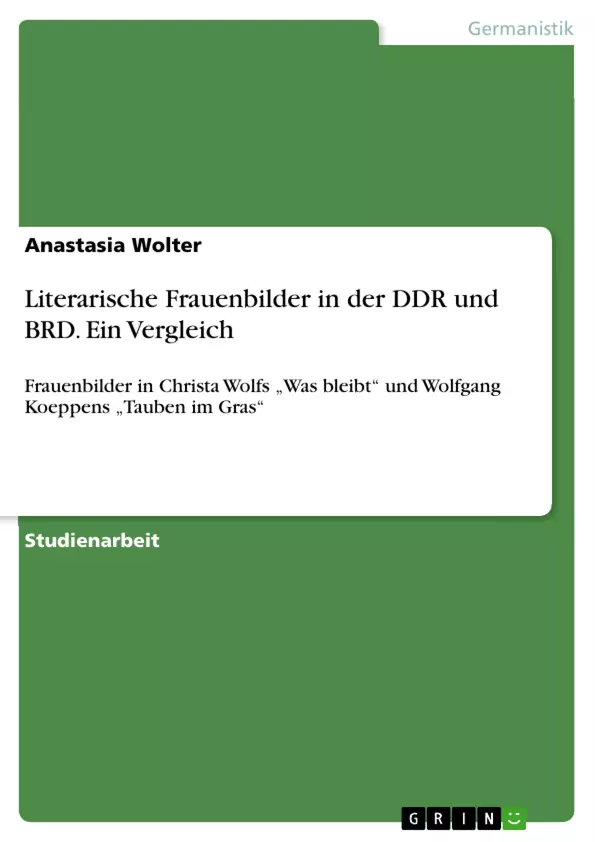Sowohl in Koeppens Roman "Tauben im Gras", als auch in Wolfs Erzählung "Was bleibt" werden unterschiedliche Frauenbilder dargestellt. Meist befinden sich die Frauen in schwierigen Lebenslagen und versuchen, angemessen damit umzugehen. Sie sind dem politischen oder gesellschaftlichen Druck ausgesetzt und reagieren verschieden darauf. In dieser Hausarbeit soll der Weg aufgewiesen werden, welchen die Frauen in den Erzählungen, die sowohl in der DDR als auch in der BRD spielen, wählen, um mit ihren Erlebnissen umzugehen. Des Weiteren werden ihre Charakterzüge und ihr Verhalten dargestellt. Außerdem wird die teilweise unterschiedliche Darstellung der Frauenbilder in der DDR und der BRD deutlich. In einigen Hinsichten korrespondieren diese Frauenbilder mit den jeweiligen politischen Systemen. Während in Wolfs Erzählung die Ostberliner Schriftstellerin versucht, mit ihren Ängsten alleine umzugehen, ist eine wesentlich größere Abhängigkeit von Männern bei den Frauen in der BRD erkennbar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Darstellung von Frauen in der DDR in Christa Wolfs Erzählung „Was bleibt“
- Der Einfluss der Observation durch die Stasi auf die Protagonistin
- Die Protagonistin und ihr Umgang mit Menschen aus ihrer direkten Umgebung
- Die Darstellung von Frauen in der BRD in Wolfgang Koeppens Roman „Tauben im Gras“
- Die Darstellung der unterschiedlichen Frauencharaktere
- Die Abhängigkeit der Frauen in „Tauben im Gras“
- Vergleich der unterschiedlichen in der DDR oder BRD dargestellten literarischen Frauenbilder
- Literatur und Kritik in Ost und West
- Die Rezeption von Christa Wolfs Erzählung „Was bleibt“ in der DDR und in der BRD
- Die Rezeption von Wolfgang Koeppens Roman „Tauben im Gras“ in der DDR und in der BRD
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Darstellung von Frauen in der DDR und der BRD anhand der Erzählung „Was bleibt“ von Christa Wolf und des Romans „Tauben im Gras“ von Wolfgang Koeppen. Im Zentrum stehen die unterschiedlichen Lebensbedingungen und Erfahrungen von Frauen in den beiden deutschen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg.
- Die Auswirkungen der politischen und gesellschaftlichen Bedingungen auf die Frauenfiguren in den beiden Werken
- Der Einfluss von Machtstrukturen und sozialen Normen auf das Leben und die Selbstfindung der Frauen
- Die Rolle von Beobachtung und Kontrolle im Leben der Protagonistinnen
- Die unterschiedlichen Formen der Abhängigkeit und Freiheit von Frauen in der DDR und der BRD
- Der Vergleich der literarischen Frauenbilder und ihrer Rezeption in Ost und West
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die beiden Werke, „Was bleibt“ und „Tauben im Gras“, sowie deren Kontext vor. Das zweite Kapitel analysiert die Darstellung von Frauen in der DDR anhand der Protagonistin in Christa Wolfs Erzählung. Dabei wird der Einfluss der Observation durch die Stasi auf ihr Leben und ihre Gefühlswelt untersucht. Das dritte Kapitel widmet sich der Darstellung von Frauen in der BRD im Roman „Tauben im Gras“ von Wolfgang Koeppen. Hier werden die verschiedenen Frauenfiguren und ihre Lebensumstände in der Nachkriegszeit betrachtet. Das vierte Kapitel stellt einen Vergleich der beiden Frauenbilder in der DDR und der BRD auf und beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Lebenserfahrungen. Im fünften Kapitel wird die Rezeption der beiden Werke in Ost und West betrachtet und die Rolle der Kritik in der jeweiligen Gesellschaft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Frauenbild, DDR, BRD, Christa Wolf, Wolfgang Koeppen, „Was bleibt“, „Tauben im Gras“, Observation, Kontrolle, Abhängigkeit, Freiheit, Rezeption, Literaturkritik.
Häufig gestellte Fragen
Welche literarischen Werke werden in diesem Vergleich herangezogen?
Verglichen werden Wolfgang Koeppens Roman „Tauben im Gras“ (BRD) und Christa Wolfs Erzählung „Was bleibt“ (DDR).
Wie wirkt sich die Stasi-Observation auf das Frauenbild in der DDR aus?
In Wolfs Erzählung prägt die ständige Überwachung durch die Stasi die Ängste und das isolierte Handeln der Protagonistin maßgeblich.
Welche Unterschiede gibt es bei der Abhängigkeit der Frauen in Ost und West?
In Koeppens Werk (BRD) ist eine wesentlich größere Abhängigkeit der Frauen von Männern erkennbar, während die DDR-Protagonistin eher mit politischem Druck kämpft.
Spiegeln die Frauenbilder die jeweiligen politischen Systeme wider?
Ja, die Arbeit zeigt auf, wie die Charaktere und ihr Verhalten mit den gesellschaftlichen und politischen Zwängen der DDR bzw. der BRD korrespondieren.
Wie war die Rezeption der Werke in den beiden deutschen Staaten?
Die Arbeit analysiert die teilweise sehr unterschiedliche Literaturkritik und Wahrnehmung der Texte in Ost- und Westdeutschland.
- Citation du texte
- Anastasia Wolter (Auteur), 2012, Literarische Frauenbilder in der DDR und BRD. Ein Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286758