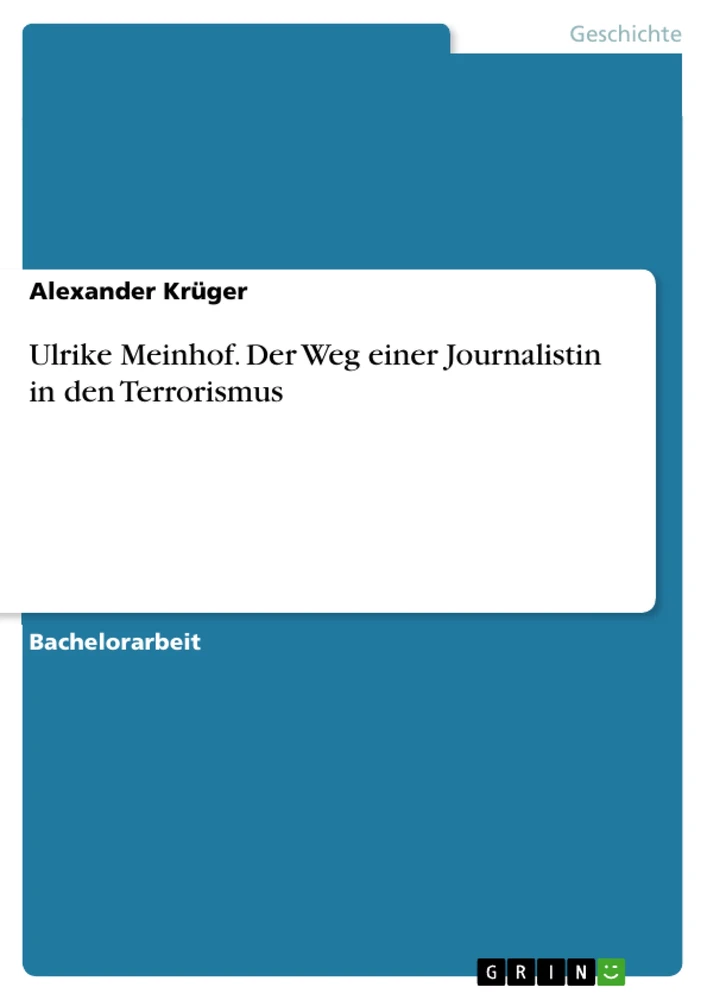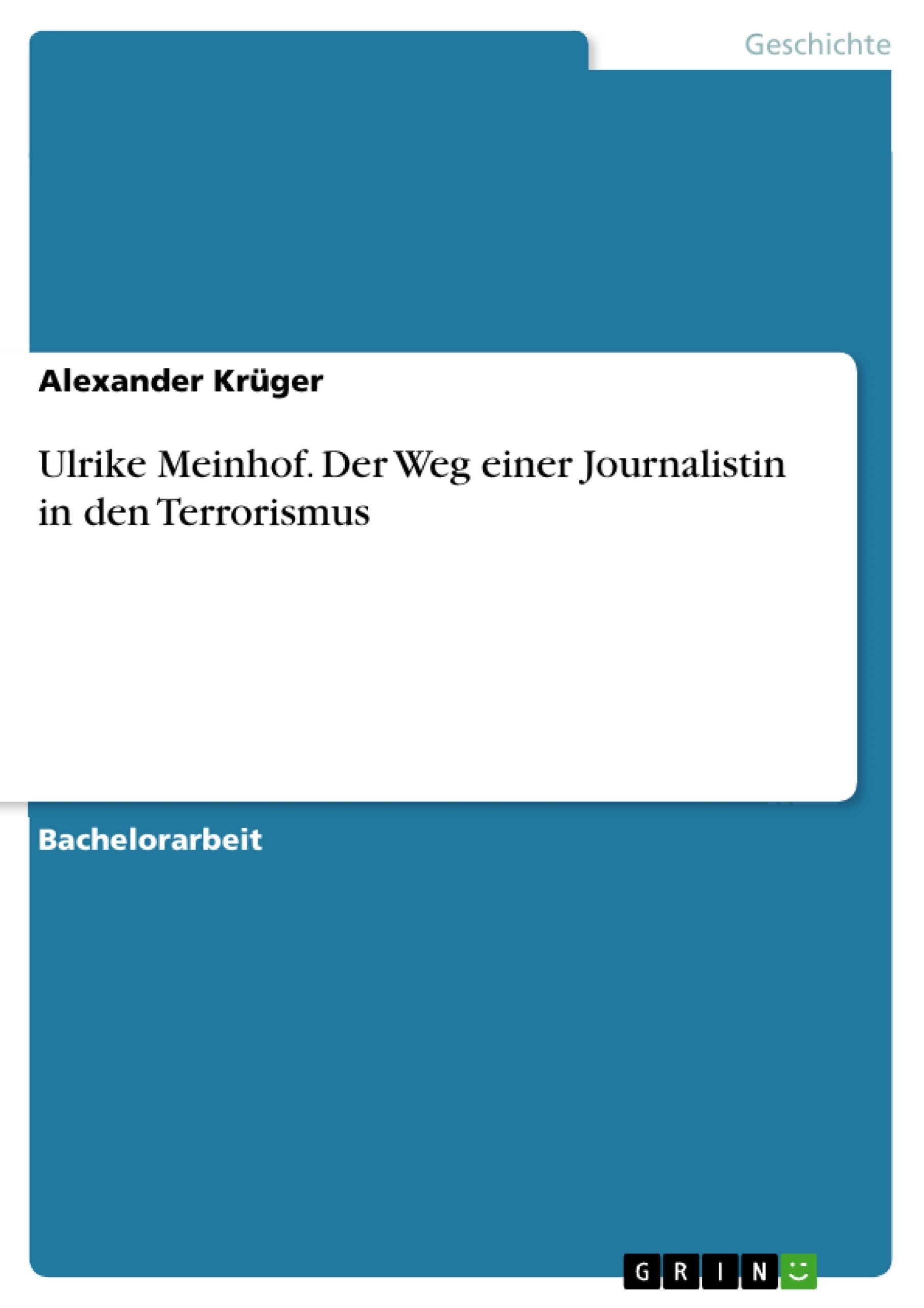Wie kann es passieren, dass die Mutter zweier Kinder in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland keine andere Wahl für ihr Leben sieht, als in den terroristischen Untergrund zu gehen, bzw. ihn mit zu gründen? Welche Komponenten müssen zusammengekommen sein, um einen rational denkenden, sich zum Pazifismus bekennenden Menschen die Worte aussprechen zu lassen: "…natürlich darf geschossen werden."
Um die Entstehung und Entwicklung dieser Ambivalenz beurteilen zu können, bedarf es einer ganzheitlichen Betrachtung des Lebens der Ulrike Meinhof. Beginnend mit dem Elternhaus, den frühen schweren Verlusten in ihrer Kindheit, dem Aufwachsen mit einer Pflegemutter, über ihre Studienzeit, das Engagement gegen Wiederbewaffnung und Atomrüstung bis hin zu ihrer Karriere als Chefredakteurin von "konkret" .
Einen Anteil trägt auch ihr Privatleben, in erster Linie die Beziehung zu Klaus Maria Röhl und ganz wesentlich ist die Einordnung des Menschen Ulrike Meinhof in den jeweiligen zeitlichen und politischen Kontext. Ohne die Zusammenhänge mit der deutschen Geschichte darzustellen, wäre es nicht möglich Ulrike Meinhofs Reaktionen und Entscheidungen zu bewerten.
Im letzten Teil der Hausarbeit werde ich der Frage nachgehen ob es eine stetige Entwicklung in ihrem Leben gab, die zwangsläufig im Terrorismus endete oder es einen alles bestimmenden Auslöser gab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Familiärer Hintergrund
- Studienzeit in Marburg
- Studienzeit in Münster oder "Kampf dem Atomtod"
- Kommunistin-Eintritt in die KPD
- Beginn einer Journalistischen Karriere
- Chefredakteurin
- Notstandsgesetze
- Rotbuch II und DFU
- "Hitler in Euch"
- Hochzeit
- 1. Mai-Kundgebung und die Neue Linke
- Probleme mit dem Arbeitgeber
- Geburt und Hirntumor
- Die deutsche Vergangenheitsbewältigung
- Hörfunk-Ein neues Medium
- Der Schah und Benno Ohnesorg
- Rudi Dutschke
- Gewalt in der Diskussion. . .
- Ein Kaufhausbrand und seine Folgen
- Gefangenenbefreiung oder der Anfang vom Ende
- Rote Armee Fraktion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert das Leben von Ulrike Meinhof, einer prominenten Persönlichkeit der deutschen linken Szene, die eine zentrale Rolle in der Entstehung der Rote Armee Fraktion (RAF) spielte. Das Ziel ist es, die Entwicklung ihrer politischen und persönlichen Überzeugungen zu verstehen, die sie letztendlich zu einer aktiven Teilnehmerin des bewaffneten Kampfes führten.
- Die frühen Einflüsse auf Ulrike Meinhofs Weltbild, insbesondere die Erfahrungen in ihrer Familie und während ihrer Studienzeit.
- Ihr Engagement in der studentischen und politischen Bewegung, ihr Aufstieg zur Chefredakteurin der linken Zeitschrift "konkret" und ihre Rolle im Kampf gegen Atomrüstung.
- Die Eskalation der politischen Auseinandersetzungen und die Radikalisierung der linken Szene in den 1960er und 1970er Jahren.
- Die Rolle der Medien und der öffentlichen Meinung in der Auseinandersetzung mit dem Terrorismus.
- Die Frage nach der Verbindung zwischen Meinhofs persönlicher Entwicklung und ihrem Engagement in der RAF.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie konnte Ulrike Meinhof, eine Mutter und selbst erklärte Pazifistin, in den Terrorismus abdriften? Der Text skizziert den Ansatz, Meinhofs Leben in seinen politischen und gesellschaftlichen Kontext einzubinden, um ihre Entwicklung und Entscheidungen nachvollziehen zu können.
- Familiärer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die prägenden Erfahrungen von Ulrike Meinhof in ihrer Kindheit und Jugend. Es thematisiert den frühen Tod ihres Vaters, das Aufwachsen mit ihrer Pflegemutter und die Herausforderungen, die diese Konstellation mit sich brachte.
- Studienzeit in Marburg: Dieses Kapitel beleuchtet Meinhofs Studienzeit in Marburg und die ersten Schritte ihrer politischen Aktivität. Es beschreibt ihre Auseinandersetzung mit linken Ideen und ihr Engagement in der Studentenbewegung.
- Studienzeit in Münster oder "Kampf dem Atomtod": Dieses Kapitel befasst sich mit Meinhofs Studienzeit in Münster und ihrem Engagement gegen Atomrüstung. Es schildert ihre wachsende Radikalisierung und ihren Eintritt in die KPD.
- Kommunistin-Eintritt in die KPD: Dieses Kapitel beleuchtet Meinhofs Eintritt in die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) und die Entwicklung ihrer politischen Überzeugungen. Es beschreibt ihre Rolle innerhalb der Partei und ihre Auseinandersetzung mit der Politik der DDR.
- Beginn einer Journalistischen Karriere: Dieses Kapitel schildert die Anfänge von Ulrike Meinhofs journalistischen Karriere und ihre Arbeit bei verschiedenen Zeitungen. Es beschreibt ihre ersten Erfolge und ihre wachsende Bekanntheit in der linken Szene.
- Chefredakteurin: Dieses Kapitel befasst sich mit Meinhofs Zeit als Chefredakteurin der linken Zeitschrift "konkret" und ihren Beiträgen zur politischen Debatte. Es beschreibt ihre Auseinandersetzung mit den Notstandsgesetzen und ihre Rolle im Kampf gegen den Vietnamkrieg.
- Notstandsgesetze: Dieses Kapitel beleuchtet Meinhofs Kritik an den Notstandsgesetzen und ihre Auseinandersetzung mit der Politik der Bundesrepublik Deutschland. Es beschreibt ihre Rolle in der linken Opposition und ihre Bemühungen um eine demokratische Kontrolle des Staates.
- Rotbuch II und DFU: Dieses Kapitel beschreibt Meinhofs Arbeit am "Rotbuch II" und ihre Zusammenarbeit mit der Deutschen Friedensunion (DFU). Es zeigt ihre Kritik an der westdeutschen Politik und ihre Ideen für einen alternativen Gesellschaftsentwurf.
- "Hitler in Euch": Dieses Kapitel thematisiert Meinhofs Artikel "Hitler in Euch" und die damit verbundene Kontroverse. Es beleuchtet ihre Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und ihre Kritik am Umgang mit der NS-Vergangenheit.
- Hochzeit: Dieses Kapitel beschreibt Meinhofs Hochzeit mit Klaus Maria Röhl und die Herausforderungen dieser Beziehung. Es beleuchtet den Einfluss von Röhls politischen Ideen auf Meinhof und die Spannungen zwischen ihrem persönlichen und politischen Leben.
- 1. Mai-Kundgebung und die Neue Linke: Dieses Kapitel thematisiert Meinhofs Rolle bei der 1. Mai-Kundgebung in Berlin 1967 und die damit verbundenen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Es zeigt ihren Wandel zur Aktionsform der Neuen Linken.
- Probleme mit dem Arbeitgeber: Dieses Kapitel beschreibt die Schwierigkeiten, die Meinhof in ihrer journalistischen Arbeit erlebte, und die Konflikte mit ihren Arbeitgebern. Es beleuchtet die zunehmende Zensur und die Diskriminierung linker Journalistinnen und Journalisten.
- Geburt und Hirntumor: Dieses Kapitel befasst sich mit Meinhofs Schwangerschaft und der Geburt ihres Sohnes, sowie ihrem Kampf gegen einen Hirntumor. Es beschreibt ihre Erfahrungen als Mutter und ihre Auseinandersetzung mit Krankheit und Tod.
- Die deutsche Vergangenheitsbewältigung: Dieses Kapitel beleuchtet Meinhofs kritischen Blick auf die deutsche Vergangenheitsbewältigung und ihre Kritik an der Rolle der Medien in der NS-Zeit. Es zeigt ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Schuld und Vergebung.
- Hörfunk-Ein neues Medium: Dieses Kapitel beschreibt Meinhofs Arbeit im Hörfunk und ihre Auseinandersetzung mit diesem neuen Medium. Es zeigt ihre Bemühungen um eine kritische Berichterstattung und ihre Kritik an der Rolle des Rundfunks in der Gesellschaft.
- Der Schah und Benno Ohnesorg: Dieses Kapitel thematisiert Meinhofs Rolle bei der Protestaktion gegen den Besuch des Schahs von Persien in Berlin 1967 und die damit verbundene Ermordung von Benno Ohnesorg. Es beleuchtet ihren wachsenden Einfluss auf die Studentenbewegung und ihre Positionierung im Kampf gegen die politische Repression.
- Rudi Dutschke: Dieses Kapitel beschreibt Meinhofs Beziehung zu Rudi Dutschke, einem prominenten Studentenführer, und ihr Engagement für die Studentenbewegung. Es beleuchtet ihre Unterstützung für Dutschkes Ideen und ihre Kritik an der etablierten Politik.
- Gewalt in der Diskussion. . .: Dieses Kapitel thematisiert die wachsende Debatte über Gewalt in der Studentenbewegung und Meinhofs Position in dieser Auseinandersetzung. Es zeigt ihre Kritik an der politischen Repression und ihre Auseinandersetzung mit der Frage nach der Legitimität von Gewalt.
- Ein Kaufhausbrand und seine Folgen: Dieses Kapitel beschreibt den Kaufhausbrand in Frankfurt am Main 1968 und Meinhofs Rolle in den anschließenden Auseinandersetzungen. Es beleuchtet die wachsende Radikalisierung der Studentenbewegung und die Folgen für Meinhofs eigene politische Haltung.
- Gefangenenbefreiung oder der Anfang vom Ende: Dieses Kapitel befasst sich mit Meinhofs Rolle bei der Befreiung von Gefangenen und die Auswirkungen dieses Ereignisses auf ihr Leben und ihre politische Karriere. Es zeigt die Folgen ihrer Aktionen für ihre eigene Sicherheit und die Eskalation der politischen Situation in der Bundesrepublik.
- Rote Armee Fraktion: Dieses Kapitel beleuchtet Meinhofs Beteiligung an der Gründung der Rote Armee Fraktion (RAF) und ihre Rolle innerhalb dieser Terrororganisation. Es beschreibt ihre Motivationen und ihre Ziele, sowie die Konsequenzen ihrer Entscheidungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der politischen Radikalisierung in der Bundesrepublik Deutschland, der Rolle der Medien und der öffentlichen Meinung in der Auseinandersetzung mit Terrorismus, sowie der Verbindung zwischen individueller Biographie und politischem Engagement. Insbesondere werden die Themengebiete "Ulrike Meinhof", "RAF", "Terrorismus", "Studentenbewegung", "linke Politik", "Medien", "Vergangenheitsbewältigung" und "deutsche Geschichte" im Fokus stehen.
- Arbeit zitieren
- Alexander Krüger (Autor:in), 2014, Ulrike Meinhof. Der Weg einer Journalistin in den Terrorismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286993