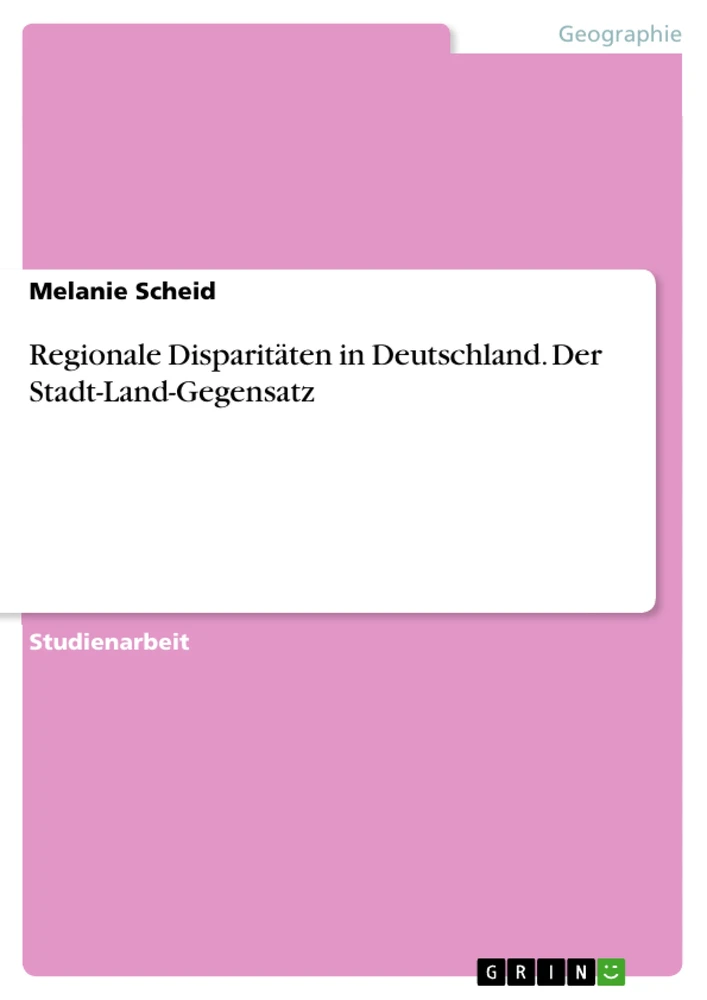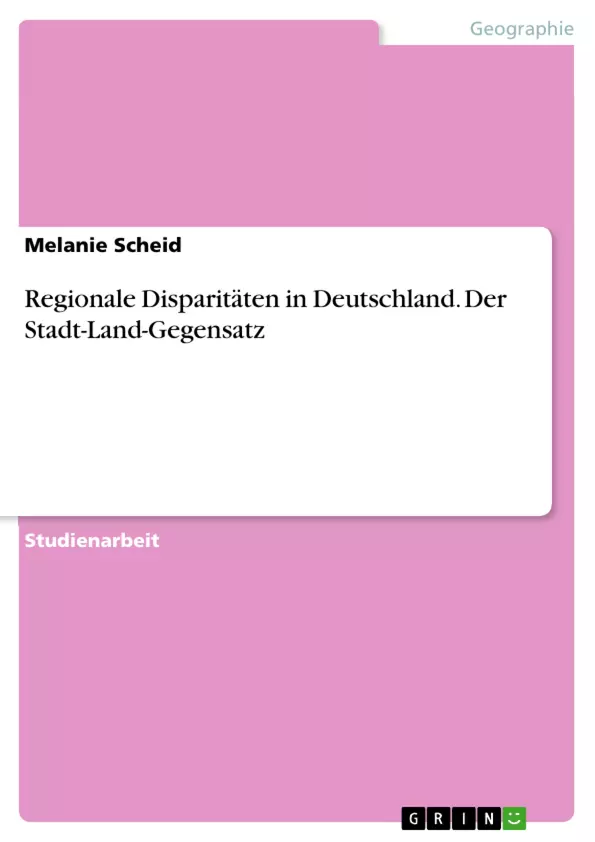„Die Schaffung und Erhaltung gleichwertiger regionaler Lebensverhältnisse ist eine Gerechtigkeitsnorm. Sie dient der Chancengleichheit der Bürger und soll durch den Abbau regionaler Disparitäten erreicht werden“.
Daher stellt der Abbau regionaler Disparitäten ein wichtiges Ziel raumbezogener Politik und Planung dar. Entsprechend sind die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen und der Ausgleich der räumlichen und strukturellen Ungleichgewichte zwischen den bis zur deutschen Einheit getrennten Gebieten als wichtige Leitvorstellungen raumordnerischen Handelns in mehreren Gesetzen festgelegt.
Regionale Disparitäten äußern sich in sehr unterschiedlichen Mustern. Dabei gelten die Unterschiede zwischen Stadt und Land bereits als „traditionell“ (vgl. MARETZKE 2006, S. 473), denn „Stadt und Land werden im Zuge beginnender Verstädterung und Industrialisierung und des heraufkommenden Sozialismus im 19. Jahrhundert zur gängigen Formel, ja zum Inbegriff der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Konfrontation der beiden großen Bereiche des sozialen Raumes“ (PLANK/ZICHE 1979 zit. nach SCHWEPPE 2000, S. 59). Und auch heute sind hier noch immer deutliche Disparitäten zu erkennen, wie die nachfolgende Untersuchung zeigen wird.
Kapitel 2, das den Begriff Disparität definiert sowie die gesetzlichen Grundlagen zum Abbau regionaler Disparitäten darlegt, und Kapitel 3, welches Definitionsversuche des städtischen und des ländlichen Raumes näher betrachtet, sollen eine Einführung in die Thematik Stadt-Land-Gegensatz liefern.
Kapitel 4 untersucht anschließend gezielt wesentliche Disparitäten zwischen Stadt und Land.
Wichtige Potenzialfaktoren, die die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit einer Region entscheidend beeinflussen, sind „die Ausstattung einer Region mit ‚klassischen‘ Produktionsfaktoren wie Sach- und Humankapital, die sektorale Wirtschaftsstruktur, die Innovationskapazität […], das Marktpotenzial bzw. die geographische Standortgunst und die öffentliche Infrastruktur und Existenz von Agglomerationsvorteilen in Form von Lokalisations- und/oder Urbanisierungsvorteilen“ (MARETZKE 2006, S. 473).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Begriffsdefinition „Disparität“
- 2.2 Gesetzliche Grundlagen
- 2.3 Formen räumlicher Disparitäten in Deutschland
- 3 Stadt und Land - ein Definitionsversuch
- 3.1 Modell der Stadt-Land-Dichotomie
- 3.2 Definition Stadt
- 3.2.1 Definition Stadt
- 3.2.2 Definition ländlicher Raum
- 3.2.3 Stadt-Land-Gegensatz
- 4 Stadt-Land-Gegensatz
- 4.1 Maße zu Stadt-Land-Unterschieden
- 4.2 Wirtschaftsstruktur
- 4.2.1 Arbeitslosigkeit
- 4.2.2 Nutzung städtischer bzw. ländlicher Räume
- 4.3 Bevölkerung
- 4.3.1 Bevölkerungsstruktur
- 4.3.2 Bevölkerungsentwicklung
- 4.4 Infrastruktur und Verkehr
- 4.4.1 Infrastruktur
- 4.4.2 Konzentration von Einrichtungen der Daseinsvorsorge
- 4.4.3 Verkehr
- 4.5 Zusammenfassendes Raumbeispiel Mecklenburg-Vorpommern
- 5 Fazit
- 6 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht regionale Disparitäten in Deutschland, insbesondere den Stadt-Land-Gegensatz. Ziel ist es, die bestehenden Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Räumen zu analysieren und aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen zum Abbau solcher Disparitäten und definiert die verwendeten Begriffe.
- Definition und Abgrenzung von städtischen und ländlichen Räumen
- Analyse der wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Stadt und Land (z.B. Arbeitslosigkeit, Wirtschaftsstruktur)
- Untersuchung demografischer Unterschiede (Bevölkerungsstruktur und -entwicklung)
- Betrachtung infrastruktureller Unterschiede (Verkehr, Daseinsvorsorge)
- Fallbeispiel Mecklenburg-Vorpommern zur Veranschaulichung der Disparitäten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der regionalen Disparitäten in Deutschland ein und betont die Bedeutung des Abbaus dieser Ungleichgewichte für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Sie verweist auf die gesetzliche Verankerung dieses Ziels und stellt den Stadt-Land-Gegensatz als traditionellen und weiterhin relevanten Aspekt regionaler Disparitäten dar. Die Arbeit kündigt die folgenden Kapitel an, die eine Definition von Disparitäten, Definitionsversuche von Stadt und Land und schließlich eine Analyse der relevanten Disparitäten zwischen diesen Räumen liefern sollen. Die Einleitung betont die Relevanz von Produktionsfaktoren wie Humankapital und Infrastruktur für die regionale Entwicklung.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die grundlegenden Definitionen und gesetzlichen Grundlagen für das Verständnis der Thematik. Es definiert den Begriff „Disparität“ präzise und erläutert die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Ziele der Politik zur Reduzierung regionaler Ungleichgewichte. Es wird auf die historische Entwicklung des Stadt-Land-Gegensatzes als Ausdruck politischer, sozialer und wirtschaftlicher Konfrontation eingegangen und der Zusammenhang mit der Verstädterung und Industrialisierung hergestellt. Das Kapitel schafft so eine fundierte Basis für die folgende Analyse der Disparitäten.
3 Stadt und Land - ein Definitionsversuch: Dieses Kapitel widmet sich verschiedenen Definitionsansätzen für städtische und ländliche Räume. Es präsentiert unterschiedliche Modelle zur Darstellung der Stadt-Land-Dichotomie und analysiert deren Vor- und Nachteile. Das Kapitel diskutiert kritisch die Herausforderungen bei der Abgrenzung dieser Räume und liefert letztendlich eine Arbeitsdefinition, die für die nachfolgende Analyse verwendet wird. Es behandelt die komplexen und oftmals überlappenden Merkmale beider Raumtypen.
4 Stadt-Land-Gegensatz: Kapitel 4 bildet den Kern der Arbeit und untersucht verschiedene wesentliche Disparitäten zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Es analysiert die Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur (Arbeitslosigkeit, Nutzung der Räume), der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung sowie der Infrastruktur und des Verkehrs. Die Analyse vergleicht quantitative Daten und beleuchtet die Ursachen der Ungleichgewichte. Das Kapitel verwendet den Faktor Arbeitslosigkeit als einen Indikator und stellt unterschiedliche Faktoren, wie z.B. Agglomerationsvorteile und die Ausstattung mit Produktionsfaktoren, einander gegenüber. Das Raumbeispiel Mecklenburg-Vorpommern dient als empirische Illustration der theoretischen Überlegungen. Hier werden die zuvor analysierten Disparitäten anhand von konkreten Zahlen und Beispielen verdeutlicht, weshalb das Kapitel einen wichtigen Beitrag zur Gesamtanalyse leistet.
Schlüsselwörter
Regionale Disparitäten, Stadt-Land-Gegensatz, Deutschland, Wirtschaftsstruktur, Arbeitslosigkeit, Bevölkerungsentwicklung, Infrastruktur, Daseinsvorsorge, Raumordnung, Regionalpolitik, Mecklenburg-Vorpommern.
Häufig gestellte Fragen zu: Regionale Disparitäten in Deutschland - Stadt-Land-Gegensatz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht regionale Disparitäten in Deutschland, mit einem Schwerpunkt auf dem Stadt-Land-Gegensatz. Sie analysiert die Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Räumen in Bezug auf Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur und beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen zum Abbau solcher Ungleichheiten.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition von „Disparität“, die gesetzlichen Grundlagen zur Reduzierung regionaler Ungleichgewichte, verschiedene Definitionsansätze für Stadt und Land, eine Analyse wirtschaftlicher Unterschiede (Arbeitslosigkeit, Wirtschaftsstruktur), eine Untersuchung demografischer Unterschiede (Bevölkerungsstruktur und -entwicklung), eine Betrachtung infrastruktureller Unterschiede (Verkehr, Daseinsvorsorge) und ein Fallbeispiel Mecklenburg-Vorpommern zur Veranschaulichung der Disparitäten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen, ein Kapitel zu den Definitionsansätzen von Stadt und Land, ein Hauptkapitel zur Analyse des Stadt-Land-Gegensatzes mit Fokus auf Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Das Kapitel zum Stadt-Land-Gegensatz enthält ein ausführliches Raumbeispiel Mecklenburg-Vorpommern.
Welche Definitionen werden verwendet?
Die Arbeit liefert eine präzise Definition von „Disparität“ und diskutiert verschiedene Modelle und Ansätze zur Definition von städtischen und ländlichen Räumen. Sie präsentiert die Vor- und Nachteile verschiedener Definitionsansätze und legt schließlich eine Arbeitsdefinition fest, die für die weitere Analyse verwendet wird.
Welche Daten und Methoden werden verwendet?
Die Arbeit analysiert quantitative Daten, um die Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen aufzuzeigen. Die Arbeitslosigkeit wird als Indikator verwendet und verschiedene Faktoren wie Agglomerationsvorteile und die Ausstattung mit Produktionsfaktoren werden verglichen. Das Raumbeispiel Mecklenburg-Vorpommern illustriert die theoretischen Überlegungen mit konkreten Zahlen und Beispielen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet die bestehenden Disparitäten zwischen städtischen und ländlichen Räumen in Deutschland. Es wird auf die Bedeutung des Abbaus dieser Ungleichgewichte für gleichwertige Lebensverhältnisse hingewiesen. (Der genaue Inhalt des Fazits ist nicht in der Zusammenfassung der Kapitel explizit genannt.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Regionale Disparitäten, Stadt-Land-Gegensatz, Deutschland, Wirtschaftsstruktur, Arbeitslosigkeit, Bevölkerungsentwicklung, Infrastruktur, Daseinsvorsorge, Raumordnung, Regionalpolitik, Mecklenburg-Vorpommern.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten, Planer und Politiker, die sich mit regionalen Disparitäten, Raumordnung und Regionalpolitik in Deutschland befassen. Sie bietet einen umfassenden Überblick über die Thematik und liefert detaillierte Analysen der Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Räumen.
- Citation du texte
- Bachelor of Arts Melanie Scheid (Auteur), 2014, Regionale Disparitäten in Deutschland. Der Stadt-Land-Gegensatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287015