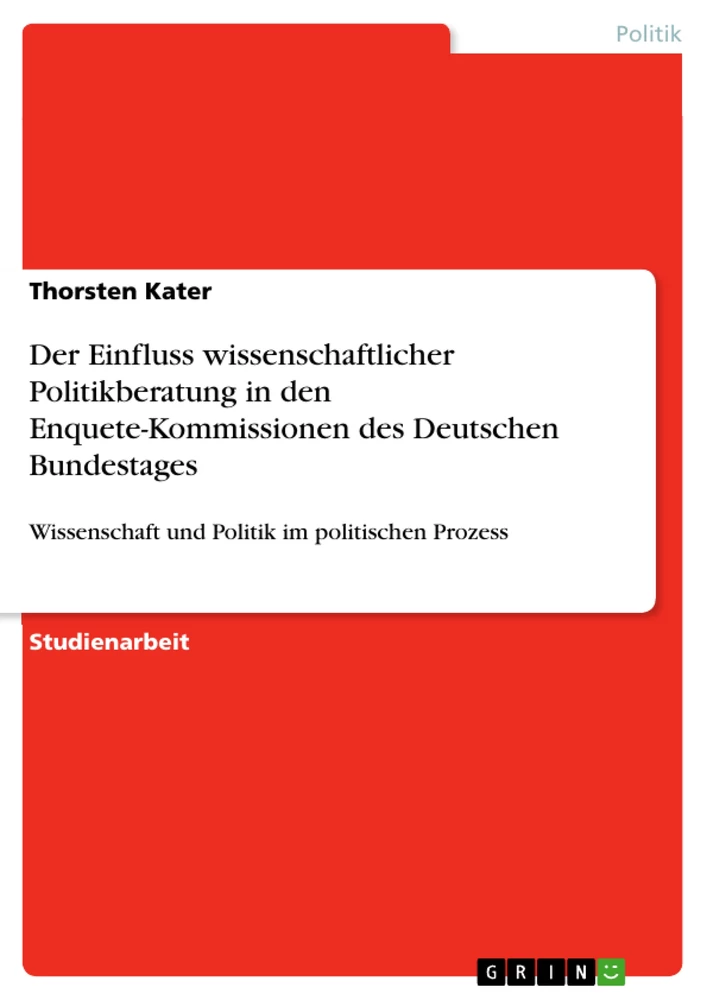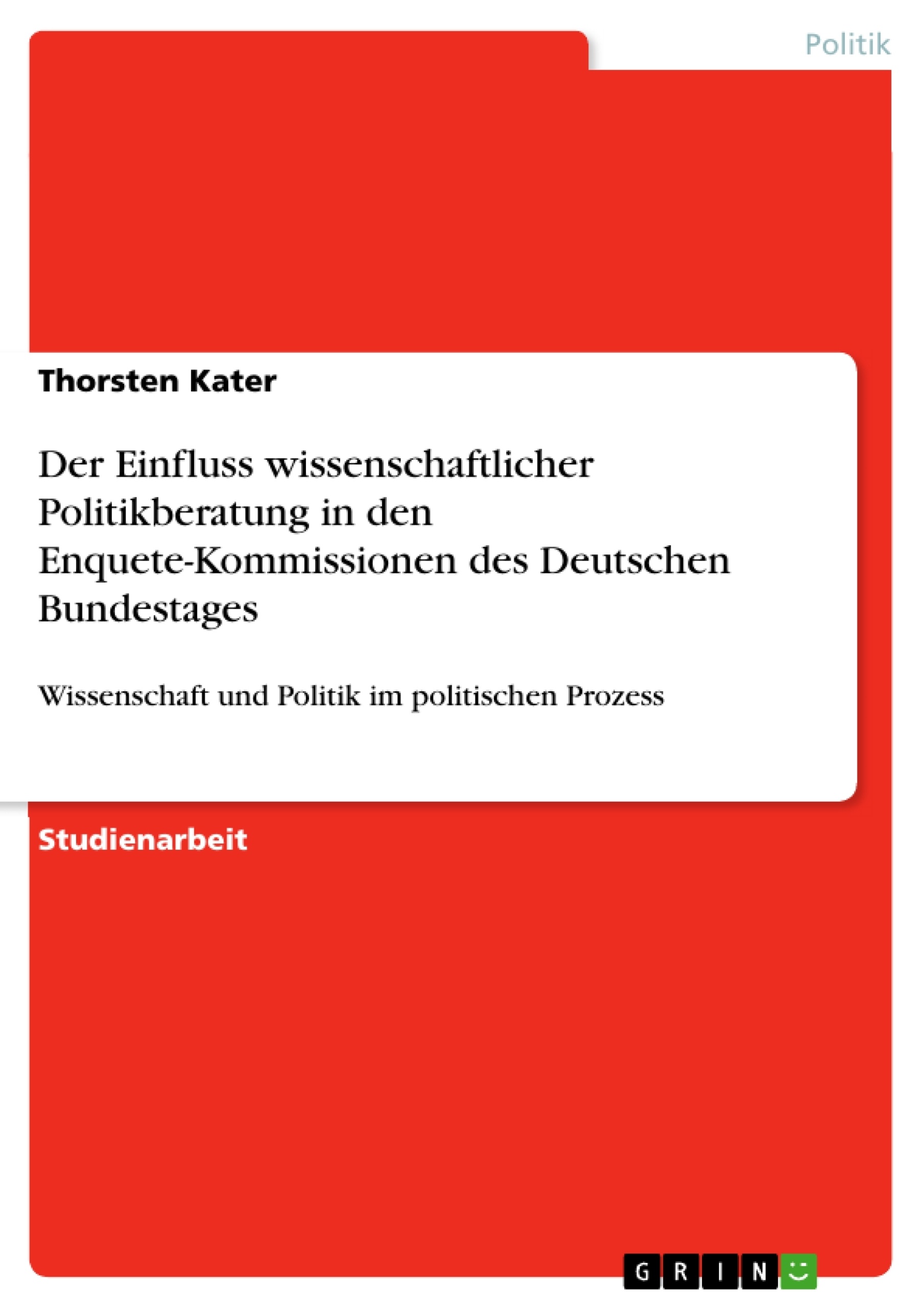Die Anzahl an Kommissionen und Expertengremien im politischen Prozess nehmen stetig zu. Die Kopplung zwischen Politik und Wissenschaft scheint so eng verbunden zu sein, dass sich zwangsläufig die Frage stellt: Wie groß ist der Einfluss von Wissenschaftlern und Experten in solch einem Gremium, oder sogar auf Gesetzesentscheidungen? Anhand der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages lässt sich der Konflikt zwischen Politik und Wissenschaft besonders gut rekonstruieren. Politiker, Wissenschaftler und Experten arbeiten gemeinsam in der Kommission an bedeutenden Politikfeldern. Doch arbeiten sie in der Kommission wirklich gemeinsam? Welche Reibungspunkte lassen sich zwischen beiden Akteuren identifizieren? Nicht ohne Grund gehört die Enquete Kommission „mittlerweile zu den spektakulärsten Einrichtungen der Politikberatung.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Politikberatung - Zwischen Wissenschaft und Politik
- Formen der Politikberatung
- Wissenschaft und Politik im Konflikt
- Die Enquete Kommissionen des Deutschen Bundestages
- Zusammensetzung
- Arbeitsorganisation und Arbeitsweise
- Einfluss wissenschaftlicher Politikberatung in den Enquete Kommissionen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss wissenschaftlicher Politikberatung in den Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages. Sie analysiert das Verhältnis von Wissenschaft und Politik im Kontext der Politikberatung und beleuchtet die unterschiedlichen Formen und Modelle der Politikberatung. Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle und den Einfluss von Wissenschaftlern in den Enquete-Kommissionen zu erforschen und die Herausforderungen und Konflikte zwischen Wissenschaft und Politik in diesem Kontext zu beleuchten.
- Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik im Kontext der Politikberatung
- Die unterschiedlichen Formen und Modelle der Politikberatung
- Die Rolle und der Einfluss von Wissenschaftlern in den Enquete-Kommissionen
- Die Herausforderungen und Konflikte zwischen Wissenschaft und Politik in den Enquete-Kommissionen
- Die Legitimität und die Grenzen des Einflusses wissenschaftlicher Politikberatung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss wissenschaftlicher Politikberatung in den Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages vor und erläutert die Relevanz des Themas. Sie beleuchtet den Konflikt zwischen Politik und Wissenschaft, der sich in diesen Kommissionen besonders deutlich zeigt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Politik im Kontext der Politikberatung. Es werden verschiedene Formen der Politikberatung vorgestellt, darunter das dezisionistische, das technokratische und das pragmatische Modell. Die jeweiligen Vor- und Nachteile der Modelle werden diskutiert, wobei insbesondere die Legitimationsprobleme im Fokus stehen.
Das dritte Kapitel widmet sich den Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages. Es werden die Zusammensetzung, die Arbeitsorganisation und die Arbeitsweise dieser Kommissionen erläutert. Die Rolle von Wissenschaftlern in diesen Gremien wird beleuchtet und die Herausforderungen, die sich aus der Zusammenarbeit von Politikern und Wissenschaftlern ergeben, werden aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die wissenschaftliche Politikberatung, die Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages, das Verhältnis von Wissenschaft und Politik, die unterschiedlichen Formen der Politikberatung, die Legitimation des Einflusses von Wissenschaftlern in politischen Entscheidungsprozessen sowie die Herausforderungen und Konflikte zwischen Wissenschaft und Politik in diesem Kontext.
- Quote paper
- Thorsten Kater (Author), 2014, Der Einfluss wissenschaftlicher Politikberatung in den Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287118