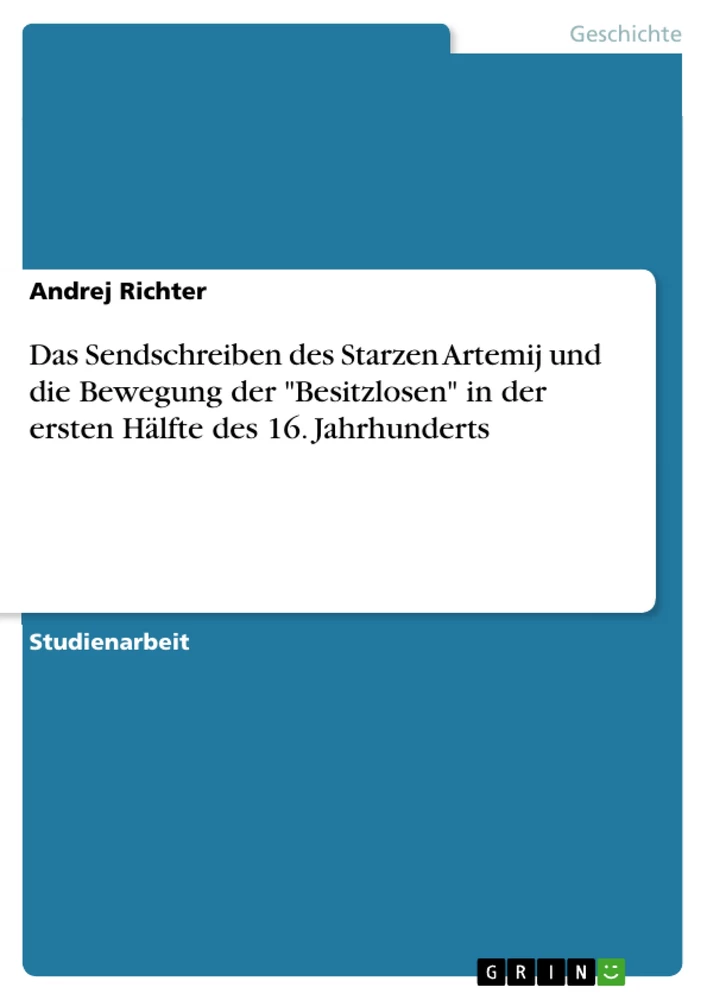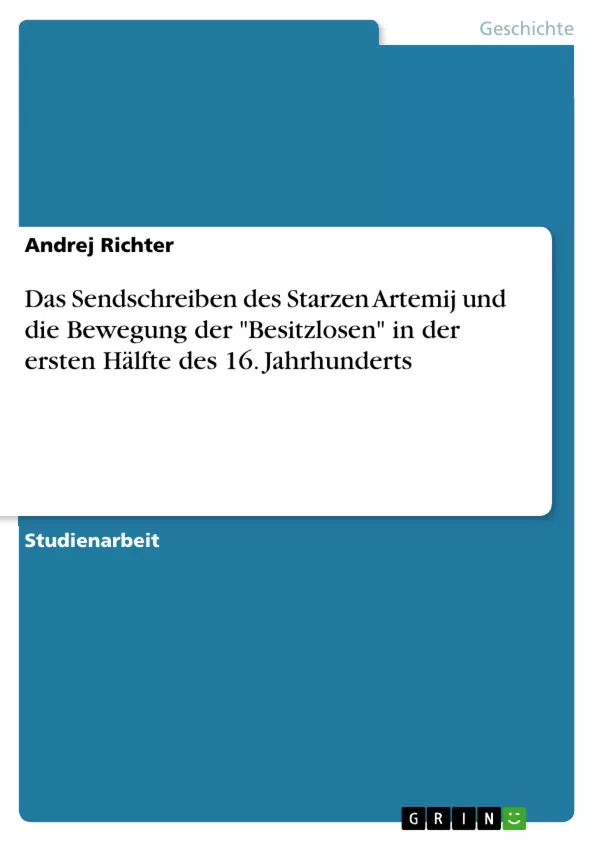Das russländische Imperium erlebte Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts zahlreiche politische und kirchliche Umbrüche. Nachdem sich die Moskauer Metropolie 1448 für faktisch autokephal erklärte und 1480 das tatarische Joch abgeschüttelt war, begann die Erstarkung der russisch-orthodoxen Kirche und des russischen Reichs. In dieser Konsolidierungsphase verflochten sich Staat und Kirche zunehmend. Es entstand aber auch Wettbewerb um Landbesitz zwischen den beiden Parteien. Außerdem bildete sich um die Wende zum 16. Jahrhundert die bis damals größte häretische Erscheinung auf russischem Boden: die Bewegung der Judaisierenden. Und just in diese Zeit fällt die rege publizistische Teilnahme von Vertretern des russischen Mönchtums. Ausgehend von der Epoche des 14. und 15. Jahrhunderts, wo das Mönchtum in Russland seine Blüte erlebt hatte, stritten die geistigen Kräfte um die Zukunft der Kirche, die – laut Onasch – mit den „schwierigsten Problemen der russischen Kirchengeschichte konfrontiert“ war. In diesem Milieu formierten sich zwei Strömungen: die sogenannten „Besitzenden“ sowie die „Besitzlosen“. Einer dieser Mönche in den Reihen der Besitzlosen und „vielleicht […] der letzte ausgebildete Anhänger und Verkünder“ dieser Schule ist der Starze Artemij. Obwohl von einigen Wissenschaftlern als eine „der interessantesten Persönlichkeiten des 16. Jahrhunderts“ bezeichnet und für die russische Kirchen- und Literaturgeschichte kein Unbekannter, ist Artemijs Leben knapp 500 Jahre nach seiner Wirkungszeit immer noch von einer gewissen Mystik umgeben. Das beginnt bereits bei seiner Vita, deren Anfang und Ende sich im Dunkeln verlieren. Des Weiteren erscheint es kontrovers, dass der orthodoxe Mönch Artemij wegen seiner Glaubensanschauung in seiner russischen Heimat von einer Moskauer Synode zu lebenslanger Verbannung unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen verurteilt wurde, jedoch später nach seiner Flucht nach Litauen dort als der „Retter der Orthodoxie“ in die Geschichtsbücher einging.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Themenstellung
- Gang der Untersuchung und Forschungsstand
- Historischer Rahmen
- „Moskau, das Dritte Rom“ und die „Sammlung des Landes“
- Verhältnis zwischen russischem Staat und russischer Kirche
- Starzen-, Asketentum und Häresien in Russland
- Kampf innerhalb der russischen Kirche: Besitzende gegen Besitzlose
- Klerikale Charaktere der damaligen Zeit in Russland
- Nil Sorskij und Josif von Volokolamsk
- Artemij und Daniil
- Sendschreiben Artemijs und seine Verurteilung
- Die Bedeutung der Heiligen Schrift
- Schrift-, Traditions- und Gebotsverständnis
- Artemijs Stellungnahme zu den religiösen Streitfragen seiner Zeit
- Die Verurteilung Artemijs
- Zusammenfassung und Auswirkungen Artemijs Wirken auf die russische Kirche
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Leben und Wirken des Starzen Artemij, einem russischen Mönch der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Sie analysiert seine Schriften und seine Verurteilung durch die Moskauer Synode vor dem Hintergrund der damaligen politischen und kirchlichen Verhältnisse in Russland. Die Arbeit zielt darauf ab, die Ideologie Artemijs zu beleuchten und seine Verknüpfung mit der Bewegung der „Besitzlosen“ zu untersuchen.
- Die Bewegung der „Besitzlosen“ und ihre Bedeutung für die russische Kirche
- Artemijs Ideologie und seine Kritik an der Orthodoxie seiner Zeit
- Die Rolle der Heiligen Schrift in Artemijs Denken
- Die Verurteilung Artemijs und ihre Folgen
- Die Auswirkungen von Artemijs Wirken auf die russische Kirche
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet den historischen Rahmen, in dem Artemij lebte und wirkte. Es werden die Ideen von „Moskau, das Dritte Rom“ und der „Sammlung des Landes“ erläutert, die das Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Russland prägten. Außerdem wird das Starzen- und Asketentum sowie der Kampf zwischen den „Besitzlosen“ und den Anhängern Josifs von Volokolamsk behandelt.
Kapitel 3 stellt die wichtigsten Persönlichkeiten des russischen Klerus der damaligen Zeit vor, darunter Nil Sorskij und Josif von Volokolamsk. Es werden die unterschiedlichen Positionen dieser Mönche in Bezug auf die Rolle der Kirche in der Gesellschaft und die Bedeutung des Besitzes dargestellt.
Kapitel 4 widmet sich den Sendschreiben Artemijs und seiner Ideologie. Es werden seine Ansichten zur Heiligen Schrift, zum Traditions- und Gebotsverständnis sowie zu den religiösen Streitfragen seiner Zeit analysiert. Außerdem wird die Verurteilung Artemijs durch die Moskauer Synode und die Gründe dafür untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Starzen Artemij, die Bewegung der „Besitzlosen“, die russisch-orthodoxe Kirche, die Heilige Schrift, das Traditions- und Gebotsverständnis, die Verurteilung Artemijs, die Moskauer Synode und die Geschichte der russischen Kirche im 16. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Wer war der Starze Artemij?
Artemij war ein einflussreicher russischer Mönch des 16. Jahrhunderts, der der Bewegung der "Besitzlosen" angehörte und später in Litauen als "Retter der Orthodoxie" bekannt wurde.
Was war der Kern des Streits zwischen "Besitzenden" und "Besitzlosen"?
Es ging um die Frage, ob Klöster Land und Reichtum besitzen dürfen. Die "Besitzlosen" (um Nil Sorskij) lehnten dies ab und forderten eine Rückkehr zu asketischen Idealen, während die "Besitzenden" (um Josif von Volokolamsk) den Klosterbesitz verteidigten.
Warum wurde Artemij verurteilt?
Artemij wurde aufgrund seiner Glaubensanschauungen und seiner Kritik an der herrschenden Kirchenhierarchie von einer Moskauer Synode zu lebenslanger Verbannung verurteilt.
Welche Rolle spielte die Heilige Schrift in Artemijs Denken?
Für Artemij hatte die Heilige Schrift eine zentrale Bedeutung; er betonte das individuelle Schriftverständnis gegenüber starren kirchlichen Traditionen.
Was bedeutet der Begriff "Moskau, das Dritte Rom"?
Es ist eine politische und religiöse Theorie, die Moskau nach dem Fall von Konstantinopel als das neue Zentrum des wahren christlichen Glaubens und Nachfolger des Römischen Reiches ansah.
- Quote paper
- Andrej Richter (Author), 2014, Das Sendschreiben des Starzen Artemij und die Bewegung der "Besitzlosen" in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287336