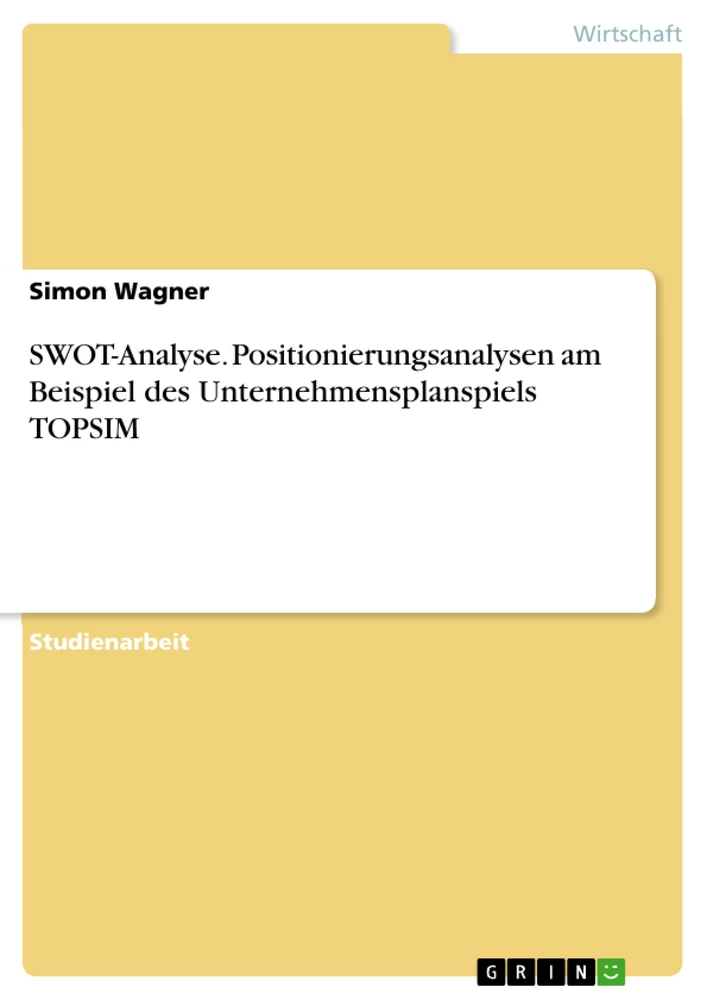Im starken Wettbewerb werden Unternehmen zu professionellen strategischen Entscheidungsfindungen gezwungen, um auf den Märkten zu bestehen und das eigene Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln. Diese Problemstellung, die ständige Positionierung des eigenen Unternehmens im Wettbewerb, wird auch im Unternehmensplanspiel TOPSIM simuliert.
Ein mögliches Instrument zur Positionierungsanalyse des eigenen Unternehmens ist die SWOT-Analyse, die in Relation zu vielen anderen Werkzeugen einfach in der Handhabung und leicht nachzuvollziehen ist. Hierbei können interne und externe Einflussfaktoren mit einbezogen und miteinander in Verbindung gebracht werden, um anschließend geeignete Strategien abzuleiten.
Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, die Vorgehensweise bei der Durchführung einer SWOT-Analyse darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Wichtige Begriffe und Grundlagen
- Die SWOT-Analyse
- Definition des Begriffs „SWOT-Analyse"
- Vorgehensweise bei der SWOT-Analyse
- Kurzbeschreibung des Unternehmensplanspiels TOPSIM
- Praktische Umsetzung im Planspiel TOPSIM, Unternehmen U4
- Positionierungsanalyse nach Periode 1
- Unternehmensinterne Stärken-Schwächen-Analyse
- Unternehmensexterne Chancen-Risiken-Analyse
- Darstellung und Strategieableitung im Portfolio
- Positionierungsanalyse nach Periode 6
- Unternehmensinterne Stärken-Schwächen-Analyse
- Unternehmensexterne Chancen-Risiken-Analyse
- Darstellung und Strategieableitung im Portfolio
- Fazit
- Zusammenfassung
- Kritische Betrachtung der Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die SWOT-Analyse als Instrument zur Positionierungsanalyse von Unternehmen im Wettbewerb. Sie zeigt die Vorgehensweise bei der Durchführung einer SWOT-Analyse auf und illustriert diese anhand des Unternehmensplanspiels TOPSIM. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die praktische Anwendung der SWOT-Analyse im Kontext eines Planspiels zu demonstrieren und die Ergebnisse kritisch zu betrachten.
- Die SWOT-Analyse als Instrument der strategischen Analyse
- Die Anwendung der SWOT-Analyse im Unternehmensplanspiel TOPSIM
- Die Identifizierung von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken im Kontext des Planspiels
- Die Ableitung von Strategien aus der SWOT-Analyse
- Die kritische Bewertung der Ergebnisse der SWOT-Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Positionierung im Wettbewerb dar und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie führt den Leser in die Thematik der SWOT-Analyse ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit.
Das zweite Kapitel widmet sich den wichtigen Begriffen und Grundlagen der SWOT-Analyse. Es definiert den Begriff „SWOT-Analyse" und erläutert die Vorgehensweise bei der Durchführung einer solchen Analyse. Zudem wird das Unternehmensplanspiel TOPSIM kurz vorgestellt.
Im dritten Kapitel wird die praktische Umsetzung der SWOT-Analyse im Planspiel TOPSIM am Beispiel des Unternehmens U4 demonstriert. Es werden die Positionierungsanalysen nach Periode 1 und Periode 6 durchgeführt, wobei die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Unternehmens U4 im Vergleich zum Sieger des Planspiels, Unternehmen U1, analysiert werden. Die Ergebnisse werden in Form von SWOT-Portfolios dargestellt und Strategieableitungen vorgenommen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die SWOT-Analyse, die Positionierungsanalyse, das Unternehmensplanspiel TOPSIM, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken, Strategieableitung und die kritische Betrachtung der Ergebnisse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine SWOT-Analyse?
SWOT steht für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken). Es ist ein Instrument zur strategischen Positionierungsanalyse.
Wie wird die SWOT-Analyse im Planspiel TOPSIM angewendet?
Im Planspiel dient sie dazu, interne Faktoren des eigenen Unternehmens mit externen Marktchancen und -risiken zu verknüpfen, um Wettbewerbsstrategien abzuleiten.
Was ist der Unterschied zwischen internen und externen Faktoren?
Stärken und Schwächen sind unternehmensintern (beeinflussbar), während Chancen und Risiken aus dem Marktumfeld (extern) resultieren.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit mit dem Beispiel „Unternehmen U4“?
Die Arbeit demonstriert die praktische Umsetzung der Analyse nach Periode 1 und Periode 6, um die Entwicklung der Marktpositionierung im Vergleich zum Wettbewerber U1 aufzuzeigen.
Warum ist die SWOT-Analyse ein beliebtes Werkzeug?
Sie ist einfach in der Handhabung, leicht nachvollziehbar und ermöglicht eine schnelle visuelle Darstellung komplexer strategischer Situationen in einem Portfolio.
- Quote paper
- Simon Wagner (Author), 2014, SWOT-Analyse. Positionierungsanalysen am Beispiel des Unternehmensplanspiels TOPSIM, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287542