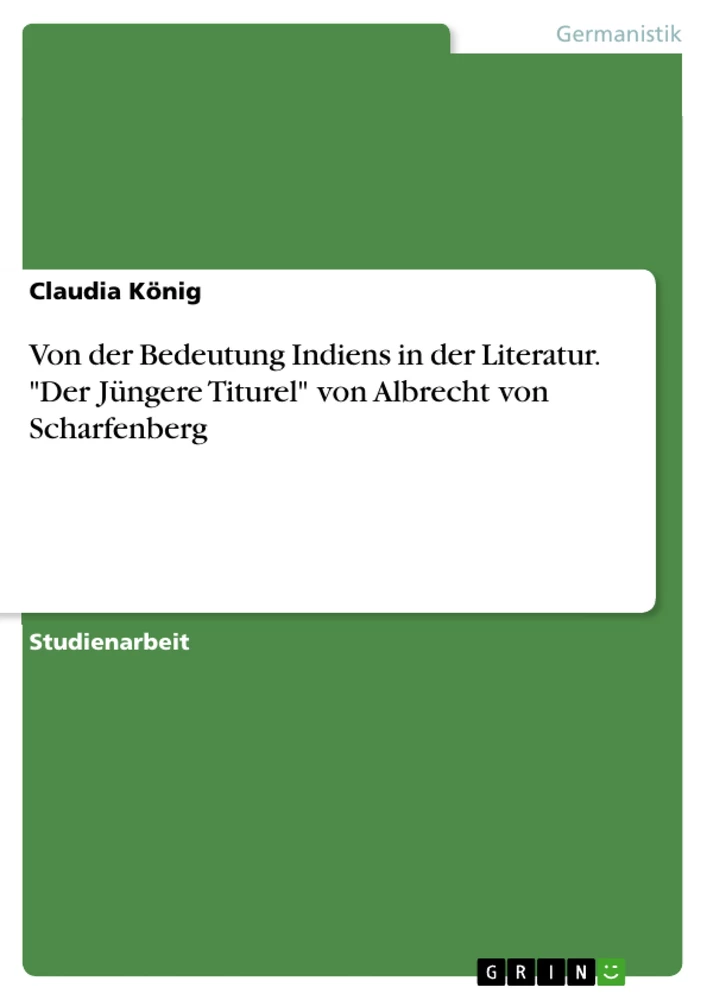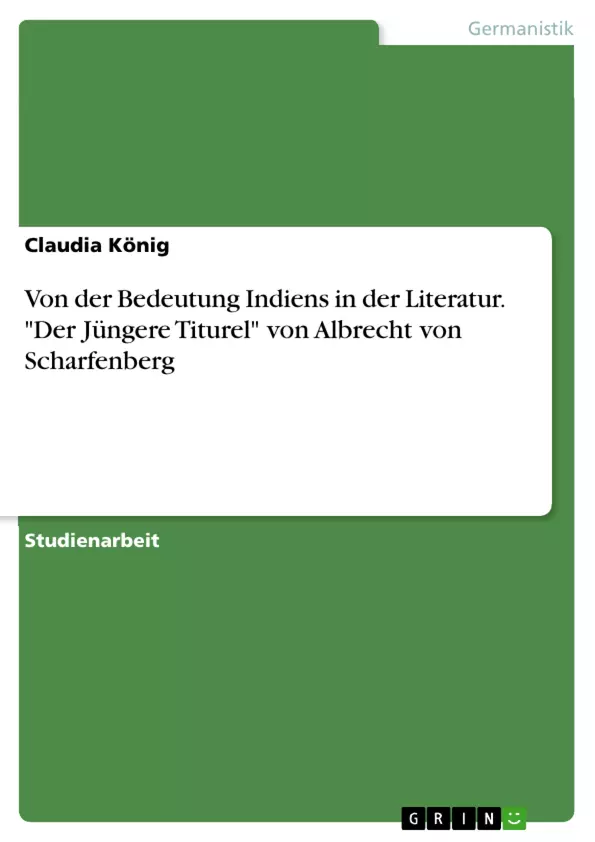Der „Jüngere Titurel“ ist um 1270 entstanden. Wahrscheinlich hat ihn Albrecht von Scharfenberg geschrieben. Albrecht, der wie alle seine Zeitgenossen selbst nie in Indien war, beschreibt im „Jüngeren Titurel“ ein Bild Indiens, das in sich geschlossen und räumlich vorstellbar wird. Niemand wusste wirklich etwas über Indien, dieses Land am Ende der Welt. Alle Informationen, die man zu Zeiten Albrechts hatte, entstammten dem literarisch-tradierten Bildungswissen und den lateinischen oder landessprachlichen Alexanderromanen.
Nicht nur gelehrte Geographen und Kartographen beschäftigten sich mit dem Sammeln und Ausphantasieren von Nachrichten und Gedankenbildern des fernen Orients, die Beschäftigung damit gehörte zum Zeitgeist und war ein prägendes Moment der poetischen Vorstellungswelten. Durch die Kreuzzüge des 12. Jahrhunderts war das Interesse am Orient geweckt worden. Das Scheitern der Kreuzzüge im 13. Jahrhundert zwang zum Nachdenken über die Vergleichbarkeit zwischen Ost und West, weil die Christianisierung im Orient nicht wie geplant verlaufen war. Die Erwartungen und Vorstellungen über den fernen Orient waren mit Ängsten, aber auch mit Hoffnungen verbunden. Auf den Mappae mundi, den Weltkarten des Hohen Mittelalters, ist der Orient fast durchweg die oberste und somit vornehmste Erdregion. Für den mittelalterlichen Menschen war Indien das Land, das an das Paradies grenzte.
Die Zeit, in der Albrecht den „Jüngeren Titurel“ schrieb, war geprägt vom Interregnum, von Kaiser und Gegenkaiser. Nach dem Tod Kaiser Friedrichs II. entzündete sich der Streit zwischen Imperium und Sacerdotium. Das Reich drohte, durch die vereinzelten Machtansprüche der Fürsten zu zerfallen. Es war in zwei Lager gespalten, das eine war für die Gewaltenteilung, das andere für den Papstkaiser. Mit den politischen Wirren wuchs die Sorge um die jenseitige Glückseligkeit, es herrschte Endzeitstimmung.
Die Sehnsüchte der Menschen waren groß, die Kenntnisse gering, und der Phantasie waren beinahe keine Grenzen gesetzt. Albrecht bediente im „Jüngeren Titurel“ diese Sehnsüchte und bot zusätzlich eine Gesamtlösung der Probleme der mittelalterlichen christlichen Welt.
Inhaltsverzeichnis
- Sehnsucht nach Indien
- Albrecht von Scharfenberg und Indien
- Das Indienbild im „Jüngeren Titurel“
- Woher nimmt Albrecht seine, Kenntnisse über Indien?
- Hermann Hesse und Indien
- Indien als Projektion
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Darstellung Indiens im „Jüngeren Titurel“ von Albrecht von Scharfenberg. Sie untersucht, wie der Autor das Bild Indiens als Land der Verheißung und des Ideals in seiner Zeit konstruiert und welche Quellen er dafür nutzt. Die Arbeit vergleicht Albrechts Indienbild mit dem von Hermann Hesse im 20. Jahrhundert, um die Kontinuität und Veränderung der Vorstellung von Indien als Idealland aufzuzeigen.
- Die Bedeutung Indiens als Land der Verheißung im Mittelalter
- Albrechts Quellen und Kenntnisse über Indien
- Die Rolle des Grals und der Gralsangehörigen in Albrechts Werk
- Der Vergleich zwischen Albrechts und Hesses Indienbild
- Die Projektion von Sehnsüchten und Idealen auf Indien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Sehnsucht nach Indien im Mittelalter. Es wird erläutert, wie Indien in der Zeit Albrechts von Scharfenbergs als Land der Verheißung und des Paradieses wahrgenommen wurde. Die Arbeit zeigt auf, dass die Kenntnisse über Indien zu dieser Zeit begrenzt waren und sich hauptsächlich auf literarische Quellen und Überlieferungen stützten. Die Sehnsucht nach Indien wird im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse des Mittelalters betrachtet, die von Unsicherheit und Endzeitstimmung geprägt waren.
Das zweite Kapitel analysiert Albrechts Indienbild im „Jüngeren Titurel“. Es wird gezeigt, wie der Autor Indien als Ort der Reinheit und des Glaubens darstellt, im Gegensatz zu den sündigen Zuständen in Europa. Die Arbeit untersucht die Rolle des Grals und der Gralsangehörigen als Hoffnungsträger und Vermittler der göttlichen Ordnung. Es wird auch auf die Bedeutung der Pilgerreise als Symbol für die Suche nach dem Ideal hingewiesen.
Das dritte Kapitel vergleicht Albrechts Indienbild mit dem von Hermann Hesse im 20. Jahrhundert. Es wird deutlich, dass die Vorstellung von Indien als Idealland auch in der Moderne fortbesteht, jedoch von Hesse entmythologisiert wird. Die Arbeit zeigt auf, wie Hesses Indienbild durch seine persönlichen Erfahrungen und die Romantik geprägt ist, aber auch von einer kritischen Auseinandersetzung mit den Idealen des Orients.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den „Jüngeren Titurel“, Albrecht von Scharfenberg, Indienbild, Mittelalter, Sehnsucht, Idealland, Gral, Gralsangehörige, Hermann Hesse, Entmythologisierung, Projektion, Romantik.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im "Jüngeren Titurel"?
Das Werk von Albrecht von Scharfenberg (um 1270) beschreibt ein idealisiertes Bild Indiens als Land des Grals und der religiösen Reinheit.
Woher stammte das Indienwissen im Mittelalter?
Es basierte nicht auf Reisen, sondern auf literarisch-tradiertem Wissen, Alexanderromanen und phantastischen Gedankenbildern.
Warum war Indien für mittelalterliche Menschen so bedeutsam?
Indien galt als das Land, das unmittelbar an das Paradies grenzte und somit ein Ort höchster Sehnsucht war.
Wie vergleicht die Arbeit Albrecht mit Hermann Hesse?
Beide nutzen Indien als Projektionsfläche für Sehnsüchte, wobei Hesse das Bild im 20. Jahrhundert entmythologisiert.
Welchen Einfluss hatten die Kreuzzüge auf das Orientbild?
Das Scheitern der Kreuzzüge weckte das Interesse am Orient und zwang zum Nachdenken über die Vergleichbarkeit von Ost und West.
- Quote paper
- Claudia König (Author), 2000, Von der Bedeutung Indiens in der Literatur. "Der Jüngere Titurel" von Albrecht von Scharfenberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287586