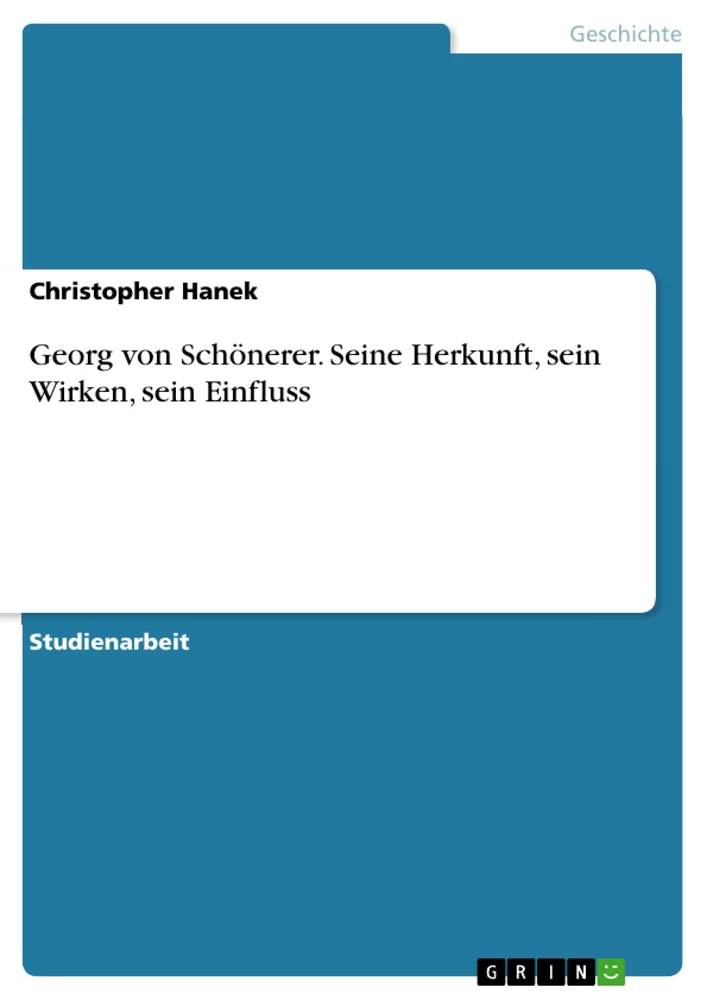„Es ist sehr wesentlich zu unterscheiden, zwischen dem, was man vergessen kann und dem, was man nicht vergessen darf.“ So formulierte es einst der deutsche Dichter, Schriftsteller und Aphoristiker Erich Limpach. Es gibt Zeiten, die mit Ereignissen verbunden sind, die unser Gedächtnis bis heute prägen, die unser Handeln beeinflussen und die manch einen von einer historischen Schuld sprechen lassen. Für die deutsche Geschichte ist vor allem die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts entscheidend. Eine Zeit des Nationalismus, in der sich die Demokratie in Deutschland den fanatischen Ideen weniger und letztendlich dem radikalisierten Willen des Volkes beugen musste. Das Aufkommen und Wirken des Nationalsozialismus ist eine Epoche, die bis heute nicht vergessen wurde und auch nicht vergessen werden darf. Der deutsche Faschismus forderte mehr als 13 Millionen Tote (ohne Einbeziehung der Kriegshandlungen), derer auch heute noch gedacht wird. Wenn man diese Zeit auf Limpachs Zitat überträgt, dann handelt es sich um Ereignisse, die die Menschen aller Nationen nicht vergessen dürfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Seine Herkunft und frühen Jahre
- 3. Seine Vorstellungen und Ideen
- 4. Seine Feindbilder und Gegner
- 5. Seine Bewunderer und Anhänger
- 6. Sein Nachwirken und Einfluss
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Leben, Wirken und Einfluss Georg von Schönerers. Ziel ist es, seine Bedeutung für den aufkommenden Nationalsozialismus zu beleuchten und seine Ideen, Feindbilder und Anhänger zu analysieren. Die Arbeit wird Schönerers Rolle im Kontext des österreichischen Nationalismus und seine langfristigen Auswirkungen auf das politische Klima zu Beginn des 20. Jahrhunderts untersuchen.
- Schönerers Herkunft und frühe Jahre
- Seine nationalistischen und antisemitischen Ideen
- Seine politischen Gegner und die Gegenreaktion auf seine Bewegung
- Seine Anhänger und die Verbreitung seiner Ideologie
- Der Einfluss Schönerers auf den späteren Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt Georg von Schönerer als eine Schlüsselfigur im Kontext des aufkommenden Nationalsozialismus vor und betont die Wichtigkeit, ihn im Zusammenhang mit der Geschichte des Antisemitismus zu verstehen. Sie hebt seine Bedeutung als Vorläufer Hitlers hervor und kündigt die Fragestellungen der Arbeit an, die sich mit Schönerers Ideen, seinen Gegnern und Anhängern sowie seinem nachhaltigen Einfluss befassen.
2. Seine Herkunft und frühen Jahre: Dieses Kapitel beschreibt Schönerers familiären Hintergrund, seine Ausbildung und seine frühen politischen Aktivitäten. Es beleuchtet seine Zeit als Landwirt auf den Gütern des Fürsten Schwarzenberg, die seine Sympathien für Preußen und die Hohenzollern prägte. Schönerers Eintritt in den Fortschrittsklub und sein späterer Austritt aufgrund dessen mangelnden Radikalismus wird ebenso thematisiert, wie seine ersten antisemitischen Äußerungen, die im Kontext seiner wirtschaftlichen und politischen Überzeugungen zu sehen sind.
3. Seine Vorstellungen und Ideen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Schönerers politische Ideologie. Sein Eintreten für ein Großdeutsches Reich unter Führung der Hohenzollern und seine Ablehnung der Habsburger Monarchie werden detailliert dargestellt. Das "Linzer Programm" und seine Forderungen nach Sozialreformen und einer Reduktion der jüdischen Bevölkerung werden analysiert. Schließlich wird Schönerers Versuch, das "Deutschtum" in Österreich durch die Einführung germanischer Namen und einer neuen Zeitrechnung zu revitalisieren, erläutert.
Schlüsselwörter
Georg von Schönerer, Antisemitismus, Nationalismus, Großdeutsches Reich, Hohenzollern, Habsburger, Pan Germanismus, Linzer Programm, Alldeutsche Bewegung, Österreichischer Nationalismus, Politischer Radikalismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Georg von Schönerer
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Übersicht über das Leben, Wirken und den Einfluss von Georg von Schönerer. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf Schönerers Rolle im aufkommenden Nationalsozialismus und seinem Beitrag zum österreichischen Nationalismus und Antisemitismus.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Aspekte von Schönerers Leben und Wirken, darunter seine Herkunft und frühen Jahre, seine politischen Ideen und Vorstellungen (inkl. des Linzer Programms), seine Gegner und Anhänger, sowie seinen Einfluss auf den späteren Nationalsozialismus und den österreichischen Nationalismus. Besonders hervorgehoben wird seine antisemitische Ideologie und seine Rolle im Kontext des Pan Germanismus.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Schönerers Herkunft und frühe Jahre, seine Vorstellungen und Ideen, seine Feindbilder und Gegner, seine Bewunderer und Anhänger, sein Nachwirken und Einfluss und schließlich ein Fazit. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die Schlüsselwörter umfassen: Georg von Schönerer, Antisemitismus, Nationalismus, Großdeutsches Reich, Hohenzollern, Habsburger, Pan Germanismus, Linzer Programm, Alldeutsche Bewegung, Österreichischer Nationalismus, Politischer Radikalismus.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung des Dokuments besteht darin, die Bedeutung Georg von Schönerers für den aufkommenden Nationalsozialismus zu beleuchten und seine Ideen, Feindbilder und Anhänger zu analysieren. Es untersucht seine Rolle im Kontext des österreichischen Nationalismus und seine langfristigen Auswirkungen auf das politische Klima zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Wie wird Schönerers Rolle im aufkommenden Nationalsozialismus dargestellt?
Das Dokument betont Schönerers Bedeutung als Vorläufer Hitlers und untersucht seinen Einfluss auf die Entwicklung des Nationalsozialismus. Seine antisemitischen und nationalistischen Ideen werden in diesem Kontext analysiert.
Welche Rolle spielte Schönerers antisemitische Ideologie?
Schönerers antisemitische Ideologie spielt eine zentrale Rolle im Dokument. Seine antisemitischen Äußerungen und ihre Einbettung in seine wirtschaftlichen und politischen Überzeugungen werden ausführlich behandelt. Der Einfluss dieser Ideologie auf seine Anhänger und auf die Verbreitung seiner Ideologie wird ebenfalls beleuchtet.
Wie wird Schönerers Verhältnis zu den Habsburgern und Hohenzollern beschrieben?
Das Dokument beschreibt Schönerers Ablehnung der Habsburger Monarchie und sein Eintreten für ein Großdeutsches Reich unter Führung der Hohenzollern. Seine frühen Sympathien für Preußen und die Hohenzollern, geprägt durch seine Zeit als Landwirt auf den Gütern des Fürsten Schwarzenberg, werden ebenfalls thematisiert.
- Quote paper
- Christopher Hanek (Author), 2014, Georg von Schönerer. Seine Herkunft, sein Wirken, sein Einfluss, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287734