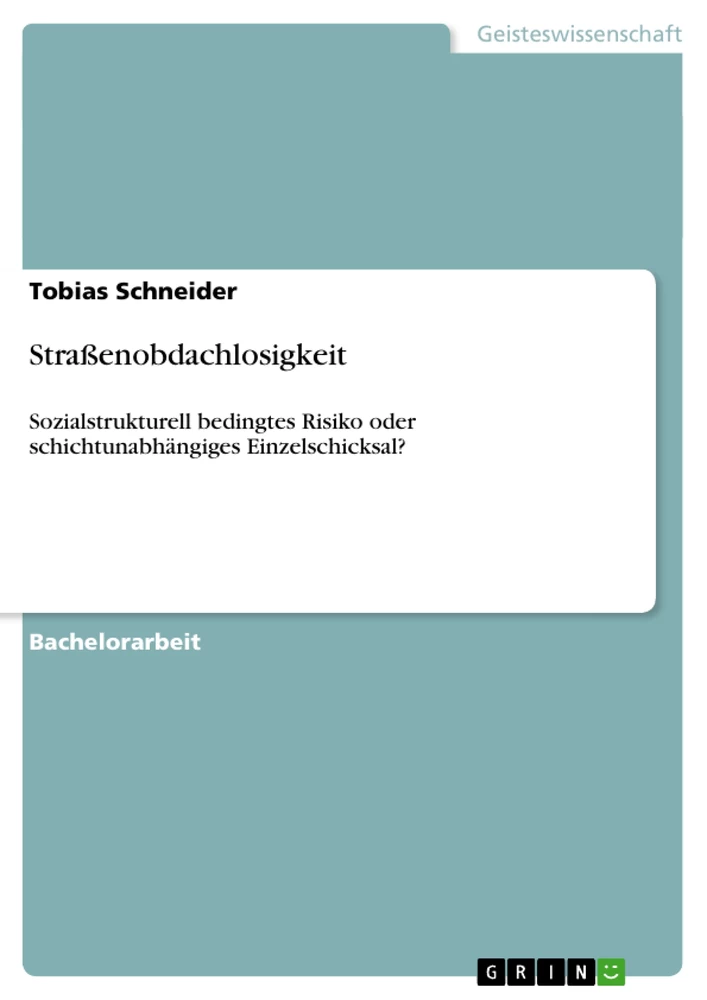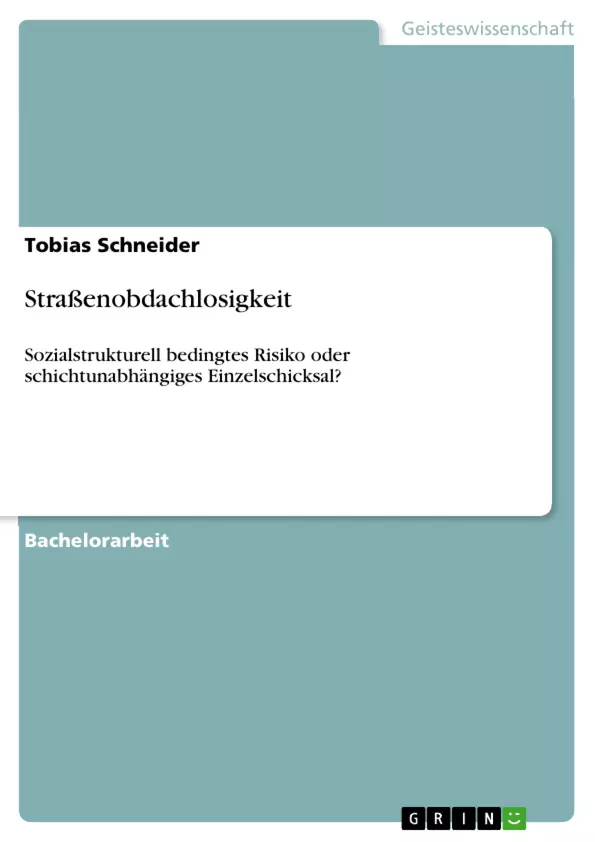Ein ‚eigenes Dach‘ über dem Kopf zu haben gilt in Deutschland für die meisten Menschen als selbstverständlich. Eine Wohnung bietet Schutz, fungiert als persönlicher Rückzugsort und sichert die Privatsphäre. Außerdem geht das Individuum hier weitgehend seinen existenziell notwendigen Tätigkeiten zur eigenen Erhaltung nach, wie z.B. Schlaf, Nahrungsaufnahme und Hygiene. Dennoch: Ein Recht auf Wohnung ist im Grundgesetz nicht vorgesehen. In der 1996 revidierten Charta der sozialen Rechte des Europarates wurde das Recht auf Wohnung zwar aufgenommen , dieses ist in der Praxis allerdings kaum einklagbar (vgl. Paegelow 2012: S.8).
Am 10.12.2007 wurde von einer überparteilichen Initiative dem Europäischen Parlament eine „Schriftliche Erklärung zur Beendigung der (Straßen-)Obdachlosigkeit“ (McDonald 2007: S.2) eingereicht: Es fordert die Europäische Union dazu auf, diese äußerste Ausprägung der Armut bis zum Jahr 2015 zu beenden. Ein solches Ziel wirkt jedoch, in Anbetracht der aktuellen Situation, utopisch: Selbst in einer hochtechnologisierten Gesellschaft wie Deutschland gehören Obdachlose, die insbesondere in den Fußgängerzonen der Großstädte betteln, Straßenzeitungen verkaufen oder sich einfach nur die Zeit vertreiben, zum allgemeinakzeptierten Alltag. Viele Bürger versuchen einer direkten Konfrontation mit den Betroffenen aus dem Weg zu gehen und machen einen großen Bogen, andere wiederum leisten, sei es als Hilfeleistung oder zur Beruhigung des eigenen Gewissens, eine kleine Geld- oder Naturalspende. Anwohner oder Geschäftstreibende hingegen, können diese auch als persönlichen Störfaktor wahrnehmen oder die Attraktivität des Stadtviertels gefährdet sehen und versuchen sie zu vertreiben. Begründen lassen sich solche Maßnahmen auf der Basis von Vorurteilen über arbeitsfaule, selbstverschuldete Obdachlose. Dabei gilt jedoch zu bedenken: Wer auf der Straße lebt ist auf die unterste Stufe der sozialen Hierarchie abgerutscht und die Vermutung liegt nahe, dass sich wohl kaum ein Mensch gerne in einer solch unangenehmen Lebenslage befindet.
Ziel dieser wissenschaftlichen Ausarbeitung ist es somit, dem Phänomen der Obdachlosigkeit genauer nachzugehen und herauszufinden, warum selbst in einem hoch entwickelten Industrieland wie Deutschland manche Menschen auf der Straße leben.
Inhaltsverzeichnis
- Prolog
- Methodik
- Erster Teil
- Einführung in die Thematik der Obdachlosigkeit
- Definition der Obdachlosigkeit
- Soziologische Grundlagen des Wohnens Obdachloser
- Wohnen als Grundlage des Lebens und Erlebens
- Wohnen und Macht
- Wohnen und Straßenobdachlosigkeit
- Die Wohnwirklichkeit Obdachloser
- Auswirkungen des,obdachlosen Wohnens' auf die Gesundheit
- Widrigkeiten und Gewalt im öffentlichen Raum
- Geschichte der Obdachlosigkeit
- Obdachlosigkeit im Mittelalter
- Erste Entwicklung von staatlich geregelten Hilfesystemen im späten Mittelalter
- Repression sowie Arbeits- und Zuchthäuser im Absolutismus
- Armenfürsorge in der Industrialisierung
- Psychologische und sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze
- Entwicklung von Psychopathie-Konzepten im 19. und 20. Jahrhundert
- Konzept der pathologischen Wanderpersönlichkeit im Nationalsozialismus
- Beibehaltung der pathologischen Erklärungsmodelle auch nach 1945
- Innovationen in der Obdachlosenhilfe in den 1970er Jahren
- Entwicklung eines multikausalen Begründungsmodells
- Theoretischer Ansatz dieser Ausarbeitung
- Im Abwärtsstrudel der Gesellschaft
- Wohnungserhaltende Präventionsmaßnahmen
- Mögliche Ursachen eines Wohnungsverlusts
- Rechtliche Hilfen nach Eintritt der Wohnungslosigkeit
- Straßenobdachlosigkeit
- Ursachen der Straßenobdachlosigkeit
- Hilfen für Obdachlose
- Probleme im Hilfesystem
- Zweiter Teil
- Vertiefung der Forschungsfrage
- Obdachlosigkeit und Sozialstruktur
- Der soziale Raum
- Präzisierung der Forschungsfrage
- Wohnungslosigkeit in Zahlen: Die Sozialstruktur der Wohnungslosen
- Sozialstruktur der Obdachlosigkeit
- Erster Überblick über das Ausmaß der Obdachlosigkeit
- Straßenobdachlosigkeit in der Presse
- Studien über Straßenobdachlosigkeit
- Eine qualitative Untersuchung
- Eine weitere Auswertung qualitativer Daten
- Studie über Obdachlose in Niedersachsen
- Bundesweite Untersuchung der Caritas
- Auf der Straße lebende Menschen in Hamburg
- Weitere Erkenntnisse aus den Experteninterviews
- Fazit
- I. Literatur-Quellen
- I.I Online-Quellen
- I.II Abbildungsverzeichnis
- II Danksagung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelor-Thesis befasst sich mit dem Phänomen der Obdachlosigkeit in Deutschland. Ziel der Arbeit ist es, die Ursachen und Hintergründe der Obdachlosigkeit zu untersuchen und die Frage zu klären, ob es sich um ein sozialstrukturell bedingtes Risiko oder um schichtunabhängige Einzelschicksale handelt. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Im ersten Teil werden die zentralen Begrifflichkeiten der Obdachlosigkeit definiert, die soziologischen Grundlagen des Wohnens beleuchtet und die historische Entwicklung der Obdachlosigkeit in Deutschland dargestellt. Im zweiten Teil wird die Sozialstruktur der Obdachlosigkeit anhand von empirischen Daten und Studien untersucht.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs der Obdachlosigkeit
- Soziologische Grundlagen des Wohnens und die Bedeutung eines festen Wohnsitzes
- Historische Entwicklung der Obdachlosigkeit in Deutschland
- Sozialstrukturelle Ursachen der Obdachlosigkeit
- Empirische Studien zur Sozialstruktur der Obdachlosigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Der Prolog der Arbeit führt in die Thematik der Obdachlosigkeit ein und stellt die Relevanz des Themas in Deutschland dar. Es wird die Bedeutung eines festen Wohnsitzes für die menschliche Existenz und die gesellschaftliche Integration hervorgehoben. Die Arbeit stellt die zentrale Forschungsfrage in den Mittelpunkt: Ist die Gefahr in die Obdachlosigkeit zu rutschen ein sozialstrukturell bedingtes Risiko der unteren Schichten oder handelt es sich bei den Betroffenen um schichtunabhängige Einzelschicksale?
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit der Definition und den soziologischen Grundlagen der Obdachlosigkeit. Es werden verschiedene Definitionen der Obdachlosigkeit vorgestellt und die Bedeutung des Wohnens als Grundlage des Lebens und Erlebens sowie als Ausdruck von Macht und sozialer Integration beleuchtet. Die Arbeit geht auf die Geschichte der Obdachlosigkeit in Deutschland ein und betrachtet verschiedene Erklärungsansätze, die in der Vergangenheit zur Erforschung des Phänomens verwendet wurden. Es wird ein multikausales Begründungsmodell vorgestellt, das verschiedene Faktoren wie Armut, psychische Erkrankungen, Sucht und soziale Isolation als Ursachen für Obdachlosigkeit identifiziert.
Der zweite Teil der Arbeit vertieft die Forschungsfrage und untersucht die Sozialstruktur der Obdachlosigkeit. Es werden verschiedene Studien und Statistiken zur Sozialstruktur der Obdachlosigkeit in Deutschland vorgestellt und analysiert. Die Arbeit geht auf die Frage ein, ob speziell Menschen aus den unteren Schichten gefährdet sind obdachlos zu werden, oder ob jeder, unabhängig von seiner Bildung und sozialen Schichtzugehörigkeit, in eine solch missliche Lage geraten kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Obdachlosigkeit, Sozialstruktur, Wohnen, Armut, soziale Exklusion, gesellschaftliche Integration, Deutschland, Geschichte, Soziologie, empirische Forschung, Studien, Statistiken.
- Arbeit zitieren
- Tobias Schneider (Autor:in), 2014, Straßenobdachlosigkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287739