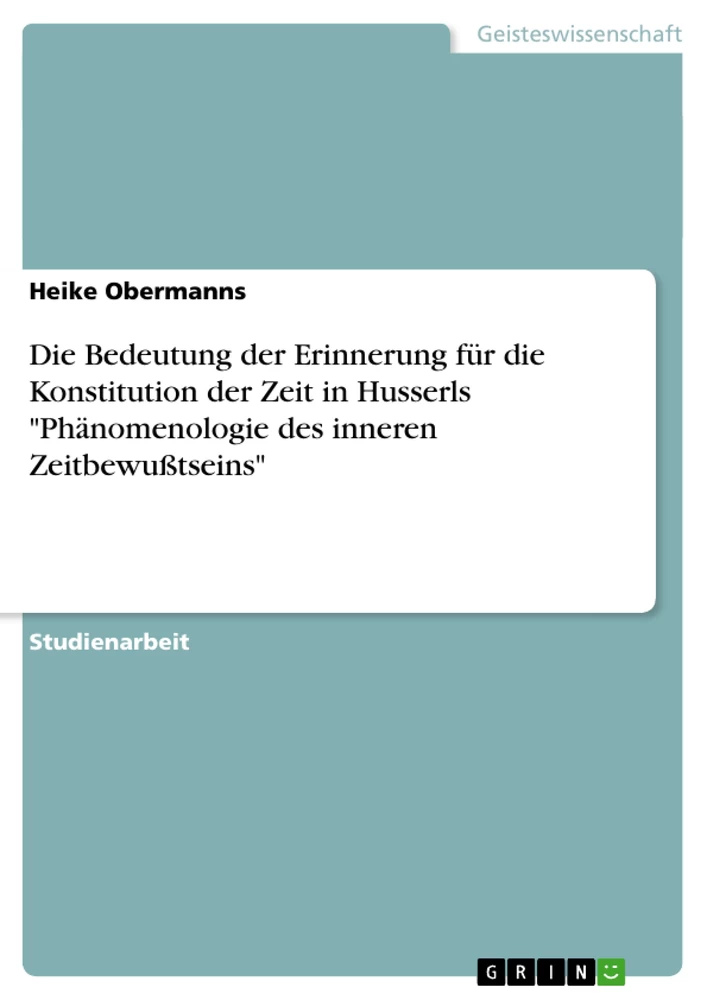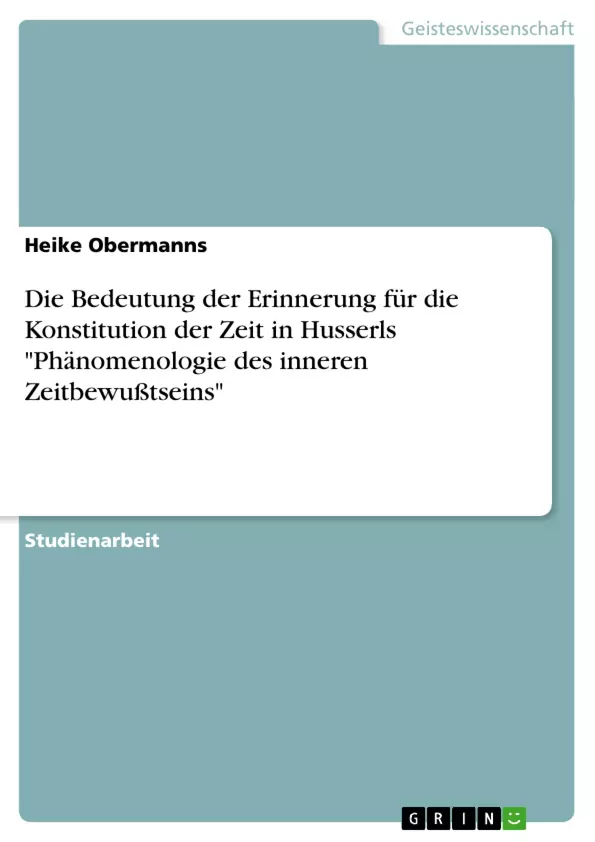Kreativität, Selbstbesinnung, Vorstellungsvermögen - für die griechische Antike war mit der Erinnerung weit mehr verbunden, als in den Begriff der 'memoria' als bloße Erinnerung einer früheren Handlung oder eines Ereignisses später hineingenommen wurde. Vor allem Platons Unterscheidung zwischen Gedächtnis und Wiedererinnerung, die die bloß latente Wahrnehmung 'beseelt', verdient Beachtung, denn sie führt direkt zu Husserls Analysen des Zeitbewusstseins. Nicht nur von der Vergangenheit, sondern auch von der gegenwärtigen und zukünftigen Zeit lässt die Seele in uns "Schriften und Bilder" entstehen, sagt Platon im Philebos .
Heißt das aber nicht, dass sich die Seelentätigkeit überhaupt an den drei Zeiten orientiert, daß Zeitlichkeit die Form vorgibt, in der 'Schriften und Bilder' erst in uns entstehen können? Ist dann nicht Zeitlichkeit die Form, in der Bewusstsein erst existieren kann ? Und wenn nur durch Erinnerung Selbstbesinnung möglich ist, bedeutet das nicht, dass die im Zeitfluss existierende Seele dennoch gleichsam innehalten und von ihrer Form wissen kann? Diese Fragen leiten Husserls phä-nomenologische Analysen des inneren Zeitbewusstseins. Die vorliegende Arbeit zeichnet nach, dass die Erinnerung, in der allein der Bewusstseinsstrom erfahrbar wird, sich für Husserl zur zentralen Kategorie heraus kristallisiert, und zwar sowohl ontologisch als auch erkenntnistheoretisch.
Die Zeitlichkeit ist für Husserl die universelle Form, in der sich ‚jedes erdenkliche Ego für sich selbst konstituiert; diese ‚egologische Genese’ folgt eben jener Gesetzmäßigkeit, nach der sich ständig strömend ‚Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in eins konstituieren’.
So eröffnet sich für Husserl in der Analyse des inneren Zeitbewusstseins die Phänomenologie der originären cogitationes, die dem lebendigen Bewusstsein sein Präsenzfeld geben.
Inhaltsverzeichnis
- I Mnemosyne
- II Voraussetzungen der Husserlschen Zeitanalyse: Die Begriffe der Konstitution und Fundierung
- III Das originäre Zeitfeld
- IV Die primäre Erinnerung
- V Die sekundäre Erinnerung
- VI Schlußbemerkung: Erinnerung als Grundlage der transzendentalen Phänomenologie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bedeutung der Erinnerung für die Konstitution der Zeit in Husserls Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. Sie analysiert, wie Husserls Konzepte von Konstitution und Fundierung die Rolle der Erinnerung im Verständnis von Zeitlichkeit klären. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit dem Verhältnis von Gedächtnis und Wiedererinnerung.
- Die Rolle der Erinnerung in der Konstitution von Zeit
- Husserls phänomenologische Methode und ihre Anwendung auf das Zeitbewusstsein
- Das Verhältnis von Gedächtnis, Wahrnehmung und Erinnerung
- Die Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Erinnerung
- Die Bedeutung der Erinnerung für die transzendentale Phänomenologie
Zusammenfassung der Kapitel
I Mnemosyne: Dieses Kapitel beginnt mit einem literarischen Zitat von Hölderlin und führt in die antike Auffassung von Mnemosyne, der Göttin des Gedächtnisses, ein. Es werden die verschiedenen Perspektiven Platons und Aristoteles auf das Verhältnis von Gedächtnis, Wahrnehmung, Erinnerung und Vorstellungskraft dargestellt. Die Arbeit betont die kreative und konstituierende Kraft der Erinnerung, die über den bloßen Abruf vergangener Ereignisse hinausgeht und die Fähigkeit zur Selbstbesinnung der Seele umfasst. Die unterschiedlichen Verständnislinien von Erinnerung in der griechischen Antike werden herausgearbeitet und ihre Relevanz für Husserls Analyse des Zeitbewusstseins hervorgehoben. Der Schluss des Kapitels stellt Fragen nach der Beziehung von Zeitlichkeit und Bewusstsein, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen.
II Voraussetzungen der Husserlschen Zeitanalyse: Die Begriffe der Konstitution und Fundierung: Dieses Kapitel erläutert die methodischen Grundlagen von Husserls Phänomenologie, insbesondere die Konzepte der Konstitution und Fundierung. Es wird der Bezug zu Descartes und Augustin hergestellt, um Husserls Anspruch an eine absolute Rechtfertigung wissenschaftlicher Erkenntnis zu verdeutlichen. Die phänomenologische Reduktion wird als Zurückführung aller Seinsgeltung auf ihr bewußtseinsmäßiges, intentionales Erscheinen beschrieben. Die natürliche Einstellung und ihre Unterscheidung von der phänomenologischen Reduktion werden erklärt. Der Abschnitt betont Husserls idealistische Position, die besagt, dass sich die Welt aus motivierten Transzendenzvollzügen des Bewusstseins heraus aufbaut.
Schlüsselwörter
Husserl, Phänomenologie, Zeitbewusstsein, Erinnerung, Gedächtnis, Konstitution, Fundierung, Mnemosyne, primäre Erinnerung, sekundäre Erinnerung, transzendentale Phänomenologie, intentionales Bewusstsein.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Husserls Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins und die Rolle der Erinnerung"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Bedeutung der Erinnerung für die Konstitution der Zeit in Husserls Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. Sie analysiert, wie Husserls Konzepte von Konstitution und Fundierung die Rolle der Erinnerung im Verständnis von Zeitlichkeit klären und befasst sich insbesondere mit dem Verhältnis von Gedächtnis und Wiedererinnerung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der Erinnerung in der Konstitution von Zeit, Husserls phänomenologische Methode und ihre Anwendung auf das Zeitbewusstsein, das Verhältnis von Gedächtnis, Wahrnehmung und Erinnerung, die Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Erinnerung sowie die Bedeutung der Erinnerung für die transzendentale Phänomenologie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel I ("Mnemosyne") führt in die antike Auffassung von Gedächtnis ein und beleuchtet unterschiedliche Perspektiven Platons und Aristoteles. Kapitel II ("Voraussetzungen der Husserlschen Zeitanalyse") erläutert die methodischen Grundlagen von Husserls Phänomenologie, insbesondere Konstitution und Fundierung. Kapitel III ("Das originäre Zeitfeld"), IV ("Die primäre Erinnerung") und V ("Die sekundäre Erinnerung") untersuchen im Detail die Rolle der Erinnerung im Zeitbewusstsein. Kapitel VI ("Schlussbemerkung") fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert die Bedeutung der Erinnerung für die transzendentale Phänomenologie.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet Husserls phänomenologische Methode, die auf einer phänomenologischen Reduktion beruht und die Welt als aus motivierten Transzendenzvollzügen des Bewusstseins aufgebaut beschreibt. Sie bezieht sich auf die Konzepte der Konstitution und Fundierung, um die Rolle der Erinnerung im Zeitbewusstsein zu analysieren.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Husserl, Phänomenologie, Zeitbewusstsein, Erinnerung, Gedächtnis, Konstitution, Fundierung, Mnemosyne, primäre Erinnerung, sekundäre Erinnerung, transzendentale Phänomenologie und intentionales Bewusstsein.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt die zentrale Bedeutung der Erinnerung für die Konstitution von Zeit in Husserls Phänomenologie auf. Sie verdeutlicht, wie Husserls Konzepte von Konstitution und Fundierung das Verständnis von Zeitlichkeit durch die Rolle der Erinnerung klären. Die Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Erinnerung wird als wesentlich für das Verständnis des Zeitbewusstseins herausgestellt. Die Schlussfolgerungen werden im sechsten Kapitel detailliert dargestellt.
- Quote paper
- Heike Obermanns (Author), 1996, Die Bedeutung der Erinnerung für die Konstitution der Zeit in Husserls "Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28774