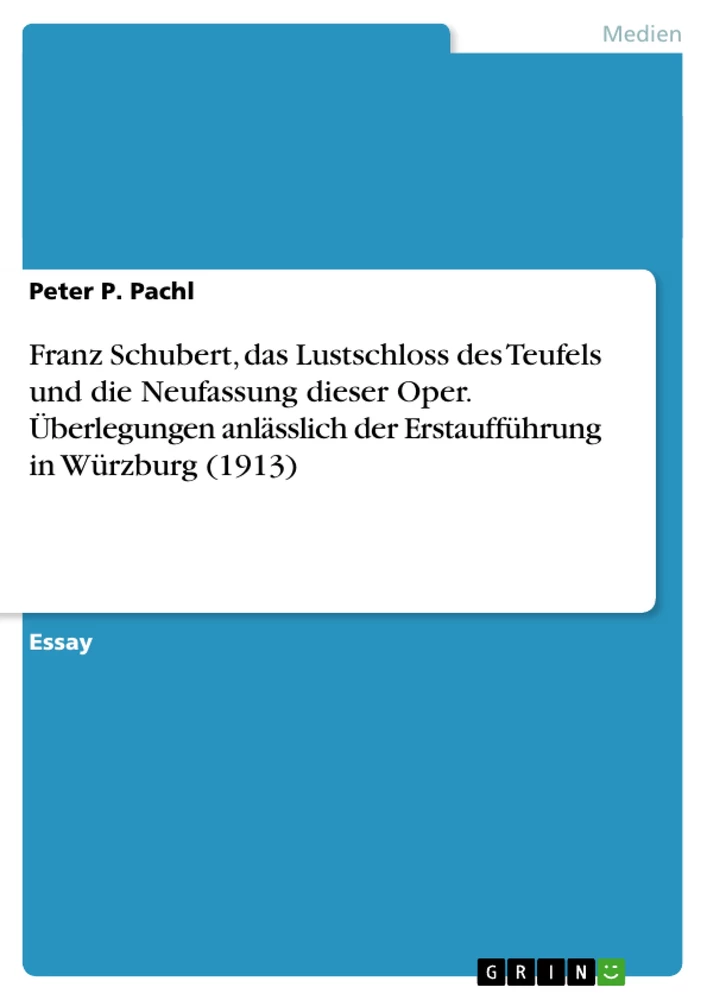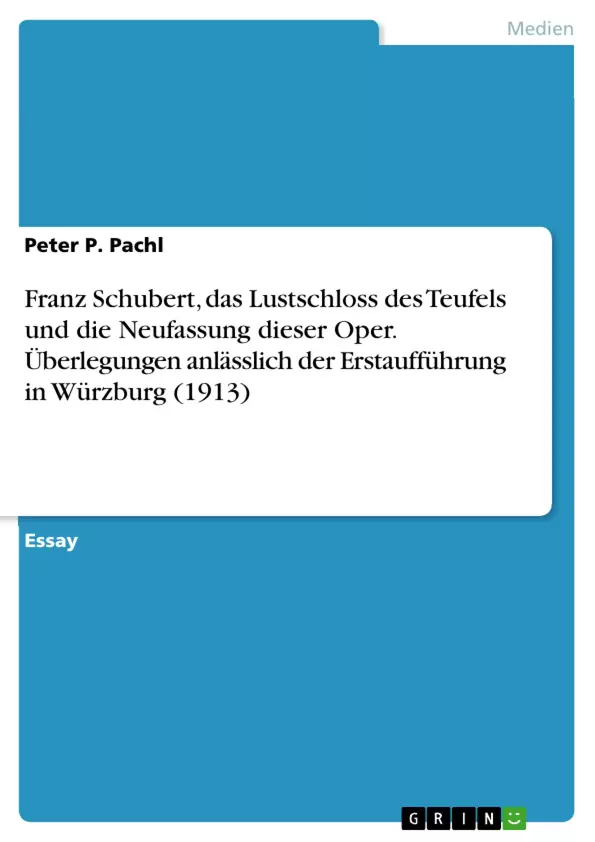Offensichtlich wurde kaum ein Komponist im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit so stark verfälscht, wie Franz Schubert, der auch wie kein Zweiter zur Operetten- und Filmfigur wurde, beginnend mit Heinrich Bertés „Das Dreimäderlhaus“.
Erst jüngere Filme, wie „Notturno“ (1988) und „The double Life of Franz Schubert“ (1997) rückten auch Schuberts Krankheit ins Bild – die Syphilis und ihre Folgen, wie den Verlust seines Haupthaars, wochenlange Spitalsaufenthalte und seine Leiden in Heilanstalten.
Liest man, was die Freunde und Zeitgenossen über diesen Tonsetzer berichtet haben, so tritt uns ein völlig anderer Schubert entgegen, als der so gern als besonders bescheiden gezeichnete, umgänglich liebenswerte oder auch introvertierte Komponist. Schuberts Freund Albert Stadler attestiert Schuberts „schroffes Wesen“, mit abrupten Wechseln von Demütigkeit, und Exaltiertheit. Andere Untugenden Schuberts, die ihm von Zeitgenossen auch ohne vorgehaltene Hand attestiert wurden, waren seine „Neigung zum Trunke“ und in der Frage des Eigentums die „kommunistische Anschauungsweise“.
Zumeist verschwiegen die den Komponisten überlebenden Freunde ein Tabuthema oder umrissen es in vagen Andeutungen. So verriet der Wiener Kritiker Eduard Hanslick nur, dass er mehr wisse, als er verlautbaren könne: „Manch’ köstlich derb komische Geschichte aus dem Zusammenleben Schuberts mit Schwind dürfen wir aus dem Stübchen [...] leider nicht vor unseren Leserkreis bringen.“
Anselm Hüttenbrenner chiffrierte Franz Schuberts erotische Ausrichtung: „Er hatte [...] eine vorherrschende Antipathie gegen die Töchter der Eva.“
Eduard Bauernfeld berichtet über Schuberts Verhältnis zum jungen Maler Moritz von Schwind, den Schubert „seine Geliebte“ genannt habe.
Die Behauptung einer unglücklichen Jugendliebe schien Schuberts ablehnende Haltung den Frauen gegenüber zu rechtfertigen. Doch selbst die angebliche „Jugendgeliebte“ Therese Grob, hat sich im Lichte heutiger Forschung als eine unhaltbare Legende erwiesen.
Inhaltsverzeichnis
- Offensichtlich wurde kaum ein Komponist im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit so stark verfälscht, wie Franz Schubert
- Liest man, was die Freunde und Zeitgenossen über diesen Tonsetzer berichtet haben
- Die Behauptung einer unglücklichen Jugendliebe schien Schuberts ablehnende Haltung den Frauen gegenüber zu rechtfertigen
- Im Zusammenhang mit Schuberts Freund Franz von Schober
- Häufig war Schubert von jungen Männern umgeben
- Angesichts der Tatsache, dass Schubert und seine Freunde Umgang mit dem Transvestiten „Nina“ (Carl Smirsch) hatten
- Im Gegensatz zu den meist idealisierenden Porträts bezeichne Schuberts erster Biograph, Heinrich Kreiße von Hellborn
- Michael Vogl war der Überzeugung, „dass Schubert in einem somnambulartigen Zustande war, sooft er komponierte“
- Überdauert haben Requisiten, wie Franz Schuberts Brille
- Und geblieben sind uns Schuberts Werke oder doch nicht?
- Eine professionelle Ausnahme bildet jenes Opernlibretto, das Schubert sogar zweimal vertont und vollendet hat: „Des Teufels Lustschloss“
- Gegenüber seiner Vorlage, Joseph-Marie Loaisel de Tréogates vieraktiger heroischer Tragödie „Le chateau du diable“
- Die verführerischen Jungfrauen der Amazone im zweiten Akt werden mit einem türkischen Marsch eingeführt
- Der Vergleich der Manuskripte von erster und zweiter Fassung Schuberts zeigt
- Häufig fanden Schuberts Bühnenwerke den Weg auf den Ort ihrer Bestimmung erst nach dem Tod des Komponisten
- Was die szenische Realisierungsmöglichkeit dieser Schubert-Oper angeht
- Paul Stefan merkte im Jahre 1928 an
- Schubert lag also intuitiv völlig richtig
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Leben und Werk von Franz Schubert, insbesondere im Hinblick auf die Rezeption seiner Oper "Des Teufels Lustschloss" und die Darstellung seines Charakters in biographischen Quellen. Sie hinterfragt gängige Klischees und beleuchtet Aspekte seines Lebens, die oft verdrängt oder verschwiegen wurden.
- Rezeption und Verfälschung des Bildes Schuberts in der Öffentlichkeit
- Schuberts Persönlichkeit und Lebenswandel anhand zeitgenössischer Berichte
- Analyse von Schuberts Homosexualität und deren Einfluss auf sein Werk
- Die Entstehung und Aufführungsgeschichte von "Des Teufels Lustschloss"
- Vergleich der verschiedenen Fassungen der Oper und deren szenische Umsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Offensichtlich wurde kaum ein Komponist im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit so stark verfälscht, wie Franz Schubert: Der Text beginnt mit der Feststellung, dass das Bild Schuberts in der Öffentlichkeit stark idealisiert und verfälscht wurde, im Gegensatz zu den Berichten seiner Zeitgenossen. Er wurde oft als bescheidener und liebenswerter Komponist dargestellt, während die Realität ein komplexeres Bild zeigt.
Liest man, was die Freunde und Zeitgenossen über diesen Tonsetzer berichtet haben: Dieser Abschnitt präsentiert widersprüchliche Zeugnisse über Schuberts Charakter. Seine Freunde beschreiben ihn als schroff, launisch, mit Hang zum Alkohol und einer ungewöhnlichen Einstellung zum Eigentum. Es wird angedeutet, dass einige Aspekte seines Lebens, insbesondere seine Sexualität, aus Rücksicht auf sein Andenken verheimlicht wurden.
Die Behauptung einer unglücklichen Jugendliebe schien Schuberts ablehnende Haltung den Frauen gegenüber zu rechtfertigen: Die These einer unglücklichen Jugendliebe, die oft als Erklärung für Schuberts vermeintliche Abneigung gegen Frauen herangezogen wurde, wird als unhaltbare Legende entlarvt. Neuere Forschungen widerlegen diese Interpretation.
Im Zusammenhang mit Schuberts Freund Franz von Schober: Die Beziehung Schuberts zu seinem Freund Franz von Schober wird im Detail untersucht. Zeitgenössische Berichte legen eine erotische Komponente nahe, die in der damaligen Zeit tabuisiert war. Der Text betont die Bedeutung von Schuberts Umgang mit anderen Männern, deren Homosexualität unstrittig ist.
Häufig war Schubert von jungen Männern umgeben: Dieser Abschnitt vertieft die Thematik der männlichen Freundschaften Schuberts und deren möglicher sexueller Natur. Er erwähnt explizit die Beziehungen zu Männern wie Johann Baptist Mayrhofer und Michael Vogl, und beleuchtet deren Einfluss auf Schuberts Leben und Werk.
Angesichts der Tatsache, dass Schubert und seine Freunde Umgang mit dem Transvestiten „Nina“ (Carl Smirsch) hatten: Der Text thematisiert den Kontakt Schuberts mit dem Transvestiten Carl Smirsch ("Nina") und dessen Auswirkungen auf das Verständnis von Schuberts Sexualität. Der Bezug zu der Figur des "Zwitters" in "Des Teufels Lustschloss" wird hergestellt.
Im Gegensatz zu den meist idealisierenden Porträts bezeichne Schuberts erster Biograph, Heinrich Kreiße von Hellborn: Hier wird die körperliche Erscheinung Schuberts anhand der Beschreibungen seines ersten Biographen dargestellt. Diese Beschreibung weicht stark von den idealisierten Porträts ab und betont eher unvorteilhafte Aspekte seines Aussehens.
Michael Vogl war der Überzeugung, „dass Schubert in einem somnambulartigen Zustande war, sooft er komponierte“: Dieser Abschnitt beschreibt Schuberts kompositorisches Verfahren aus der Sicht seiner Freunde, die ihn als in einen somnambulen Zustand verfallen beschreiben, während er komponierte. Diese Schilderungen werden als Indiz für seinen kreativen Prozess interpretiert.
Überdauert haben Requisiten, wie Franz Schuberts Brille: Der Abschnitt widmet sich den wenigen erhaltenen persönlichen Gegenständen Schuberts, wie z.B. seiner Brille, die er auch im Schlaf trug. Dies wird als Hinweis auf seine Kurzsichtigkeit und den damit verbundenen Alltag interpretiert.
Und geblieben sind uns Schuberts Werke oder doch nicht?: Der Text reflektiert über die Rezeption und den Umfang des erhaltenen musikalischen Werks Schuberts. Er stellt fest, dass ein großer Teil seines Schaffens, insbesondere längere und komplexere Werke, weniger bekannt ist und oft in Archiven verblieben.
Eine professionelle Ausnahme bildet jenes Opernlibretto, das Schubert sogar zweimal vertont und vollendet hat: „Des Teufels Lustschloss“: Hier beginnt die detaillierte Auseinandersetzung mit Schuberts Oper "Des Teufels Lustschloss". Der Text erläutert die Entstehungsgeschichte und die Besonderheit dieser Oper im Vergleich zu seinen anderen Bühnenwerken.
Gegenüber seiner Vorlage, Joseph-Marie Loaisel de Tréogates vieraktiger heroischer Tragödie „Le chateau du diable“: Der Abschnitt vergleicht Kotzebues Libretto mit der Vorlage und analysiert die Änderungen und Ergänzungen, die Kotzebue vorgenommen hat. Der Fokus liegt auf der autobiographischen Interpretation Schuberts.
Die verführerischen Jungfrauen der Amazone im zweiten Akt werden mit einem türkischen Marsch eingeführt: Die musikalische Gestaltung der Oper wird analysiert. Der Text interpretiert die verwendete Musik und deren symbolische Bedeutung im Kontext der Handlung und Schuberts persönlicher Erfahrungen.
Der Vergleich der Manuskripte von erster und zweiter Fassung Schuberts zeigt: Der Text untersucht die Unterschiede zwischen den beiden Fassungen der Oper und Schuberts Bestreben, den Bühneneffekt zu verbessern.
Häufig fanden Schuberts Bühnenwerke den Weg auf den Ort ihrer Bestimmung erst nach dem Tod des Komponisten: Die Aufführungsgeschichte der Oper "Des Teufels Lustschloss" wird detailliert dargestellt, von den ersten Radioaufnahmen bis zu den späten Bühnenproduktionen. Der lange Weg zur erfolgreichen Aufführung wird betont.
Was die szenische Realisierungsmöglichkeit dieser Schubert-Oper angeht: Es werden die Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Inszenierung der Oper beleuchtet und verschiedene Interpretationen der Gründe für die späte und schwierige Rezeption diskutiert.
Paul Stefan merkte im Jahre 1928 an: Die Einschätzung der Oper durch Paul Stefan wird zitiert und kommentiert.
Schubert lag also intuitiv völlig richtig: Der Text schließt mit einer Interpretation der Handlung und der dramaturgischen Entscheidungen Schuberts. Der Fokus liegt auf dem Konflikt zwischen den Generationen und der Unterdrückung von Emotionen.
Schlüsselwörter
Franz Schubert, Des Teufels Lustschloss, Oper, Homosexualität, Biographische Rezeption, Zeitgenössische Berichte, Musikalische Analyse, Aufführungsgeschichte, Libretto, August von Kotzebue, Bühnenwerk.
Häufig gestellte Fragen zu "Franz Schubert: Leben, Werk und Rezeption von 'Des Teufels Lustschloss'"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Leben und Werk von Franz Schubert, insbesondere die Rezeption seiner Oper "Des Teufels Lustschloss" und die Darstellung seines Charakters in biographischen Quellen. Sie hinterfragt gängige Klischees und beleuchtet oft verdrängte oder verschwiegene Aspekte seines Lebens, insbesondere seine Homosexualität und deren Einfluss auf sein Werk.
Wie wird Schuberts Bild in der Öffentlichkeit dargestellt?
Die Arbeit stellt fest, dass das Bild Schuberts in der Öffentlichkeit stark idealisiert und verfälscht wurde. Im Gegensatz zu den Berichten seiner Zeitgenossen, die ihn als schroff, launisch und mit Hang zum Alkohol beschreiben, wurde er oft als bescheidener und liebenswerter Komponist dargestellt. Viele Aspekte seines Lebens, besonders seine Sexualität, wurden aus Rücksicht auf sein Andenken verheimlicht.
Welche Rolle spielt Schuberts Homosexualität in dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert Schuberts Homosexualität und deren möglichen Einfluss auf sein Leben und Werk. Sie untersucht seine Beziehungen zu männlichen Freunden wie Franz von Schober, Johann Baptist Mayrhofer und Michael Vogl und deren Bedeutung. Der Kontakt zu dem Transvestiten Carl Smirsch ("Nina") wird ebenfalls thematisiert.
Welche Bedeutung hat die Oper "Des Teufels Lustschloss"?
"Des Teufels Lustschloss" ist ein zentraler Punkt der Arbeit. Die Entstehungsgeschichte, die verschiedenen Fassungen, der Vergleich mit der Vorlage ("Le chateau du diable" von Loaisel de Tréogate) und die Aufführungsgeschichte werden detailliert untersucht. Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Inszenierung der Oper und die Gründe für die späte und schwierige Rezeption.
Wie wird Schuberts Persönlichkeit anhand zeitgenössischer Berichte beschrieben?
Zeitgenössische Berichte zeichnen ein komplexeres Bild Schuberts als die idealisierten Porträts. Sie beschreiben ihn als launisch, schroff, mit Hang zum Alkohol und einer ungewöhnlichen Einstellung zum Eigentum. Die Arbeit analysiert diese widersprüchlichen Zeugnisse und versucht, ein realistischeres Bild zu schaffen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Franz Schubert, Des Teufels Lustschloss, Oper, Homosexualität, Biographische Rezeption, Zeitgenössische Berichte, Musikalische Analyse, Aufführungsgeschichte, Libretto, August von Kotzebue, Bühnenwerk.
Welche Kapitel gibt es in der Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, die sich jeweils mit spezifischen Aspekten von Schuberts Leben und Werk befassen. Diese reichen von der Rezeption seines Bildes in der Öffentlichkeit über die Analyse seiner Beziehungen zu seinen männlichen Freunden und der Untersuchung seiner Homosexualität bis zur detaillierten Auseinandersetzung mit der Entstehung, den verschiedenen Fassungen und der Aufführungsgeschichte von "Des Teufels Lustschloss". Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes und differenziertes Bild von Franz Schubert zu zeichnen, das über die gängigen Klischees hinausgeht. Die Themenschwerpunkte sind die Rezeption und Verfälschung des Bildes Schuberts, seine Persönlichkeit und sein Lebenswandel anhand zeitgenössischer Berichte, die Analyse seiner Homosexualität und deren Einfluss auf sein Werk, die Entstehung und Aufführungsgeschichte von "Des Teufels Lustschloss" sowie der Vergleich der verschiedenen Fassungen der Oper und deren szenische Umsetzung.
- Quote paper
- Prof. Dr. Peter P. Pachl (Author), 2015, Franz Schubert, das Lustschloss des Teufels und die Neufassung dieser Oper. Überlegungen anlässlich der Erstaufführung in Würzburg (1913), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287763