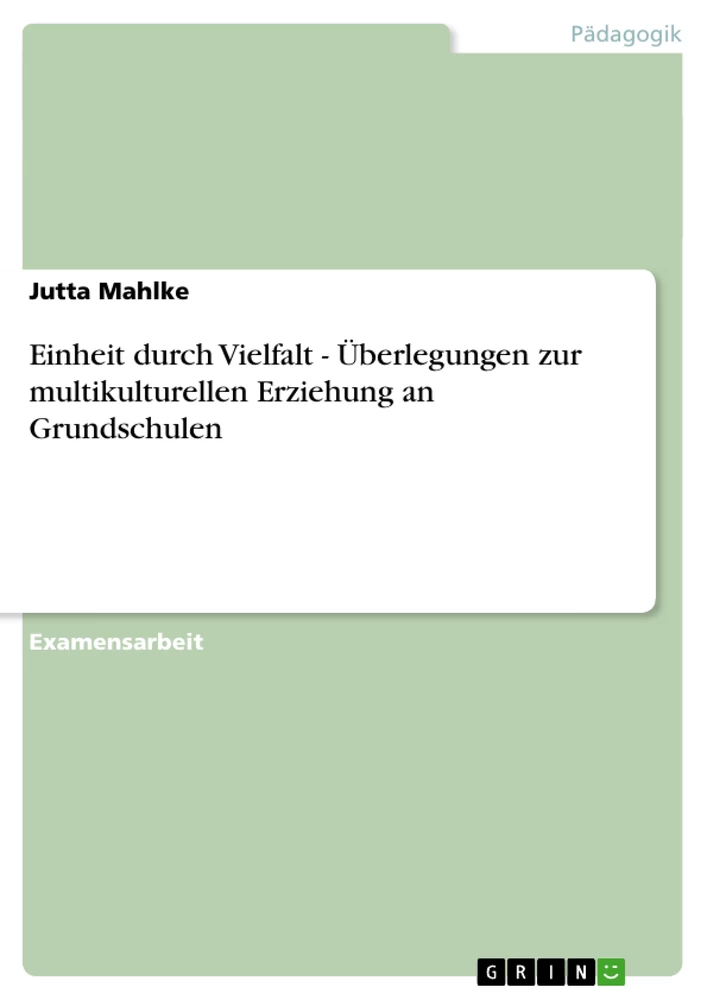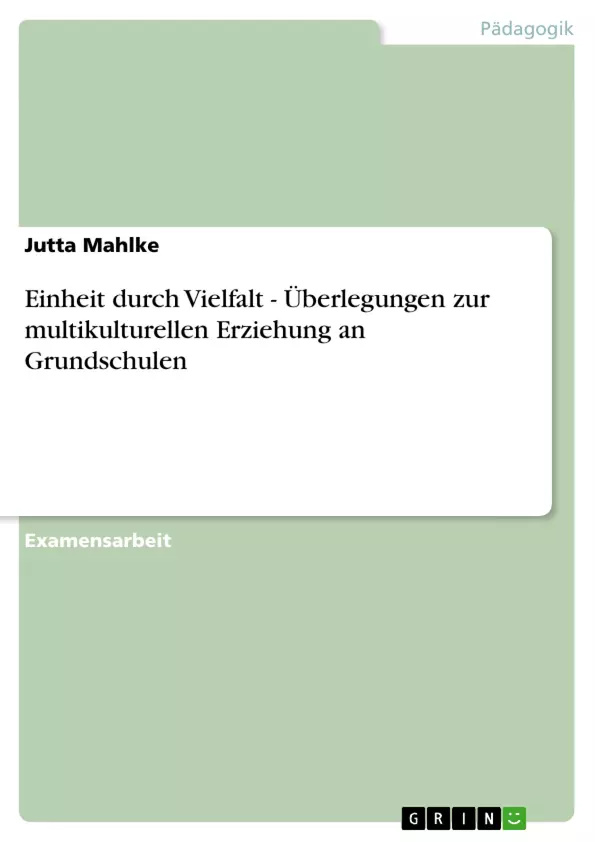Diese Arbeit an der Pädagogischen Hochschule Freiburg wurde angeregt durch die neueren Ansätze von Fremdsprachenfrühbeginn in der Grundschule und parallele Integrationsmaßnahmen ausländischer Kinder und Jugendlicher an deutschen Grundschulen. Sie bezieht sich auf den konkreten Stand 1992 und bezieht Erfahrungen aus studentischen Schulpraktika in Freiburg und Dortmund ein.
Überlegungen zur multikulturellen Erziehung an Grundschulen sind ganz entscheidend abhängig von den jeweiligen gesellschaftlichen Voraussetzungen der multikulturellen Schülerschaft, deren verschiedene Gruppen und Situation ich im zweiten Kapitel in Grundzügen zu verdeutlichen suche. Das dritte Kapitel soll Auskunft über den bildungspolitischen Rahmen geben, in dem alle schulischen Handlungsmöglichkeiten verankert sind. Kapitel vier stellt ein Beispiel der Hortbetreuung sowie das Dortmunder Konzept zum Ausbau der schulischen Handlungsmöglichkeiten dar, das derzeit in Modellform erprobt wurde.
Die zentrale Bedeutung der Sprachen führe ich in den Kapiteln fünf und sechs aus, wobei ich auch hier versucht habe, die damaligen Richtlinien mit den jeweiligen Erfahrungsbeispielen und Konzepten zu verknüpfen. Die in Kapitel sieben und acht aufgeführten Überlegungen und Konzepte fand ich großenteils in der Präsenzbibliothek des Landesinstitutes für Schule und Weiterbildung, Soest. Kapitel sieben richtet den Blick auf Überlegungen zur gesellschaftlichen und damit auch schulischen Situation (Stand 1992) und führt das Rollenspiel als schulisches Konzept zur Konfliktverarbeitung an, das sich auf Entrealisierung und Heimwelt in der Schule nach Husserl (Phänomenologie) und die sekundäre Sozialisationsfunktion der Schule beruft. Das achte Kapitel führt schließlich die Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit und Reflektionen zu seiner/ ihrer Funktion im Unterricht mit ausländischen Kindern aus.
Meine eigenen späteren Studien, insbesondere im Fach Sprachlehrforschung, Amerikastudien und DaF und Tätigkeiten als Lehrerin haben diese Arbeit nicht wiederlegen können, wenngleich die Komplexität der Aufgabenstellung andeutet, dass es keine rein pädagogische Arbeit ist, sondern Erkenntnisse ihrer Bezugswissenschaften, insbesondere der angewandten Linguistik, Bildungs- bzw. Schulpolitik der ausgewählten Länder und Entwicklungspsychologie, in besonderer Weise mit einbezieht.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Einwanderer in der Bundesrepublik Deutschland
- 2.1. Ausländische Arbeiter
- 2.2. Aussieder/ Umsiedler
- 2.3. Asylbewerber
- 2.3.1. Angaben zur Rechtsstellung
- 2.3.2. Hauptherkunftsländer 1991/1992
- 2.3.3. Angaben zur Wohnsituation
- 3. Rahmenbedingungen Interkultureller Erziehung
- 3.1. EG- Abkommen und deren bildungspolitischer Gehalt
- 3.2. Schulische Fördermaßnahmen
- 4. Ergänzende Fördermaßnahmen
- 4.1. Hort- und Hausaufgabenbetreuung der Caritas am Beispiel der Karlschule Freiburg
- 4.2. Stadtteilarbeit / Gemeinwesenorientierung
- 4.2.1. Regionale Arbeitsstellen zur Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher
- 4.2.2 RAA Dortmund: Modellversuch Ganztagsbetreuung
- 4.2.2.1. Soziokulturelle Voraussetzungen der GS Nordmarkt
- 4.2.2.2. Spezielle Maßnahmen der GS Nordmarkt
- 4.2.2.3. Die Fünf Phasen des Ganztags
- 4.2.2.4. Ganztagssituation der GS Nordmarkt
- 4.2.2.5. Freizeitangebot der GS Nordmarkt
- 4.2.2.6. "Der kleine Taubenschlag"
- 4.2.2.7. Initiative "Rund um den Nordmarkt"
- 5. Mutter-/Fremdsprachlicher Unterricht
- 5.1. Richtlinien
- 5.2. Kooperation muttersprachlicher und RegelklassenlehrerInnen
- 5.3. Begegnungs-/Fremdsprache
- 5.3.1. Konzepte und ihre Umsetzung
- 5.3.2. GS Nordmarkt: Portugiesisch auch in Regelklassen
- 6. Anfangsunterricht Sprache
- 6.1. Bedeutung der Sprache für den Schüler
- 6.1.1. Deutsch als Fremdsprache
- 6.1.2. Deutsch als Zweitsprache
- 6.1.3. Deutsch als Zielsprache
- 6.1.4. Deutsch als Interimsprache
- 6.2. Erfahrungsberichte
- 6.2.1. Förderkurs an einer Iserlohner Grundschule
- 6.2.1.1. Soziokulturelle Voraussetzungen
- 6.2.1.2. Schulische Fördermaßnahme
- 6.2.2. Auffangklasse GS Nordmarkt
- 6.2.3. Vorbereitungsklasse der Karlschule Freiburg
- 6.2.1. Förderkurs an einer Iserlohner Grundschule
- 6.3. Medienmarkt Anfangsunterricht Sprache
- 6.1. Bedeutung der Sprache für den Schüler
- 7. Gemeinsames Lernen
- 7.1. Neue "Heimwelt" und "Entrealisierung" in der Schule
- 7.2. Rollenspiel im Unterricht
- 7.2.1. Formen und Ziele des Rollenspiels
- 7.2.2. Struktur des Rollenspiels im Unterricht
- 7.2.3. Unterrichtseinheit
- 7.2.4. Zusammenfassung und Ausblick
- 8. LehrerIn in der Rolle des Lernenden
- 8.1. Seine/ Ihre Funktion im offenen Unterricht
- 8.2. Interkulturelle Selbsterfahrung in der Lehrerfortbildung
- 9. Literaturhinweise
- 10. Anlagen (Kassette "Der kleine Taubenschlag u.a.")
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Thematik der multikulturellen Erziehung an Grundschulen. Ziel ist es, die Herausforderungen und Möglichkeiten der Integration von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen in den deutschen Schulalltag zu beleuchten. Dabei werden die spezifischen Bedingungen in der Bundesrepublik Deutschland sowie die bildungspolitischen Rahmenbedingungen berücksichtigt.
- Einwanderergruppen in Deutschland und ihre Situation
- Bildungspolitische Rahmenbedingungen für interkulturelle Erziehung
- Fördermaßnahmen und Konzepte für die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
- Rolle der Sprache im interkulturellen Kontext
- Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit und der interkulturellen Kompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der multikulturellen Erziehung an Grundschulen ein und erläutert die Relevanz des Themas. Das zweite Kapitel beleuchtet verschiedene Einwanderergruppen in der Bundesrepublik Deutschland, ihre Situation und spezifischen Herausforderungen. Das dritte Kapitel behandelt die bildungspolitischen Rahmenbedingungen für interkulturelle Erziehung, die die Handlungsmöglichkeiten im Schulalltag prägen.
Das vierte Kapitel stellt verschiedene Fördermaßnahmen und Konzepte vor, die die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund unterstützen. Die zentrale Bedeutung der Sprache wird in den Kapiteln fünf und sechs behandelt, wobei Richtlinien, Erfahrungsbeispiele und Konzepte miteinander verknüpft werden.
Das siebte Kapitel beleuchtet Überlegungen zur aktuellen gesellschaftlichen Situation und der Rolle des Rollenspiels als schulisches Konzept zur Konfliktverarbeitung. Das achte Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit und der Reflexion ihrer Funktion im Unterricht mit ausländischen Kindern.
Schlüsselwörter
Multikulturelle Erziehung, Integration, Einwanderung, Migrationshintergrund, Interkulturelle Kompetenz, Sprachförderung, Deutsch als Zweitsprache, Rollenspiel, Lehrerpersönlichkeit, Schulische Handlungsmöglichkeiten, Bildungspolitik, Modellversuch, Ganztagsbetreuung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel multikultureller Erziehung?
Ziel ist die Integration ausländischer Kinder durch die Förderung von Vielfalt, gegenseitigem Verständnis und die Berücksichtigung ihrer soziokulturellen Hintergründe im Schulalltag.
Welche Rolle spielt die Sprache bei der Integration?
Sprache ist zentral für den schulischen Erfolg. Die Arbeit unterscheidet zwischen Deutsch als Fremdsprache, Zweitsprache und Interimsprache und betont die Bedeutung von muttersprachlichem Unterricht.
Was ist das "Dortmunder Konzept"?
Ein Modellversuch zur Ganztagsbetreuung (z. B. an der GS Nordmarkt), der spezielle Fördermaßnahmen und Freizeitangebote kombiniert, um die soziokulturellen Voraussetzungen der Kinder auszugleichen.
Wie können Rollenspiele im Unterricht helfen?
Rollenspiele dienen als Konzept zur Konfliktverarbeitung und ermöglichen es Kindern, verschiedene Perspektiven einzunehmen und soziale Kompetenzen in einem geschützten Rahmen zu üben.
Welche Anforderungen werden an Lehrer in multikulturellen Klassen gestellt?
Lehrer müssen interkulturelle Selbsterfahrung sammeln und ihre Rolle im offenen Unterricht reflektieren, um den Bedürfnissen ausländischer Kinder gerecht zu werden.
- Quote paper
- Jutta Mahlke (Author), 1993, Einheit durch Vielfalt - Überlegungen zur multikulturellen Erziehung an Grundschulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28781