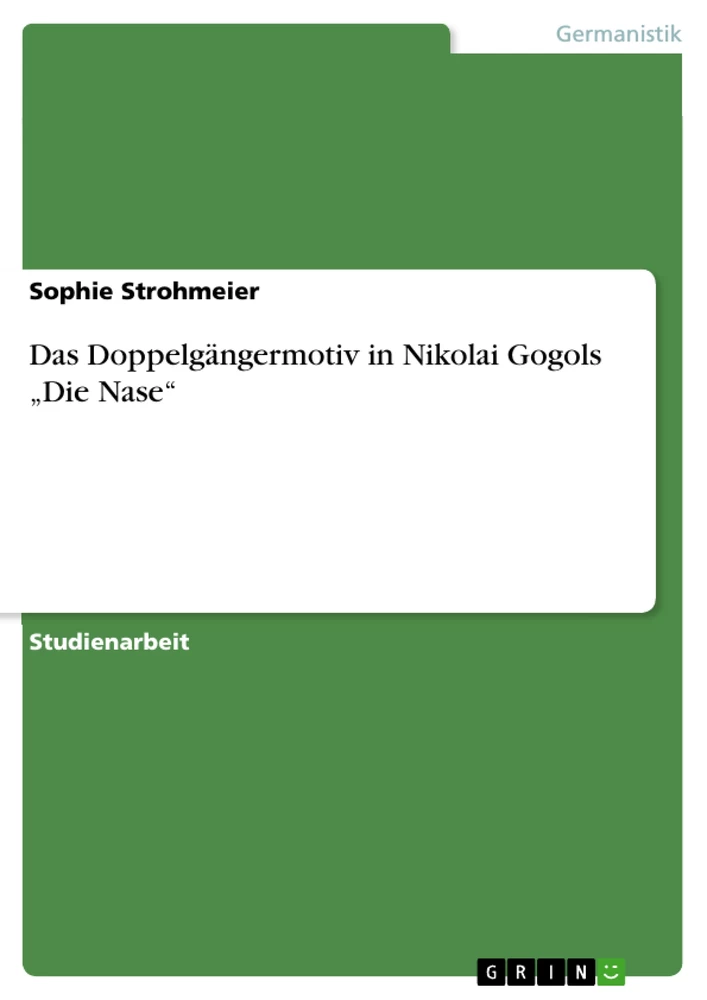Die Novelle „Die Nase“ entstand 1836 (Günther 1986: S.131) als Teil der Petersburger Erzählungen von Nikolai Gogol, einer Zeit in der das Phänomen Romantik in ganz Europa um sich griff (Wilpert 2001: S.706). Gogol war einer der bekanntesten Vertreter der Romantiker Russlands und es ist anzunehmen, dass er auch Werke von anderen Schriftstellern der Romantik kannte (Berger 1978: S.107).
Die Ähnlichkeit der Werke Gogols, mit denen europäischer Romantiker, wie beispielweise E.T.A. Hoffman oder Adalbert Chamisso sind nicht zu übersehen und zeigt das Phänomen Romantik als ein internationales. Auch Gogol arbeitet in seinen Texten mit der, in der Romantik so beliebten, Mystik, der dunklen unerklärlichen Macht, die die reale Welt zu überschatten droht. Auch das Motiv des Doppelgängers, das im 19. Jahrhundert Teil vieler Texte ist, vereint Gogol mit anderen romantischen Autoren. „Die Nase“ ist jedoch, vor allem in der Hinsicht auf ihre Nähe zur Romantik ein besonderes Werk. Ihr scheint die Mystik und Bedrohung völlig zu fehlen, in Gogols Novelle wird das Doppelgängermotiv sogar auf eine komische Ebene gehoben (Berger 1978: S.121). Wie bereits bei Hoffmann und Chamisso dreht sich in der „Nase“ alles um die Abspaltung eines Teils von einem Individuum und die Probleme, die sich daraus ergeben. Trotz dieser vordergründigen Motivähnlichkeit, behandelt Gogol das Thema auf ganz andere Weise als seine Zeitgenossen und schafft so ein Werk, das unzählige Interpretationswege eröffnet. Bevor diese Interpretationswege untersucht werden, wird zuerst das Motiv des Doppelgängers und der Nase, als doch sehr ungewöhnlicher Doppelgänger, näher betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Gogol als Romantiker? Unterschiede in „Die Nase“
- Das Doppelgängermotiv in „Die Nase“ bei Renate Lachmann
- Das Doppelgängermotiv in „Die Nase“ bei Willy R. Berger
- Das Doppelgängermotiv in „Die Nase“ bei Hans Günther
- Fazit
- „Die Nase“ als Reaktion Gogols auf seine Realität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Thesenpapier untersucht das Doppelgängermotiv in Nikolai Gogols Novelle „Die Nase“ im Kontext der europäischen Romantik. Es analysiert verschiedene Interpretationen des Motivs, insbesondere die von Renate Lachmann und Willy R. Berger, und beleuchtet die Frage, inwieweit Gogols Werk als eine Parodie auf die Romantik verstanden werden kann.
- Das Doppelgängermotiv in der Romantik und seine Umsetzung bei Gogol
- Interpretation des Nasen-Doppelgängers als Parodie der Seelenspaltung
- Vergleich mit anderen romantischen Doppelgänger-Erzählungen (z.B. Hoffmann, Chamisso)
- Gogols komisch-grotesker Umgang mit dem Motiv der Mystik
- Kovalev als anti-romantischer Held
Zusammenfassung der Kapitel
Gogol als Romantiker? Unterschiede in „Die Nase“: Die Novelle „Die Nase“, entstanden 1836, wird im Kontext der europäischen Romantik betrachtet. Gogols Werk weist zwar Ähnlichkeiten mit romantischen Texten anderer Autoren auf, insbesondere hinsichtlich des Doppelgängermotivs und der Beschäftigung mit dem Mystischen. Allerdings hebt sich „Die Nase“ durch ihren komischen und grotesken Ton deutlich von der oft düsteren und unheimlichen Atmosphäre romantischer Doppelgängergeschichten ab. Der Fokus liegt auf der ungewöhnlichen Wahl der Nase als Doppelgänger und der darauf folgenden Analyse verschiedener Interpretationen.
Das Doppelgängermotiv in „Die Nase“ bei Renate Lachmann: Lachmann interpretiert die abgetrennte Nase als Parodie auf die romantische Seelenspaltung. Sie argumentiert, dass die Nase aufgrund ihrer anatomischen Nähe zum Phallus als besonders geeigneter Doppelgänger fungiert. Die eigenmächtige Abspaltung der Nase wird als Parodie auf das Usurpatormotiv verstanden. Die Nase wird als Simulakrum gesehen, eine geheime Identität, die Kovalev nutzt, um gesellschaftliche Normen zu umgehen. Die Entstehung des neuen Körpers aus dem eigenen wird auch als eine Art Versicherung gegen den Tod betrachtet.
Das Doppelgängermotiv in „Die Nase“ bei Willy R. Berger: Berger vergleicht Gogols Novelle mit Werken von Chamisso und Hoffmann, die ebenfalls das Doppelgängermotiv behandeln. Er argumentiert, dass Gogol klassische romantische Motive bewusst umkehrt und parodiert. Im Gegensatz zu den Doppelgängern bei Chamisso und Hoffmann, die durch Selbstverschulden entstehen, geschieht der Verlust der Nase bei Kovalev ohne sein Zutun. Berger betont die komisch-groteske Natur der Novelle, die auf der Umkehrung romantischer Konventionen und der Figur des Kovalev als anti-romantischen Helden beruht. Der Nasendoppelgänger ist Kovalev überlegen, was die parodistische Absicht unterstreicht.
Schlüsselwörter
Doppelgängermotiv, Nikolai Gogol, Die Nase, Romantik, Parodie, Renate Lachmann, Willy R. Berger, Simulakrum, Kovalev, grotesk, komisch, Seelenspaltung, intertextuell.
Häufig gestellte Fragen zu: Gogols "Die Nase" - Eine Analyse des Doppelgängermotivs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Doppelgängermotiv in Nikolai Gogols Novelle "Die Nase" im Kontext der europäischen Romantik. Sie untersucht verschiedene Interpretationen des Motivs, insbesondere von Renate Lachmann und Willy R. Berger, und beleuchtet die Frage, ob Gogols Werk als Parodie der Romantik verstanden werden kann.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Doppelgängermotiv in der Romantik und dessen Umsetzung bei Gogol, die Interpretation des Nasen-Doppelgängers als Parodie der Seelenspaltung, einen Vergleich mit anderen romantischen Doppelgänger-Erzählungen (z.B. Hoffmann, Chamisso), Gogols komisch-grotesken Umgang mit dem Motiv der Mystik und Kovalev als anti-romantischen Helden.
Welche Interpretationsansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Interpretationen des Doppelgängermotivs in "Die Nase" von Renate Lachmann und Willy R. Berger. Lachmann sieht die abgetrennte Nase als Parodie auf die romantische Seelenspaltung und ein Simulakrum, während Berger Gogols Werk als bewusste Umkehrung und Parodie klassischer romantischer Motive interpretiert, indem er Vergleiche zu Chamisso und Hoffmann zieht.
Wie wird Gogols "Die Nase" im Kontext der Romantik eingeordnet?
Die Arbeit argumentiert, dass Gogols "Die Nase", obwohl sie Ähnlichkeiten mit romantischen Texten aufweist (Doppelgängermotiv, Mystik), sich durch ihren komischen und grotesken Ton deutlich von der oft düsteren Atmosphäre romantischer Doppelgängergeschichten abhebt. Gogol parodiert und überdreht bewusst romantische Elemente.
Welche Rolle spielt die Figur Kovalev?
Kovalev wird als anti-romantischer Held präsentiert, der im Gegensatz zu den Helden romantischer Doppelgängergeschichten steht. Der Nasendoppelgänger ist ihm überlegen, was die parodistische Absicht Gogols unterstreicht.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Doppelgängermotiv, Nikolai Gogol, Die Nase, Romantik, Parodie, Renate Lachmann, Willy R. Berger, Simulakrum, Kovalev, grotesk, komisch, Seelenspaltung, intertextuell.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Gogol als Romantiker und den Unterschieden in "Die Nase", den Interpretationen des Doppelgängermotivs bei Lachmann und Berger, einem Fazit und einer Betrachtung von "Die Nase" als Reaktion Gogols auf seine Realität.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen können über die genannten Autoren (Lachmann, Berger) und durch Recherchen zum Doppelgängermotiv in der Romantik und zu Gogols Werk gewonnen werden.
- Arbeit zitieren
- Sophie Strohmeier (Autor:in), 2012, Das Doppelgängermotiv in Nikolai Gogols „Die Nase“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287845