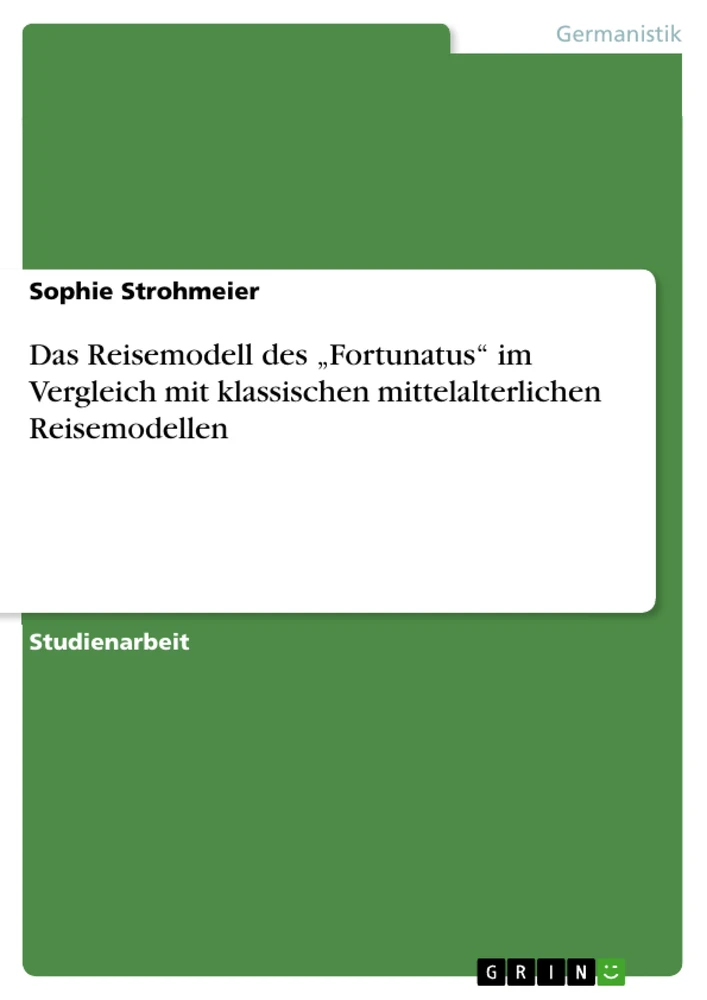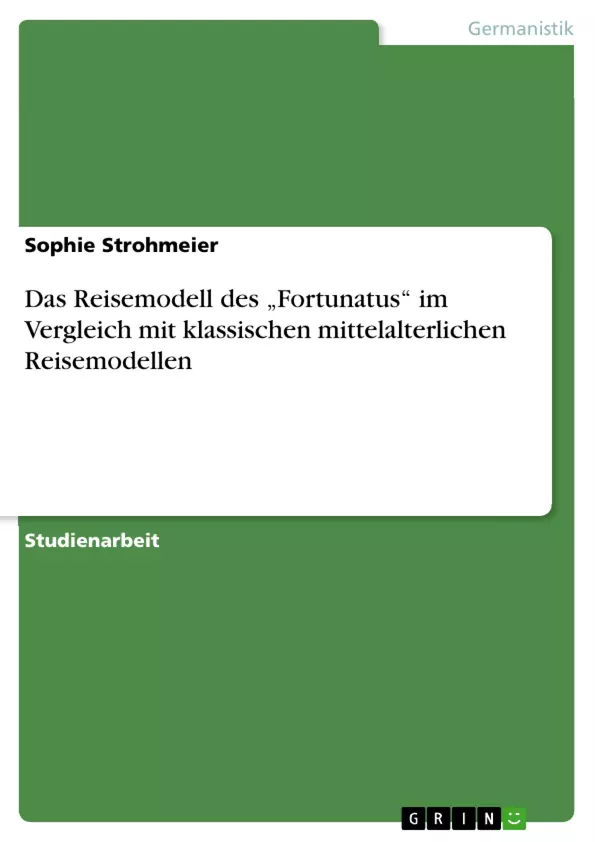Der etwa um 1500 entstandene „Fortunatus“ war auch aufgrund des etwa zur gleichen Zeit entstandenen Buchdruckverfahrens einer der ersten Bestseller der frühen Neuzeit. Das Buch kann als direkter Vorläufer des modernen Romans gesehen werden, da es sich vor allem durch seine Fiktionalität, Komplexität und Realitätsnähe auszeichnet. Gleichzeitig spiegelt die Handlung auch die Diskurse der Zeit des anonymen Verfassers wieder.
Besonderes Augenmerk soll hier auf die Reisen des Fortunatus gerichtet werden, beziehungsweise auf das neue Motiv des Reisens in der frühen Neuzeit. Der Beginn der Neuzeit ist auch der Beginn eines Zeitalters der Reisen, was vor allem durch vielen die Entdeckungsreisen dieser Zeit belegt werden kann. Das im Mittelalter eher negativ konnotierte Motiv des Reisens, die curiositas, die man im Sinne des sinn- und ziellos Umherschweifens verstand, bekommt in der frühen Neuzeit einen neuen Bedeutungshorizont. Das Reisen aufgrund von curiositas und nicht nur zur Vertiefung des Glaubens, dient nun ebenso wie ratio der Erkenntnis, der Erweiterung des kulturellen Wissens. Dieses Motiv des Reisens ist auch immer wieder Gegenstand der Literatur und wird, wie man im Kontrast zum, etwa zu gleichen Zeit entstandenen, „Narrenschiff“ von Sebastian Brandt zum „Fortunatus“ sieht, sehr unterschiedlich reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- „Fortunatus“ als erster Roman?
- Vergleich mit „Erec“ und dem „Alexanderroman“
- Die aventiure in „Erec“
- Der Reisebericht im „Alexanderroman“
- Vergleich mit dem „Fortunatus“
- Reisen vor Erhalt des seckels.
- Reisen nach Erhalt des seckels.
- Direkter Vergleich mit dem Reisebericht Alexanders.
- Reisen zum Selbstzweck?
- Der wahre Nutzen des seckels
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Thesenpapier analysiert das Reisemodell im „Fortunatus“ im Kontext der frühen Neuzeit und stellt es in Beziehung zu klassischen mittelalterlichen Reisemodellen, die in „Erec“ und dem „Alexanderroman“ repräsentiert werden. Ziel ist es, die Entwicklung des Reisemotivs im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit aufzuzeigen und den Wandel der Reisemotivation, -art und -bedeutung zu beleuchten.
- Das Reisemodell des „Fortunatus“ und seine Abgrenzung zu mittelalterlichen Konzepten
- Die Rolle der „curiositas“ und des „Wissensgewinns“ im Reisemotiv der frühen Neuzeit
- Der Einfluss der Herrscherfigur und ihrer Motivationen auf die Reisegestaltung
- Der Vergleich zwischen „Erec“, „Alexanderroman“ und „Fortunatus“ hinsichtlich ihrer Reisekonzepte
- Die Bedeutung des „Säckels“ im „Fortunatus“ für die Entwicklung des Reisemotivs
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den „Fortunatus“ als frühen Roman und seine Bedeutung im Kontext der frühen Neuzeit, wobei besonderes Augenmerk auf das neuartige Reisemotiv gelegt wird. Im zweiten Kapitel werden die Reisemodelle in „Erec“ und dem „Alexanderroman“ als Referenzpunkte des Mittelalters herangezogen. Es wird die „aventiure“ in „Erec“ als Darstellung des ritterlichen Werdegangs und der Reise als Mittel zur Wiederherstellung der Ehre erläutert. Der „Alexanderroman“ hingegen dient als Beispiel für die Forschungsreise im Mittelalter und stellt die Biographie Alexanders des Großen in den Mittelpunkt. Das dritte Kapitel vergleicht das Reisemodell des „Fortunatus“ mit den beiden mittelalterlichen Vorbildern und analysiert die Reisen des Titelhelden vor und nach dem Erhalt des Säckels.
Schlüsselwörter
„Fortunatus“, „Reisemotiv“, „aventiure“, „Forschungsreise“, „curiositas“, „Wissensgewinn“, „frühe Neuzeit“, „Mittelalter“, „Erec“, „Alexanderroman“, „Säckel“, „Herrscherfigur“, „Motivation“, „Handlung“, „Roman“, „Buchdruckverfahren“, „Bestseller“, „Fiktionalität“, „Komplexität“, „Realitätsnähe“, „Diskurse“.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt "Fortunatus" als einer der ersten modernen Romane?
Er zeichnet sich durch Fiktionalität, eine komplexe Handlung und eine für die damalige Zeit (um 1500) ungewöhnliche Realitätsnähe aus.
Wie unterscheidet sich das Reisen im "Fortunatus" vom Mittelalter?
Im Mittelalter war Reisen oft religiös oder ritterlich motiviert (Aventiure). Im "Fortunatus" wird "curiositas" (Wissbegierde) zum legitimen Grund für Bildungs- und Entdeckungsreisen.
Welche Rolle spielt der "Säckel" in der Geschichte?
Der magische Glückssäckel ermöglicht es Fortunatus, unabhängig von Stand und Herkunft die Welt zu bereisen und Wissen sowie kulturelles Kapital zu erwerben.
Was bedeutet "curiositas" in der frühen Neuzeit?
Während sie im Mittelalter als zielloses Umherschweifen negativ besetzt war, wandelte sie sich in der Neuzeit zu einem Instrument der Erkenntnis und Welterfahrung.
Wie wird "Erec" als mittelalterliches Vergleichsmodell herangezogen?
In Hartmann von Aues "Erec" dient die Reise der Wiederherstellung der ritterlichen Ehre und dem Bestehen von Abenteuern, was einen starken Kontrast zum zweckorientierten Reisen des Fortunatus darstellt.
- Citar trabajo
- Sophie Strohmeier (Autor), 2013, Das Reisemodell des „Fortunatus“ im Vergleich mit klassischen mittelalterlichen Reisemodellen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287851