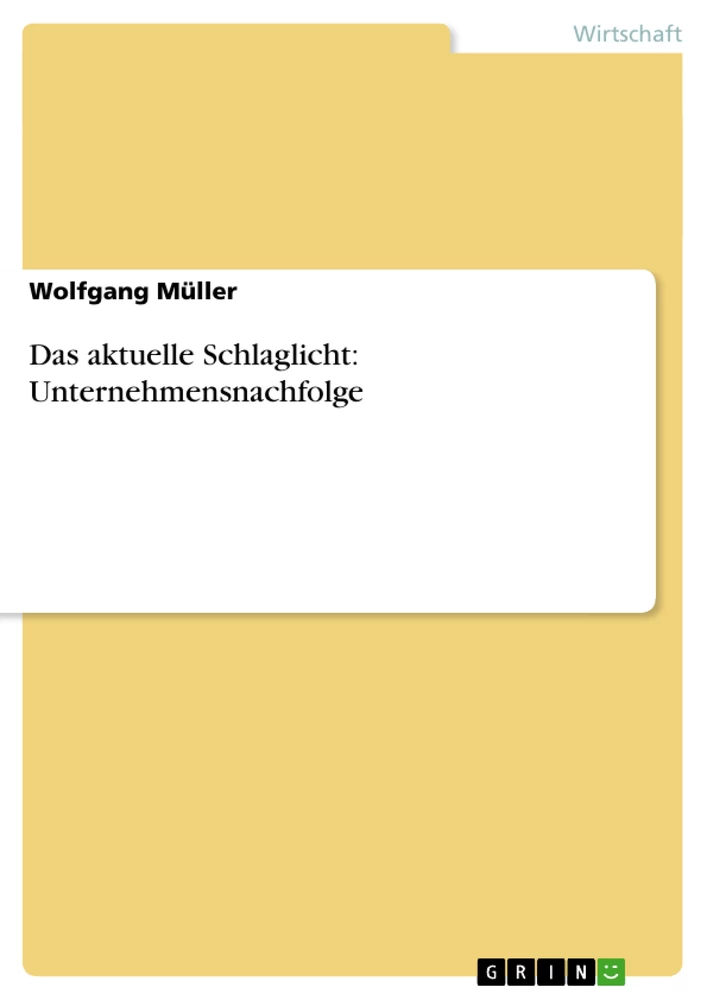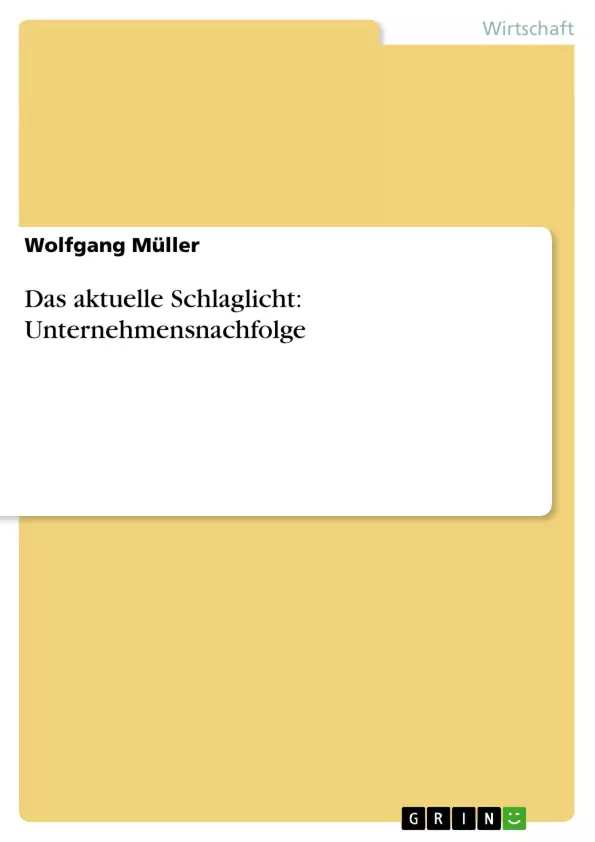In der Reihe „Schlaglicht“ erscheinen regelmäßige kurze Aufsätze, in denen aktuelle Probleme des Mittelstands dargestellt und Möglichkeiten zu deren Lösung aufgezeigt werden. Die wesentlichen Inhalte eines jeden Aufsatzes werden einleitend in Stichworten beschrieben. Dadurch wird es dem Leser ermöglicht, direkt zu einem ihn besonders interessierenden Aspekt zu gelangen.
Das aktuelleSchlaglicht: Unternehmensnachfolge
In der Reihe „Schlaglicht“ erscheinen regelmäßige kurze Aufsätze, in denen aktuelle Probleme des Mittelstands dargestellt und Möglichkeiten zu deren Lösung aufgezeigt werden. Die wesentlichen Inhalte eines jeden Aufsatzes werden einleitend in Stichworten beschrieben. Dadurch wird es dem Leser ermöglicht, direkt zu einem ihn besonders interessierenden Aspekt zu gelangen.
Stichworte: 1. Versorgung des Unternehmensübergebers – 2. Steueroptimierung – 3. Erfolg des Erwerbers
Dipl.-Kfm. Dr. Wolfgang Müller WP/StB*
0. Das Problem im Überblick
Bei der Industrie- und Handelskammern, bei den Handwerkskammern und im Internet bei privaten Vermittlern werden viele Unternehmen angeboten, die keinen Erwerber finden.
Bezogen auf den kleinen Mittelstand kristallisiert sich heraus, dass bei den Handwerksberufen noch eine große Nachfrage bei den Auftragebern besteht, die eine Unternehmensnachfolge sinnvoll machen. Oftmals finden diese Betriebe keinen Nachfolger.
Im Einzel- und Großhandel hat sich die Lage für den Mittelstand in den letzten Jahren extrem verschlechtert. In den Großstädten ist in den 1a-Lagen der kleine Mittelstand komplett verschwunden. Demzufolge ist eine Nachfolge sehr schwierig.
Bei den Freiberuflern ist die Lage uneinheitlich. Bei Rechtsanwalts- und Steuerberatungspraxen besteht noch eine Nachfrage bei potentiellen Erwerbern. Im Ärztebereich werden die Firmenwerte der Praxen nur noch minimal vergütet.
Die Beratungspraxis hat ergeben, dass eine frühzeitige Nachfolgeplanung am ehesten von Erfolg gekrönt ist In erster Linie kommen eigene Familienmitglieder in Frage. Ist dies nicht der Fall, kann der potentielle Nachfolger frühzeitig im Betrieb aufgebaut werden.
Als letzte Variante kommt der Verkauf kurz vor Renteneintritt bzw. Rückzug des Inhabers in Frage. Die Erfahrung zeigt, dass bei „interessanten“ Betrieben vor allem größere Firmen als Erwerber in Betracht kommen.
1. Versorgung des bisherigen Firmeninhabers
Bei den begleiteten Unternehmensübergaben ist die Ermittlung des Kaufpreises naturgemäß der kritischste Punkt. Erleichtert wird die Kaufpreisfindung, wenn der Übergeber eine vernünftige Altersversorgung hat. In diesem Fall kann der Übergeber an Familienmitglieder das Unternehmen eventuell sogar unentgeltlich übertragen.
Falls ein größeres Unternehmen den Betrieb erwirbt, wird in der Regel ein Kaufpreis bezahlt. Die Ermittlung des Kaufpreises ist in der Praxis schwierig. Oftmals werden Earn-out-Klauseln vereinbart, um Übergeber und Erwerber die Sicherheit für künftige Ereignisse zu liefern. Bei positivem Verlauf erhöht sich der Kaufpreis, bei schlechten verringert er sich. In der Praxis ergeben sich Probleme bei der Nachprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse, da der Veräußerer in der Regel aus dem Betrieb ausgeschieden ist. Erfahrungsgemäß werden die Betriebe oftmals zu günstig veräußert, da es nicht genügend Interessenten gibt.
Bei Übergabe des Betriebes an einen Familienangehörigen oder Mitarbeiter kann ein Modell gewählt werden, in dem der Übergeber auch in Zukunft am Ergebnis des Betriebes partizipiert. Als Möglichkeiten kommen das Verbleiben als Gesellschafter, Nießbrauch oder Zurückbehaltung der Immobilien in Betracht.
2. Steueroptimierung
Bei Veräußerung des Betriebes zu Verkehrswerten spielt das Erbschaftssteuergesetz keine Rolle. Der Veräußerungsgewinn ist in der Regel tarifbegünstigt zu versteuern. Dies ist abhängig von der Rechtsform. In der Regel können höhere Veräußerungsgewinne erzielt werden, wenn die stillen Reserven, die bezahlt werden, abgeschrieben werden können.
Falls der Betrieb un- oder teilentgeltlich übergeht, ist das Erbschaftssteuergesetz zu beachten. Durch Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 17.12.2014 wurde das Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Es gilt jedoch bis zur Neufassung durch den Gesetzgeber weiter. Als Frist wurde dem Gesetzgeber Mitte 2016 gesetzt. Erfahrungsgemäß wird der Gesetzgeber zum 01.01.2016 ein neues Erbschaftsteuergesetz verabschieden. Demzufolge ist Eile geboten.
Bei Unternehmensübergaben an Familienmitglieder oder Mitarbeiter ist in der Regel die Rechtsform des Betriebes umzustrukturieren, um das gewünschte wirtschaftliche Ergebnis ertragssteuerneutral zu gestalten.
3. Erfolg des Erwerbers
Der Erwerber des Betriebes muss in der Regel dem Übergeber einen Teil des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses überlassen und will ein höheres Einkommen erzielen, als wenn er Arbeitnehmer (geblieben) wäre, da er jetzt auch ein wirtschaftliches Risiko trägt.
Die Aufgaben nach der Übernahme sind vielfältig. Der Erwerber muss Kunden halten und neue hinzugewinnen. Das Personal muss neu motiviert werden. Oftmals sind auch Prozesse im Betrieb neu zu gestalten
Um die wirtschaftliche Entwicklung und Zukunftstendenzen genau abschätzen zu können benötigt der Erwerber gute Controllinginstrumente, die auf dem Rechnungswesen beruhen und fortentwickelt werden müssen.
4. Fazit
Die dargestellten Problemfelder und deren Lösungsschritte, die letztendlich zum gewünschten Erfolg für Übergeber und Erwerber führen, sind durch eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zu begleiten, die die Probleme des Mittelstandes aus ihrer täglichen Arbeit kennt. Sie muss gleichzeitig über rechtliches, steuerrechtliches und betriebswirtschaftliches know how, um eine erfolgreiche Unternehmensübergabe zu ermöglichen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in „Das aktuelle Schlaglicht: Unternehmensnachfolge“?
Der Text behandelt das Thema der Unternehmensnachfolge im Mittelstand. Es werden Probleme und Lösungsansätze aufgezeigt, die bei der Übergabe eines Unternehmens auftreten können. Die Schwerpunkte liegen auf der Versorgung des Unternehmensübergebers, der Steueroptimierung und dem Erfolg des Erwerbers.
Welche Herausforderungen werden bei der Unternehmensnachfolge im Mittelstand identifiziert?
Viele angebotene Unternehmen finden keinen Erwerber. Besonders im Einzel- und Großhandel hat sich die Lage verschlechtert. Bei Handwerksberufen und Freiberuflern (Rechtsanwälte, Steuerberater) besteht noch eine Nachfrage. Eine frühzeitige Nachfolgeplanung ist wichtig.
Wie kann die Versorgung des bisherigen Firmeninhabers sichergestellt werden?
Die Ermittlung eines angemessenen Kaufpreises ist entscheidend. Eine vernünftige Altersversorgung des Übergebers erleichtert die Kaufpreisfindung. Alternativen sind Earn-out-Klauseln, Verbleiben als Gesellschafter, Nießbrauch oder Zurückbehaltung der Immobilien.
Welche steuerlichen Aspekte sind bei der Unternehmensnachfolge zu beachten?
Bei Veräußerung zu Verkehrswerten spielt das Erbschaftssteuergesetz keine Rolle, der Veräußerungsgewinn kann tarifbegünstigt versteuert werden. Bei un- oder teilentgeltlicher Übergabe ist das Erbschaftssteuergesetz relevant. Die Rechtsform des Betriebs muss unter Umständen umstrukturiert werden.
Was sind wichtige Faktoren für den Erfolg des Erwerbers?
Der Erwerber muss Kunden halten und neue hinzugewinnen, das Personal motivieren und Prozesse optimieren. Gute Controllinginstrumente auf Basis des Rechnungswesens sind notwendig.
Welche Rolle spielt eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft bei der Unternehmensnachfolge?
Eine erfahrene Gesellschaft kann die Problemfelder erkennen und Lösungswege aufzeigen. Sie verfügt über das notwendige rechtliche, steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Know-how für eine erfolgreiche Unternehmensübergabe.
Wer ist der Autor des Textes?
Der Autor ist Dipl.-Kfm. Dr. Wolfgang Müller WP/StB, Gesellschafter-Geschäftsführer der Dr. Müller & Kollegen GmbH und der ABG Müller-Jung GmbH mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Gestaltungspraxis der Unternehmensnachfolge.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Kfm. Dr. Wolfgang Müller (Autor:in), 2015, Das aktuelle Schlaglicht: Unternehmensnachfolge, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287974