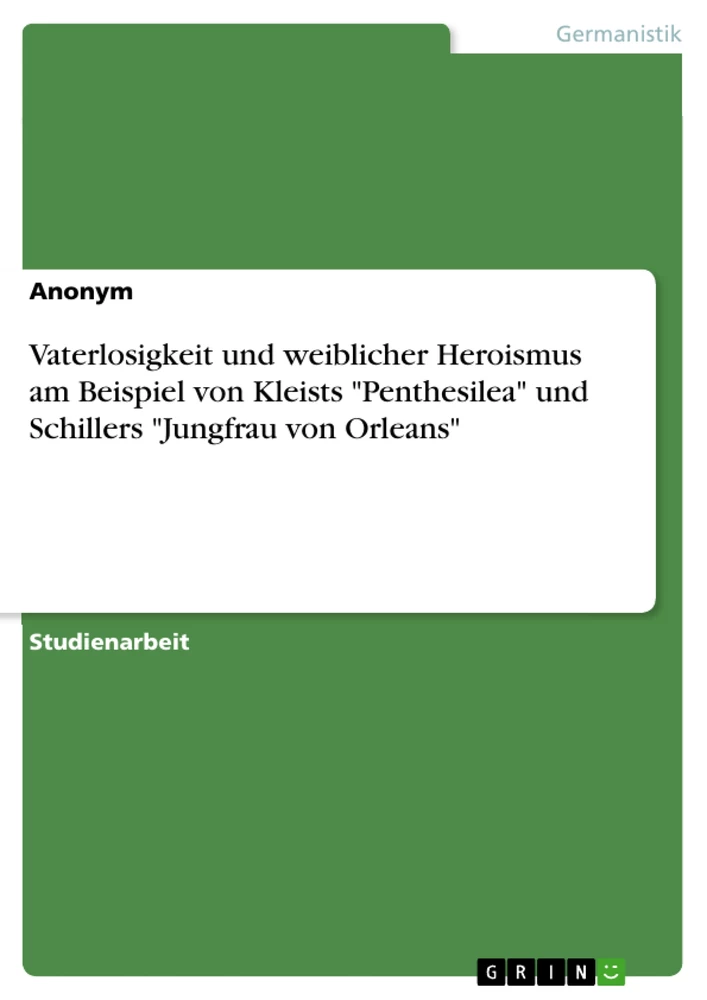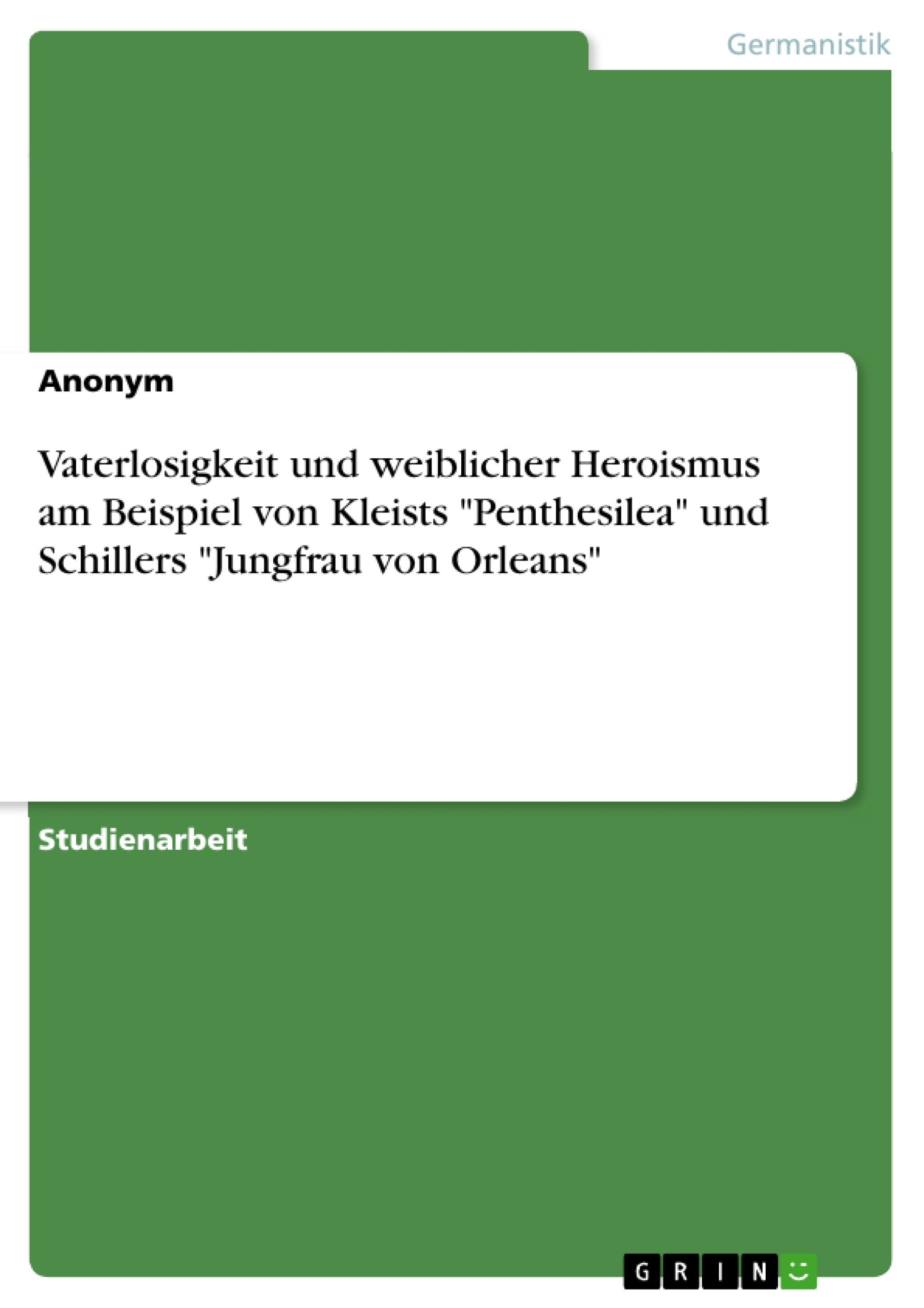Der Begriff der „Vaterlosen Gesellschaft“ ist fester Bestandteil der deutschen Literatur seit einigen Jahrzehnten. Er tauchte erstmals in Freuds „Totem und Tabu“ im Jahr 1913 auf und wurde nach dem Ersten Weltkrieg zur Kampfparole junger Intellektueller, Schriftsteller und Künstler, die damit königlich-kaiserlichen Repräsentanten für die Grauen des Krieges anklagten. Aktuell wird die Debatte um die Vaterlosigkeit und die Vaterverwandlung in den Kontext der Krise der Familie gestellt. Dies führt zu einer Verschärfung der Debatte.
Mit der „68er Bewegung“ setzte durch die erstarkende Frauenbewegung ein fundamentales Umdenken ein, das bis heute zu neuen Vaterbildern und zu neuen Rollenverständnissen in der Familie führte. In kürzester Zeit sorgte der Kampf um die Gleichberechtigung der Frau für Veränderungen in den verfestigten patriarchalen Ordnungen in Familie, Gesellschaft und Politik. Im Zuge des damaligen Generationskonflikt und der Studentenrebellion kam es außerdem zur Thematisierung eines weiteren tabuisierten Themas: der Konflikt zwischen Vater und Tochter. Freuds Analyse des Vater-Sohn-Konflikts in der Ödipusgeschichte zielte in erster Linie auf die Identitätsbildung des Mannes ab. Erst später wurde diese auch auf das weibliche Geschlecht und dessen Identitätsentwicklung abgewandelt. Der selbstbewusste feministische Diskurs um die Vaterfigur spiegelt sich in zahlreichen „Vaterbüchern“ der letzten 50 Jahre, in denen nun auch Töchter den Konflikt mit dem Vater beschreiben oder auf „Vatersuche“ gehen. Vater-Tochter-Konzepte werden nicht mehr nur aus der Perspektive der heterosexuellen Beziehung diskutiert, sondern sie sind Teil des gegenwärtigen Generations- und Familien-Konflikts.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vaterlosigkeit – eine sozialpsychologische Bestandsaufnahme
- Die vaterlosen Heroinnen Penthesilea und Johanna
- Die Amazone - Kleists Penthesilea
- Die Kriegerin - Schillers Jungfrau von Orleans
- Die vaterlose Frau als Bild der Imagination
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Themen der Vaterlosigkeit und des Vater-Tochter-Konflikts anhand der Figuren der weiblichen Kriegerinnen Penthesilea (Kleist) und Johanna (Schiller). Die Analyse zielt darauf ab, die Entwicklung und Fähigkeiten der Protagonistinnen im Kontext ihrer vaterlosen Existenz zu beleuchten und zu ergründen, inwiefern ihre Loslösung von der patriarchalen Ordnung ihre Rolle als kriegerische Heldinnen prägt.
- Die psychoanalytischen Aspekte der Vaterlosigkeit und der Vater-Tochter-Beziehung
- Die Entwicklung und das Verhalten der vaterlosen Protagonistinnen Penthesilea und Johanna
- Die Bedeutung der Loslösung von der patriarchalen Ordnung für das weibliche Heldentum
- Die Illusionen menschlicher Existenz im Kontext der Vaterlosigkeit
- Die Darstellung der weiblichen Gewalt und des weiblichen Heldentums in den Werken von Kleist und Schiller
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Vaterlosigkeit und des Vater-Tochter-Konflikts ein und stellt die Relevanz dieser Themen in der deutschen Literatur und Gesellschaft dar. Sie beleuchtet die historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die zur Debatte um die Vaterlosigkeit geführt haben, und stellt die Werke von Kleist und Schiller in den Kontext dieser Debatte.
Das zweite Kapitel widmet sich einer sozialpsychologischen Analyse der Vaterlosigkeit und der Vater-Tochter-Beziehung. Es beleuchtet die Bedeutung des Vaters als Archetyp und die Auswirkungen des Vaterverlustes auf die Entwicklung des Kindes. Die Kritik an den Theorien von Freud, Fromm und Mitscherlich hinsichtlich ihrer unzureichenden Auseinandersetzung mit den realen Auswirkungen der Vaterentbehrung wird ebenfalls thematisiert.
Das dritte Kapitel analysiert die Figuren der Penthesilea und der Johanna im Kontext ihrer vaterlosen Existenz. Es untersucht ihre Entwicklung, ihr Verhalten und ihre Rolle als kriegerische Heldinnen. Die Analyse beleuchtet die Bedeutung der Loslösung von der patriarchalen Ordnung für ihre Daseinsfunktion und die widersprüchliche Geschlechteridentität der beiden Frauen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Vaterlosigkeit, Vater-Tochter-Konflikt, weibliche Kriegerin, Penthesilea, Jungfrau von Orleans, Kleist, Schiller, Heldentum, patriarchale Ordnung, Geschlechterdiskurs, psychoanalytische Aspekte, Illusionen menschlicher Existenz.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff der „vaterlosen Gesellschaft“?
Der Begriff stammt ursprünglich von Freud und beschreibt eine Gesellschaft, in der patriarchale Autoritäten an Bedeutung verlieren, was besonders nach den Weltkriegen und durch die 68er-Bewegung thematisiert wurde.
Wie wird weiblicher Heroismus in Kleists „Penthesilea“ dargestellt?
Penthesilea verkörpert eine Amazonenkönigin, die außerhalb der patriarchalen Ordnung steht und deren Heldentum durch den radikalen Konflikt zwischen kriegerischer Pflicht und weiblichem Gefühl geprägt ist.
Welche Rolle spielt die Vaterlosigkeit für Schillers „Jungfrau von Orleans“?
Johanna löst sich von ihrem leiblichen Vater und der bäuerlichen Welt, um einer göttlichen (vaterähnlichen) Mission zu folgen, was sie zur kriegerischen Heroine macht.
Wie beeinflusste die Frauenbewegung den Diskurs um die Vaterfigur?
Sie führte zu einem fundamentalen Umdenken der patriarchalen Ordnung und zur Thematisierung des Vater-Tochter-Konflikts in der Literatur („Vaterbücher“).
Was sind die psychoanalytischen Aspekte der Vaterlosigkeit bei Heroinnen?
Die Arbeit untersucht, wie das Fehlen einer realen Vaterfigur die Identitätsbildung beeinflusst und zur Entwicklung einer kriegerischen, oft widersprüchlichen Geschlechteridentität führt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Vaterlosigkeit und weiblicher Heroismus am Beispiel von Kleists "Penthesilea" und Schillers "Jungfrau von Orleans", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288014