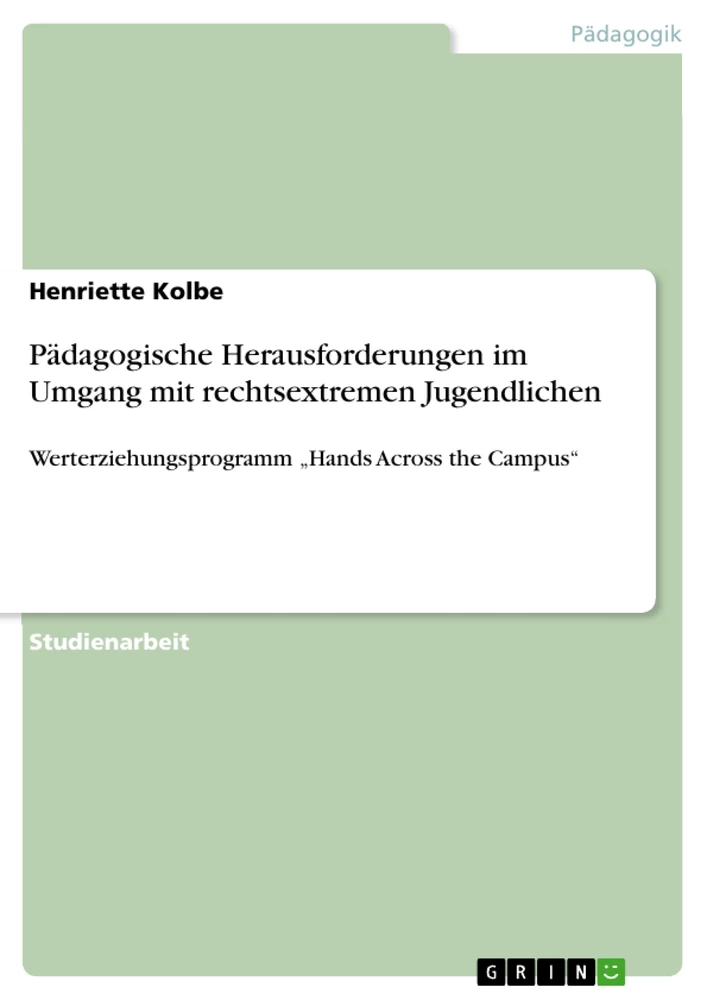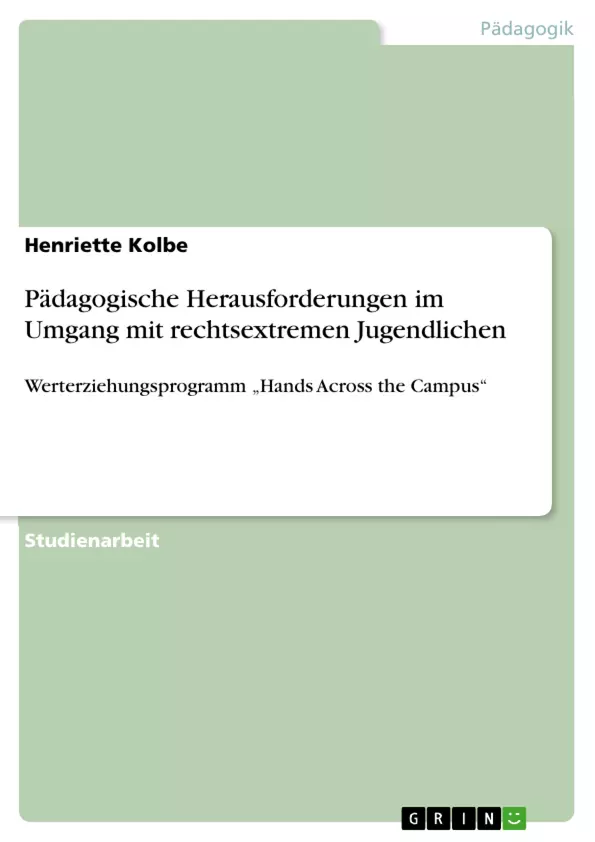Die persönlichen Werte geben einen Erklärungsansatz für das eigene Verhalten, da die Handlungsmotivation unter anderem durch Wertvorstellungen geprägt ist. Das, was für wertvoll erachtet wird, wird getan. Mittels Werten kann man sich definieren und sich auch an diesen orientieren. Gerade im Jugendalter, auf der Suche nach dem eigenen Ich in Loslösung vom Elternhaus, können Gruppierungen mit festen Regeln und Werten einen scheinbar einfachen Weg geben:
„Mir gefiel die neue Welt, die ich entdeckt hatte, sehr gut und ich war beeindruckt über den kameradschaftlichen Umgang miteinander, den Zusammenhalt in der Gruppe und das enorme Machtgefühl, das die Gruppe ausstrahlte. Auch wurde mir sofort ein Zugehörigkeitsgefühl gegeben und Hilfe angeboten.“ [Poleck 2002, S. 39]
So beschreibt rückblickend ein Aussteiger aus der rechtsradikalen Szene seine Faszination, die diese Gemeinschaft im Jugendalter auf ihn ausübte. Das Wissen über die Bedeutung von Wertvorstellungen kann in der pädagogischen Arbeit sehr von Nutzen sein, wenn beispielsweise ein sich delinquent verhaltender Jugendlicher/eine sich delinquent verhaltende Jugendliche wieder zurück in die Gesellschaft geholt werden soll. Statt Belehrungen wie „Du musst…“ und „Du sollst…“ bietet die Werterziehung eine solide Basis für ein konformes Leben in der Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen
- Rechtsextremismus
- Werte
- Besonderheit des Jugendalters
- Jugendliche und Rechtsextremismus
- Einstiegshintergründe und Entwicklung rechtsextremer Gruppierungen
- Werte rechtsorientierter Jugendlicher
- Pädagogische Herausforderungen
- Pädagogische Anforderungen im Allgemeinen
- Hands Across the Campus
- Kooperative Lernformen
- Service Learning
- Hands-Curriculum
- Youth Leadership Program
- Schlussbetrachtung
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den pädagogischen Herausforderungen im Umgang mit rechtsextremen Jugendlichen, insbesondere im Hinblick auf ihre Wertvorstellungen. Sie analysiert die Bedeutung von Werten für die Handlungsmotivation von Jugendlichen und untersucht, wie rechtsextreme Gruppierungen diese nutzen, um junge Menschen zu beeinflussen. Die Arbeit beleuchtet die Einstiegshintergründe und die Entwicklung rechtsextremer Gruppierungen sowie die spezifischen Wertvorstellungen dieser Jugendlichen. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche pädagogischen Ansätze und Programme geeignet sind, um rechtsextremen Jugendlichen alternative Werte und Perspektiven zu vermitteln.
- Die Bedeutung von Werten für die Handlungsmotivation von Jugendlichen
- Die Rekrutierung und Einflussnahme rechtsextremer Gruppierungen auf Jugendliche
- Die spezifischen Wertvorstellungen rechtsextremer Jugendlicher
- Pädagogische Herausforderungen im Umgang mit rechtsextremen Jugendlichen
- Die Wirksamkeit von Demokratiebildungsprogrammen wie "Hands Across the Campus"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der pädagogischen Herausforderungen im Umgang mit rechtsextremen Jugendlichen ein. Sie stellt die Bedeutung von Werten für die Handlungsmotivation von Jugendlichen heraus und beleuchtet die Faszination, die rechtsextreme Gruppierungen auf junge Menschen ausüben können.
Das Kapitel "Begriffsbestimmungen" definiert die Begriffe Rechtsextremismus und Werte und beleuchtet die Besonderheit des Jugendalters im Hinblick auf die Wertebildung. Es wird deutlich, dass Rechtsextremismus als ein Angriff auf die Gleichheit von Menschen verstanden werden kann, der mit sozialer, psychischer und physischer Ausgrenzung verbunden ist. Werte hingegen dienen als Orientierungspunkte für das Zusammenleben von Menschen und können sowohl regulierend als auch motivierend wirken.
Das Kapitel "Jugendliche und Rechtsextremismus" befasst sich mit den Einstiegshintergründen und der Entwicklung rechtsextremer Gruppierungen. Es werden die Faktoren beleuchtet, die junge Menschen anfällig für rechtsextreme Ideologien machen, sowie die Strategien, die rechtsextreme Gruppierungen zur Rekrutierung von Jugendlichen einsetzen. Zudem werden die spezifischen Wertvorstellungen rechtsextremer Jugendlicher im Hinblick auf Heitmeyers Definition von Rechtsextremismus analysiert.
Das Kapitel "Pädagogische Herausforderungen" beleuchtet die allgemeinen Anforderungen an die pädagogische Arbeit mit rechtsextremen Jugendlichen. Es werden die besonderen Herausforderungen im Umgang mit den Wertvorstellungen dieser Jugendlichen sowie die Notwendigkeit einer werteorientierten Pädagogik hervorgehoben. Im Anschluss wird das Demokratiebildungsprogramm "Hands Across the Campus" vorgestellt, das auf kooperative Lernformen, Service Learning und ein spezifisches Curriculum setzt, um junge Menschen für Demokratie und Toleranz zu sensibilisieren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Rechtsextremismus, Jugend, Werteerziehung, Pädagogik, Demokratiebildung, Hands Across the Campus, kooperative Lernformen, Service Learning, Youth Leadership Program. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen im Umgang mit rechtsextremen Jugendlichen und beleuchtet die Bedeutung von Werten für die Handlungsmotivation von Jugendlichen. Sie untersucht die Einstiegshintergründe und die Entwicklung rechtsextremer Gruppierungen sowie die spezifischen Wertvorstellungen dieser Jugendlichen. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche pädagogischen Ansätze und Programme geeignet sind, um rechtsextremen Jugendlichen alternative Werte und Perspektiven zu vermitteln.
Häufig gestellte Fragen
Warum fühlen sich Jugendliche von rechtsextremen Gruppen angezogen?
Oft suchen Jugendliche nach Orientierung, Zusammenhalt und einem Machtgefühl. Rechtsextreme Gruppen bieten klare Regeln, Kameradschaft und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl.
Welche Rolle spielen Werte in der pädagogischen Arbeit mit diesen Jugendlichen?
Werte prägen die Handlungsmotivation. Werterziehung bietet eine Basis, um delinquentes Verhalten zu reflektieren und Jugendliche durch alternative Werte wieder in die Gesellschaft zu integrieren.
Was ist das Programm "Hands Across the Campus"?
Es ist ein Demokratiebildungsprogramm, das auf kooperativem Lernen und Service Learning basiert, um Toleranz zu fördern und rechtsextremen Tendenzen entgegenzuwirken.
Wie definiert Heitmeyer Rechtsextremismus bei Jugendlichen?
Rechtsextremismus wird als Ideologie der Ungleichwertigkeit verstanden, die mit sozialer Ausgrenzung und oft auch Gewaltbereitschaft gegenüber als „fremd“ deklarierten Gruppen einhergeht.
Was sind die pädagogischen Anforderungen im Umgang mit delinquenten Jugendlichen?
Statt reiner Belehrung sind Beziehungsarbeit und die Vermittlung von Selbst- und Sozialkompetenzen entscheidend, um den Ausstieg aus extremistischen Szenen zu ermöglichen.
- Quote paper
- Henriette Kolbe (Author), 2014, Pädagogische Herausforderungen im Umgang mit rechtsextremen Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288124