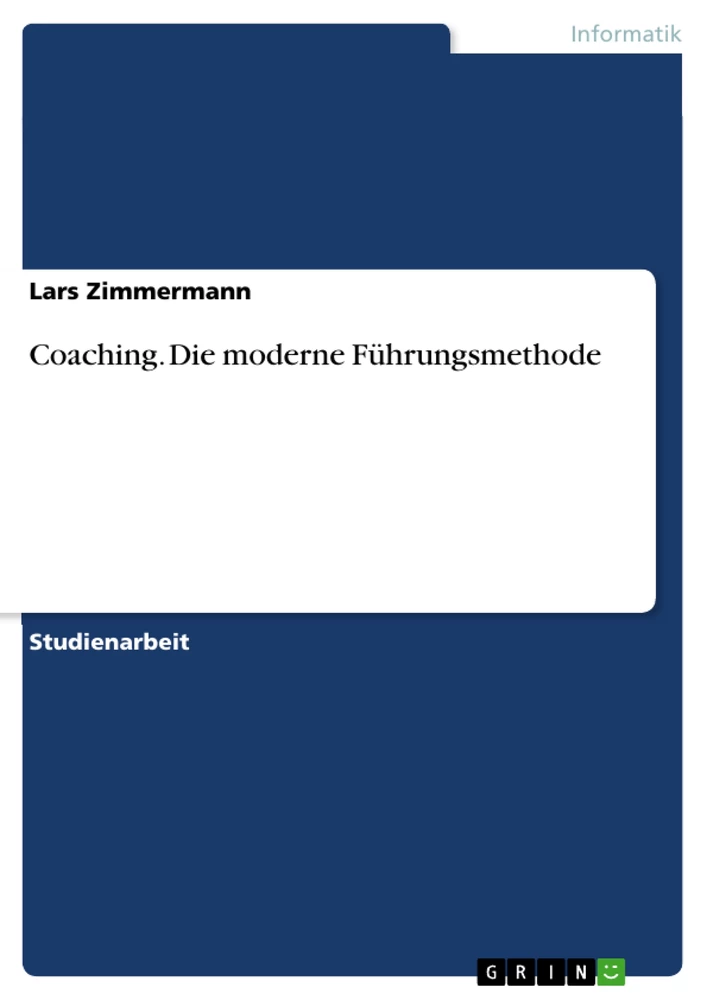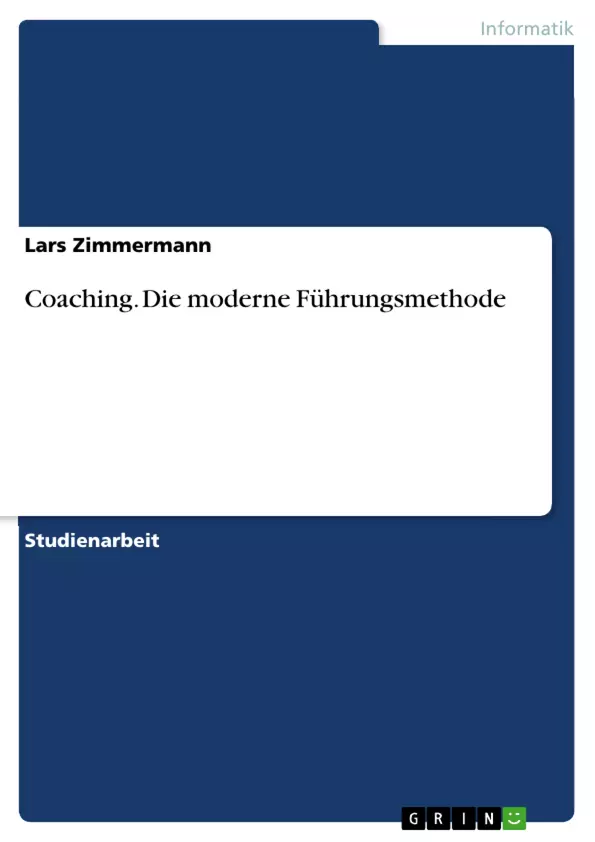Der Begriff Coaching ist zu einem Modewort geworden. Ob in Vereinen oder in Managementabteilungen, Coaches findet man immer dort, wo Weiterentwicklung, Unterstützung, Stärkung oder Training gebraucht wird.
Diese Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit dem Coachen von Mitarbeitern. Dabei werden die einzelnen Bestandteile des Coaching-Prozesses erklärt und die Ziele des Coachings erläutert. Im Coaching-Prozess nimmt dabei der Coach verschiedene Rollen ein, die auch in dieser Arbeit behandelt werden.
Die richtige Kommunikation zwischen Coach und seinen Mitarbeitern darf natürlich nicht fehlen, weshalb die verschiedenen Gesprächsanlässe untersucht und dargestellt werden. Weiterhin werden die erfolgreichen Methoden aus dem Spitzensport vorgestellt, die auch außerhalb des Sportbereiches dem Coaching zum Erfolg verhelfen.
Coaching bietet jeden Einzelnen eine Chance zur Verbesserung der eigenen, persönlichen Leistungspotenziale und letztendlich auch die Leistungsfähigkeit des Unternehmens.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Unternehmen benötigen moderne Führungsmethoden.
- 2 Wie wird der Begriff Führung definiert?
- 2.1 Personalführung, Unternehmensführung und Leitung.
- 2.2 Klassische und moderne Führungsstile.
- 2.2.1 Autokratische, kooperative und laisser-faire Führung.
- 2.2.2 Management-by-Methoden.
- 3 Die Führungsmethode Coaching
- 3.1 Definition des Coaching-Begriffs
- 3.2 Die Entwicklungsphasen des Coaching-Begriffs.
- 3.3 Coaching, Mentoring und Training
- 3.4 Ziele des Coachings
- 3.5 Anforderungen an den Coach.
- 3.6 Rollenverteilung des Coaches
- 3.6.1 Führungsrolle des Sponsors / Mentors.
- 3.6.2 Führungsrolle des Trainers/Lehrers
- 3.6.3 Führungsrolle des Beraters
- 3.6.4 Führungsrolle des Chefs
- 3.7 Grundlegende Coaching-Prozess-Elemente.
- 3.7.1 Ziele, Visionen und Verantwortung.
- 3.7.2 Kontextanalyse und Messkriterien.
- 3.7.3 Lösungen für Probleme erarbeiten.
- 3.7.4 Wertschätzung und Feedback
- 3.8 Methoden erfolgreichen Coachings
- 3.8.1 Prinzip Nr. 1: Überzeugung
- 3.8.2 Prinzip Nr. 2: Overlearning
- 3.8.3 Prinzip Nr. 3: Flexibilität
- 3.8.4 Prinzip Nr. 4: Beständigkeit.
- 3.8.5 Prinzip Nr. 5: Integrität.
- 3.9 Richtige Kommunikation als Coaching-Werkzeug.
- 3.9.1 Das Entwicklungs- und Zielvereinbarungsgespräch.
- 3.9.2 Das Feedbackgespräch.
- 3.9.3 Das Problemlösungsgespräch
- 3.9.4 Das Trainingsgespräch.
- 4 Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis ....
- Abb. 1: Management-by-Methoden
- Abb. 2: Portfolio der Entscheidungskompetenz und der Konzentration _
- Abb. 3: Die Entwicklung des Coaching-Begriffs.
- Abb. 4: Coaching, Mentoring und Training im Vergleich.
- Abb. 5: Ziele des Coachings.
- Abb. 6: Die Rollenvielfalt des Coaches.
- Abb. 7: Fachliche und persönliche Anforderungen an den Coach.
- Abb. 8: Grundlegende Coaching-Prozess-Elemente
- Abb. 9: Die fünf Erfolgsgeheimnisse erfolgreichen Coachings.
- Definition und Entwicklung des Coaching-Begriffs
- Ziele und Anforderungen des Coachings
- Rollen des Coaches im Coaching-Prozess
- Methoden und Prinzipien erfolgreichen Coachings
- Kommunikation als Coaching-Werkzeug
Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit dem Thema Coaching als moderner Führungsmethode. Ziel ist es, den Coaching-Prozess im Kontext der Mitarbeiterführung zu analysieren und die verschiedenen Facetten dieser Führungsmethode zu beleuchten. Dabei werden die Entwicklungsphasen des Coaching-Begriffs, die Ziele des Coachings, die Rollen des Coaches und die wichtigsten Methoden des erfolgreichen Coachings betrachtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Notwendigkeit moderner Führungsmethoden in Unternehmen. Es wird erläutert, warum klassische Führungsstile in der heutigen Zeit an ihre Grenzen stoßen und warum Coaching als moderne Führungsmethode eine wichtige Rolle spielt.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs "Führung". Es werden verschiedene Führungsstile, wie autokratische, kooperative und laisser-faire Führung, sowie Management-by-Methoden vorgestellt und analysiert.
Im dritten Kapitel wird die Führungsmethode Coaching im Detail betrachtet. Es werden die Definition des Coaching-Begriffs, die Entwicklungsphasen des Coaching-Begriffs, die Ziele des Coachings, die Anforderungen an den Coach und die Rollenverteilung des Coaches im Coaching-Prozess erläutert. Außerdem werden die wichtigsten Methoden und Prinzipien erfolgreichen Coachings vorgestellt.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Kommunikation als Coaching-Werkzeug. Es werden verschiedene Gesprächsanlässe im Coaching-Prozess, wie das Entwicklungs- und Zielvereinbarungsgespräch, das Feedbackgespräch, das Problemlösungsgespräch und das Trainingsgespräch, analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Coaching, Führung, Mitarbeiterführung, moderne Führungsmethoden, Coaching-Prozess, Ziele des Coachings, Rollen des Coaches, Methoden des Coachings, Kommunikation, Gesprächsanlässe, Entwicklungs- und Zielvereinbarungsgespräch, Feedbackgespräch, Problemlösungsgespräch, Trainingsgespräch.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Coaching im Kontext der modernen Mitarbeiterführung?
Coaching wird als moderne Führungsmethode verstanden, die dort ansetzt, wo Weiterentwicklung, Unterstützung und die Stärkung von persönlichen Leistungspotenzialen der Mitarbeiter gefragt sind.
Welche Ziele verfolgt der Coaching-Prozess in Unternehmen?
Das Ziel ist die Verbesserung der individuellen Leistungsfähigkeit sowie letztendlich die Steigerung der Gesamtleistungsfähigkeit des Unternehmens durch gezielte Förderung der Mitarbeiter.
Welche Rollen nimmt ein Coach gegenüber seinen Mitarbeitern ein?
Ein Coach kann verschiedene Rollen ausfüllen, darunter die des Sponsors oder Mentors, des Trainers bzw. Lehrers, des Beraters und natürlich die Rolle des Vorgesetzten.
Welche Gesprächsanlässe sind für erfolgreiches Coaching entscheidend?
Wichtige Werkzeuge sind das Entwicklungs- und Zielvereinbarungsgespräch, das Feedbackgespräch, das Problemlösungsgespräch sowie das spezifische Trainingsgespräch.
Welche Prinzipien führen zum Erfolg im Coaching?
Zu den Erfolgsgeheimnissen gehören Überzeugung, Flexibilität, Beständigkeit, Integrität und das Prinzip des Overlearning, die oft aus dem Spitzensport adaptiert werden.
- Citar trabajo
- Lars Zimmermann (Autor), 2008, Coaching. Die moderne Führungsmethode, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288330