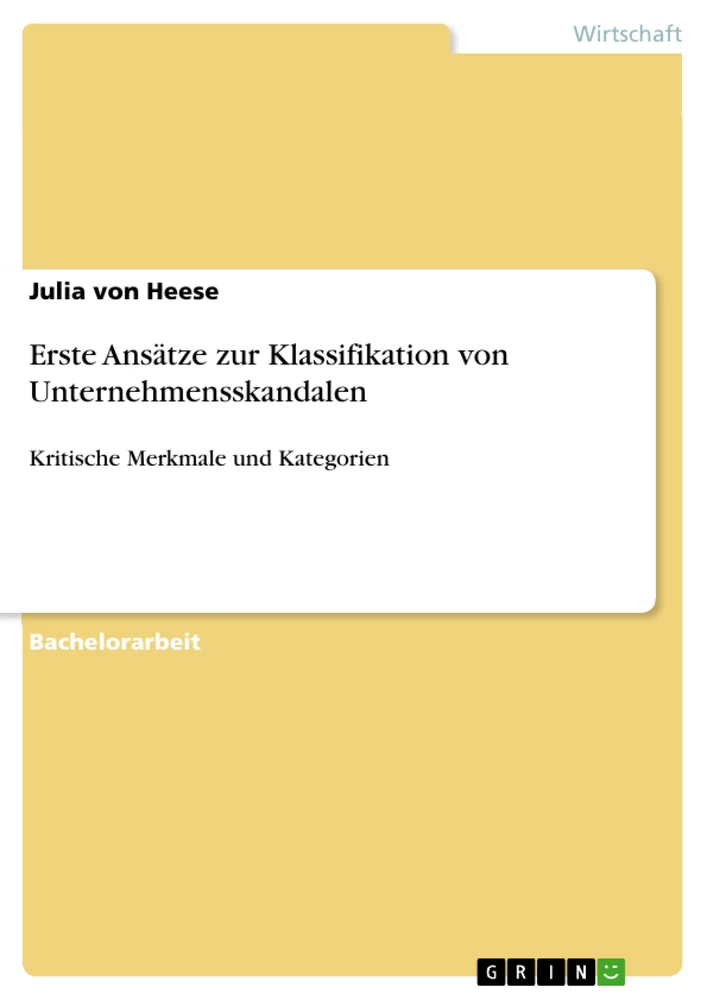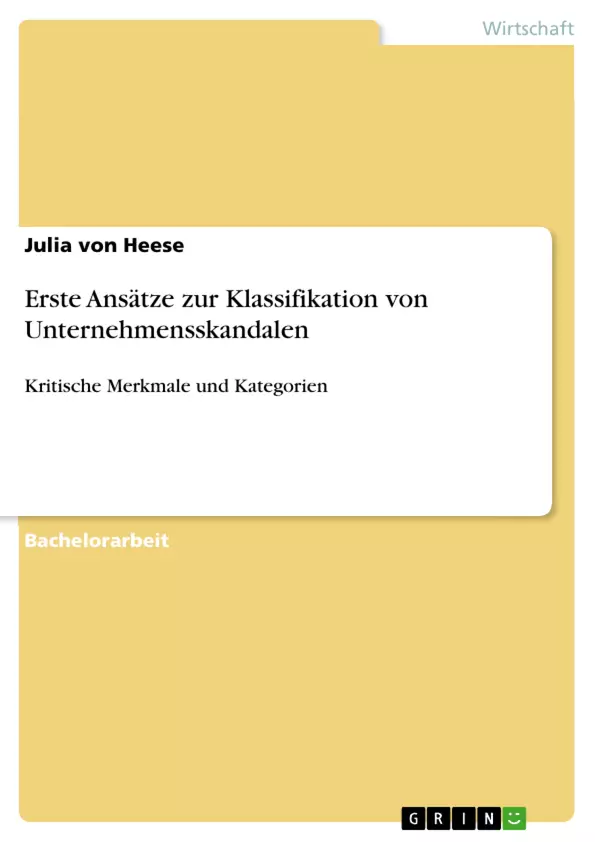Skandale sind so alt wie die Gesellschaft selbst. Nachrichten über Skandale erreichen uns jeden Tag über die verschiedensten Medien. Egal, ob wir das Radio einschalten oder einfach nur die Zeitung aufschlagen. Sie sind so präsent geworden, dass wir uns gar keine Gedanken darüber machen, wie sie überhaupt entstehen, wie sie ans Licht kommen und wer genau verantwortlich ist. Der deutsche Journalist Carsten Germis sagte darüber einmal sehr zutreffend: „Der Skandal, so scheint es, ist das Selbstverständlichste von der Welt, über das sich kein Wort zu verlieren lohnt“. In der Tat scheint jedes noch so kleine Abweichen von der gesellschaftlichen Normalität auf irgendeine Weise das Potenzial zum Skandal in sich zu bergen. Aber was verbirgt sich hinter diesem Konzept?
Die vorliegende Arbeit untersucht auf dem noch weitestgehend unerforschten Gebiet der Kategorisierung von Unternehmensskandalen, wie ein Skandal entsteht und was eigentlich die Voraussetzungen für einen solchen darstellt, um ihn als „Unternehmensskandal“ zu bezeichnen. Im Gegensatz zum Politikskandal ist dieser Begriff schwer zu erfassen, obwohl seit Ausbruch der Bankenkrise im Jahr 2008 täglich über Bilanzfälschungen, Steuersparmodelle, Bankenrettung, Zinsmanipulation, Mitarbeiterentlassungen, Managergehälter, über den Tisch gezogene Bankkunden und den Allgemeinplatz „Unternehmerische Verantwortung für die Gesellschaft“ berichtet wird. Ziel dieser Arbeit ist es, die Ansätze aus der Literatur zur Erklärung dieses Phänomens fruchtbar zu machen, um daraus eine eindeutige Klassifikation für die Erscheinung des „Unternehmensskandals“ zu erreichen.
Die Arbeit ist in vier Kapitel unterteilt, von denen im ersten (vgl. Kapitel 2) auf die Entstehung des Skandalbegriffs eingegangen wird sowie dessen heutige Bedeutung und die allgemeinen Skandalvoraussetzungen. Im zweiten (vgl. Kapitel 3) werden die verschiedenen Ansätze aus der Literatur analysiert, um eine einheitliche Klassifizierung von Unternehmensskandalen vorzunehmen und kurz einen Einblick zur Vorbeugung und Bewältigung eines Skandals aufzuzeigen, um im Anschluss daran eine abschließende Darstellung (vgl. Kapitel 4) zu liefern, welche Auswirkungen dies auf ein Unternehmen haben kann. Zum Ende schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung (vgl. Kapitel 5) der wichtigsten Ergebnisse ab.
Inhaltsverzeichnis
- Problemaufriss und Herangehensweise
- Die Entstehung des Skandalbegriffs
- Der historische Skandalbegriff
- Die heutige Skandaldefinition
- Allgemeine Skandalvoraussetzungen
- Die Skandal-Triade
- Skandalpublikum
- Die Phasen eines Skandals
- Der Unternehmensskandal
- Bisherige Begriffsdefinition des Unternehmensskandals
- Besondere Skandalvoraussetzungen des Unternehmensskandals
- Auf Unternehmensinteresse gerichtetes, wirtschaftliches Handeln
- Die Multi-Dimensionalität des Stakeholder-Ansatzes
- Die CSR-Debatte: Unternehmensskandale als Phänomen introvertierter Unternehmensführung
- Das Konzept einer Hypernorm als kulturübergreifende Referenzskala normativ erwünschten Handelns
- Corporate Social Responsibility oder Irresponsibility: zwei Seiten derselben Medaille
- Die öffentliche Wahrnehmung von Normverstößen
- Kategorisierung von Unternehmensskandalen
- Klassifikation verschiedener Unternehmensskandale
- Der Enron-Fall: Anwendung auf das Schema der Unternehmensskandale
- Ein anwendungsbezogener Ausblick auf die Auswirkungen von Unternehmensskandalen und deren Vorbeugung/Bewältigung
- Auswirkungen des Unternehmensskandals
- Skandalvorbeugung und Skandalbewältigung als Schutz für das Unternehmen
- Zusammenfassung der Ergebnisse und Desiderata
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Klassifizierung von Unternehmensskandalen. Ziel ist es, kritische Merkmale und Kategorien zu identifizieren und zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Skandalbegriffs und dessen aktuelle Definition, um spezifische Voraussetzungen von Unternehmensskandalen zu erarbeiten.
- Entwicklung und Definition des Skandalbegriffs
- Spezifische Merkmale von Unternehmensskandalen
- Der Einfluss des Stakeholder-Ansatzes
- Die Rolle der Corporate Social Responsibility (CSR)
- Kategorisierung und Klassifizierung von Unternehmensskandalen
Zusammenfassung der Kapitel
Problemaufriss und Herangehensweise: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und beschreibt die Methodik der Arbeit. Es skizziert den Forschungsansatz und die Fragestellungen, die im weiteren Verlauf untersucht werden. Die Bedeutung der Klassifizierung von Unternehmensskandalen für Theorie und Praxis wird herausgestellt.
Die Entstehung des Skandalbegriffs: Dieses Kapitel analysiert die historische Entwicklung des Skandalbegriffs und dessen Wandel über die Zeit. Es werden verschiedene Definitionen des Skandals verglichen und die Entwicklung von einer rein moralischen Bewertung hin zu einer komplexeren Betrachtungsweise nachgezeichnet. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung der allgemeinen Voraussetzungen, die für die Entstehung eines Skandals notwendig sind, wie z.B. die "Skandal-Triade" und das "Skandalpublikum". Die verschiedenen Phasen eines Skandals werden ebenfalls beleuchtet.
Der Unternehmensskandal: Dieses Kapitel widmet sich der spezifischen Betrachtung von Unternehmensskandalen. Es werden existierende Definitionen diskutiert und besondere Voraussetzungen, die sich aus dem wirtschaftlichen Handeln von Unternehmen und dem Stakeholder-Ansatz ergeben, herausgestellt. Die CSR-Debatte und deren Relevanz für die Entstehung und Wahrnehmung von Unternehmensskandalen wird eingehend analysiert. Das Kapitel gipfelt in einer Kategorisierung und Klassifizierung von verschiedenen Unternehmensskandalen. Dabei wird u.a. der Enron-Fall exemplarisch untersucht.
Ein anwendungsbezogener Ausblick auf die Auswirkungen von Unternehmensskandalen und deren Vorbeugung/Bewältigung: In diesem Kapitel werden die Auswirkungen von Unternehmensskandalen auf die betroffenen Unternehmen und Stakeholder untersucht. Es werden Maßnahmen zur Vorbeugung und Bewältigung von Skandalen vorgestellt, um die negativen Folgen zu minimieren. Die Bedeutung proaktiver Strategien im Umgang mit potenziellen Risiken wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Unternehmensskandal, Skandalbegriff, Stakeholder-Ansatz, Corporate Social Responsibility (CSR), Kategorisierung, Klassifizierung, Hypernorm, Risikomanagement, Krisenkommunikation, normatives Handeln.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Klassifizierung von Unternehmensskandalen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Klassifizierung von Unternehmensskandalen. Sie analysiert kritische Merkmale und Kategorien von Unternehmensskandalen und beleuchtet die historische Entwicklung sowie die aktuelle Definition des Skandalbegriffs, um spezifische Voraussetzungen von Unternehmensskandalen zu erarbeiten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung und Definition des Skandalbegriffs, spezifische Merkmale von Unternehmensskandalen, den Einfluss des Stakeholder-Ansatzes, die Rolle der Corporate Social Responsibility (CSR), sowie die Kategorisierung und Klassifizierung von Unternehmensskandalen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse des Enron-Falls als Beispiel für einen Unternehmensskandal.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Problemaufriss und Herangehensweise, Die Entstehung des Skandalbegriffs, Der Unternehmensskandal (inkl. CSR-Debatte und Kategorisierung von Skandalen), und Ein anwendungsbezogener Ausblick auf die Auswirkungen von Unternehmensskandalen und deren Vorbeugung/Bewältigung. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was versteht die Arbeit unter einem Unternehmensskandal?
Die Arbeit definiert den Unternehmensskandal im Kontext der historischen Entwicklung des Skandalbegriffs und unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Handelns von Unternehmen und des Stakeholder-Ansatzes. Sie betrachtet Unternehmensskandale als mehrdimensionale Ereignisse, die durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die CSR-Debatte und die öffentliche Wahrnehmung von Normverstößen.
Welche Rolle spielt die Corporate Social Responsibility (CSR)?
Die CSR-Debatte wird in der Arbeit als zentraler Aspekt für die Entstehung und Wahrnehmung von Unternehmensskandalen analysiert. Die Arbeit untersucht, wie CSR-Konzepte und deren Umsetzung (oder deren Fehlen) zu Skandalen beitragen können und welche Rolle die öffentliche Wahrnehmung von Normverstößen spielt.
Wie werden Unternehmensskandale kategorisiert und klassifiziert?
Die Arbeit entwickelt ein Schema zur Kategorisierung und Klassifizierung von Unternehmensskandalen. Der Enron-Fall dient als Beispiel für die Anwendung dieses Schemas. Die Klassifizierung zielt darauf ab, kritische Merkmale und Kategorien von Unternehmensskandalen zu identifizieren und zu analysieren.
Welche Auswirkungen haben Unternehmensskandale?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Unternehmensskandalen auf die betroffenen Unternehmen und Stakeholder. Sie beleuchtet die negativen Folgen und stellt Maßnahmen zur Vorbeugung und Bewältigung von Skandalen vor, um diese Folgen zu minimieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Unternehmensskandal, Skandalbegriff, Stakeholder-Ansatz, Corporate Social Responsibility (CSR), Kategorisierung, Klassifizierung, Hypernorm, Risikomanagement, Krisenkommunikation, normatives Handeln.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit beschreibt ihren Forschungsansatz und die Methodik im Kapitel "Problemaufriss und Herangehensweise". Die genaue Methodik wird im Detail in der Arbeit selbst erläutert.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit Unternehmensethik, Risikomanagement, Krisenkommunikation und der Analyse von Unternehmensskandalen befassen. Sie ist insbesondere für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich Wirtschaft und Management von Interesse.
- Quote paper
- Julia von Heese (Author), 2014, Erste Ansätze zur Klassifikation von Unternehmensskandalen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288462