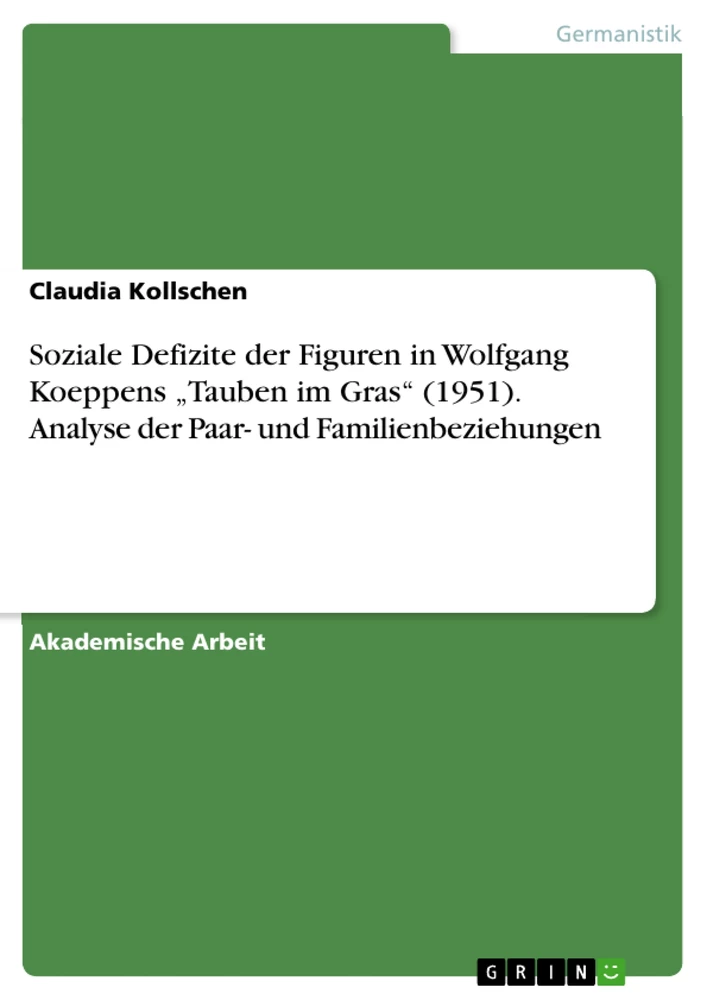Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den sozialen Defiziten der Handlungsträger in Wolfgang Koeppens „Tauben im Gras“ aus dem Jahr 1951. Anhand der unterschiedlichen Paar- und Familienbeziehungen soll aufgezeigt werden, dass die sozialen Verhältnisse der Romanfiguren durchaus als problematisch angesehen werden müssen.
Wolfgang Koeppens Gestalten gehen zumeist isoliert ihrer Wege, ungeachtet der vielfältigen Begegnungen, die in der Mehrzahl jedoch oberflächlich bleiben, und gleichwohl sie aufeinander bezogen sind: „The theme of isolation [...] is brought into sharp focus when individuals are shown to be isolated even though they are almost constantly surrounded by other people.“ Die Figuren leben nebeneinander, nicht miteinander und auch in Paarbeziehungen und Familien wird diese Isolation, die immer auch eine kommunikative ist, nicht durchbrochen. In allen sozialen Verhältnissen sind beträchtliche Defizite auszumachen, beispielsweise an Interesse, Verständnis, Tiefe oder Wahrhaftigkeit. Neben einer Egozentrik aufgrund von Überforderung durch eine schwierige Gegenwart ist zu beobachten, dass die Figuren bewusst ihre persönliche Bedürfnisbefriedigung zur einzigen Maxime erheben: „Das Nachdenken endet an den Grenzen des eigenen Ichs.
Ein Verstehen der anderen wird überhaupt nicht angestrebt.“ Die defizitären Beziehungen sind „symptomatisch für den Zustand der Gesellschaft“ in diesem Roman
Inhaltsverzeichnis
- Soziale Defizite
- Paarbeziehungen
- Philipp und Emilia
- Christopher und Henriette Gallagher
- Washington Price und Carla
- Herr Behrend und Vlasta
- Odysseus Cotton und Susanne
- Familienbeziehungen
- Kontinuität
- Carla und Heinz
- Ezra Gallagher
- Hillegonda
- Paarbeziehungen
- Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
- Primärliteratur
- Gespräche und Interviews
- Sekundärliteratur
- Sonstige verwendete Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die sozialen Defizite der Figuren in Wolfgang Koeppens Roman „Tauben im Gras“ (1951). Durch die Untersuchung der Paar- und Familienbeziehungen wird deutlich, dass die sozialen Verhältnisse der Romanfiguren problematisch sind. Die Arbeit zielt darauf ab, die Ursachen und Auswirkungen dieser Defizite aufzuzeigen und die Rolle der Figuren in der Gesellschaft zu beleuchten.
- Isolation und mangelnde Kommunikation in den Beziehungen
- Egozentrik und fehlendes Verständnis für die Bedürfnisse anderer
- Die Rolle von materieller Sicherheit und gesellschaftlicher Herkunft
- Die Auswirkungen des Krieges und der Nachkriegszeit auf die Beziehungen
- Die Bedeutung von Sprache und Erzählstruktur für die Darstellung der sozialen Defizite
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der sozialen Defizite der Figuren in Wolfgang Koeppens „Tauben im Gras“. Es wird gezeigt, dass die Figuren in ihren Beziehungen zueinander isoliert und unfähig sind, tiefe Bindungen aufzubauen. Die Kommunikation ist mangelhaft und die Bedürfnisse der einzelnen Figuren werden oft nicht berücksichtigt. Die Arbeit untersucht verschiedene Paarbeziehungen, darunter die von Philipp und Emilia, Christopher und Henriette Gallagher, Washington Price und Carla, Herr Behrend und Vlasta sowie Odysseus Cotton und Susanne. Es wird deutlich, dass die Beziehungen von Konflikten, Missverständnissen und mangelnder Kommunikation geprägt sind. Die Arbeit beleuchtet auch die Familienbeziehungen im Roman, insbesondere die von Carla und Heinz, Ezra Gallagher und Hillegonda. Es wird gezeigt, dass auch in den Familien die sozialen Defizite deutlich werden. Die Arbeit analysiert die Ursachen dieser Defizite und zeigt, wie sie sich auf das Leben der Figuren auswirken.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen soziale Defizite, Paar- und Familienbeziehungen, Isolation, Kommunikation, Egozentrik, materieller Sicherheit, gesellschaftliche Herkunft, Krieg und Nachkriegszeit, Sprache, Erzählstruktur, Wolfgang Koeppen, Tauben im Gras.
Häufig gestellte Fragen
Welche sozialen Defizite werden in "Tauben im Gras" analysiert?
Die Arbeit untersucht Isolation, mangelnde Kommunikation, Egozentrik und das Unvermögen der Figuren, tiefe Bindungen in Paar- und Familienbeziehungen aufzubauen.
Warum sind die Beziehungen in Koeppens Roman problematisch?
Die Figuren leben nebeneinander statt miteinander. Ihre Interaktionen bleiben oberflächlich, oft bedingt durch die Überforderung mit der schwierigen Nachkriegsgegenwart.
Welche Paarbeziehungen stehen im Fokus der Analyse?
Untersucht werden unter anderem Philipp und Emilia, Washington Price und Carla sowie Christopher und Henriette Gallagher.
Welchen Einfluss hat die Nachkriegszeit auf die Figuren?
Die schwierige Gegenwart führt zu einer Egozentrik, bei der das Nachdenken an den Grenzen des eigenen Ichs endet und Verständnis für andere kaum angestrebt wird.
Inwiefern sind die Beziehungen symptomatisch für die Gesellschaft?
Die defizitären Beziehungen spiegeln den Zustand einer zerrissenen Gesellschaft nach dem Krieg wider, in der materielle Sicherheit oft über emotionaler Tiefe steht.
- Quote paper
- Claudia Kollschen (Author), 2004, Soziale Defizite der Figuren in Wolfgang Koeppens „Tauben im Gras“ (1951). Analyse der Paar- und Familienbeziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288482