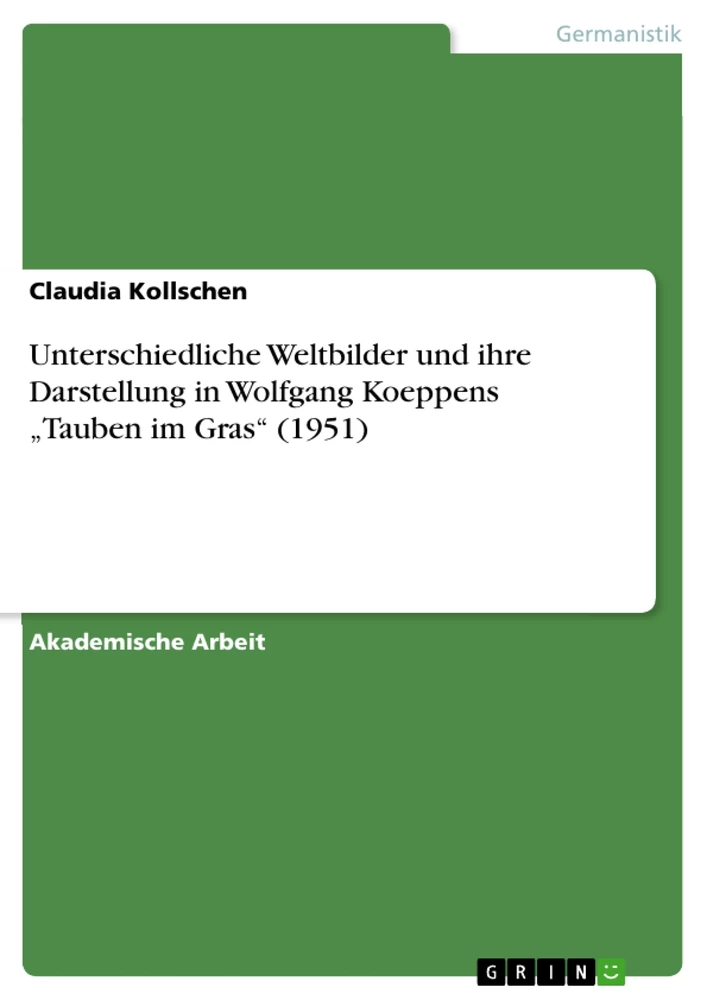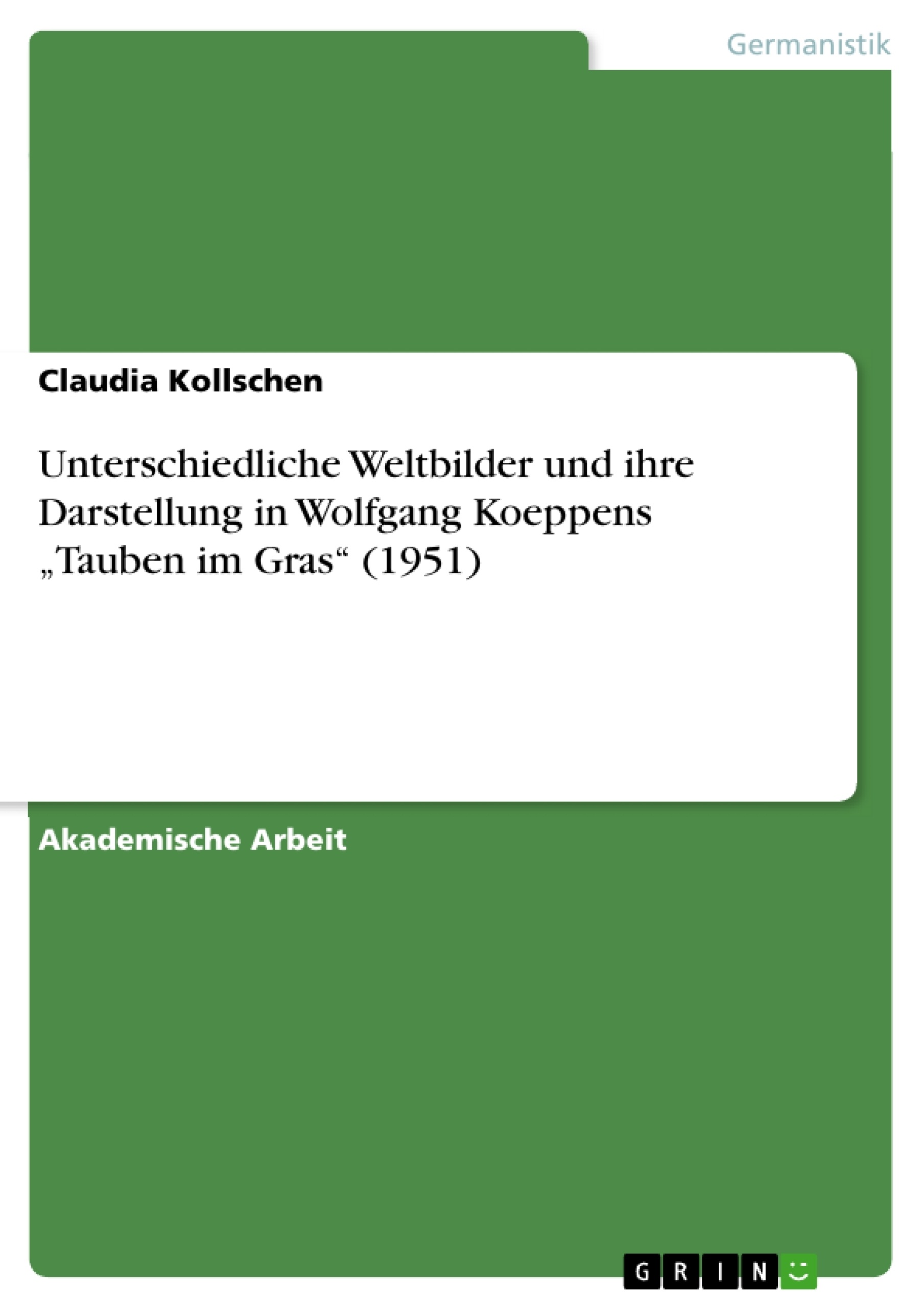Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Weltbildern, die in Wolfgang Koeppens Roman „Tauben im Gras“ aus dem Jahr 1951 eine Rolle spielen. Neben einem amerikanischen und einem christlich-humanistischen Weltbild soll auch die Bedeutung von Kunst und Literatur , die Wissenschaft und die Religion analysiert werden.
Die im Rahmen der 'Umerziehungsprogramme' versuchte Vermittlung neuer, demokratischer Werte durch die Besatzer ist prägend in Zeit und Roman; hier werden aufgrund des gewählten Schauplatzes amerikanische Weltbilder in verschiedenen Nuancen zur Darstellung gebracht.
Mr. Edwin hat Amerika denn auch den Rücken gekehrt zugunsten des europäischen Kontinents, von dessen Geist und Tradition er durchdrungen ist. Der Dichter vertritt eine „konservative, elitäre, christlich-moralische Kulturideologie“, „eine Ideologie abendländischer Tradition, des autonomen Geistes, der Heilsgewißheit und des Humanismus“15. Seine Sinnproklamationen speisen sich demgemäß aus Antike, Renaissance und deutschem Idealismus16 und gipfeln in der Überzeugung, dass die christliche Religion „das einzige wärmende Licht“ (II 204) sei, mit dessen Erlöschen die europäische Kultur in die Barbarei zurückfalle.
Viele Figuren verweigern sich ganz der Gegenwart und einem Umdenken. Zu ihnen „gehören Frau Behrend, die Ladenbesitzerin, die Eltern der Verkäuferin in der Sockenabteilung des Kaufhauses sowie all die Händler, Geschäftsleute und Biertischstrategen in den Stehausschänken.“47 Sie versuchen mittels Kontinuität in Werten, Weltbild und Leben, der Angst, der Orientierungslosigkeit und den anderen Schwierigkeiten der Zeit zu entgehen. Dabei verdrängen sie Unangenehmes und Schrecken, flüchten sich in vergangene Zeiten, als noch 'Ordnung' herrschte und sie etwas repräsentierten, finden hier ein fragiles Glück. Auch einer sozialen Isolation entgehen sie, sind die 'Gesinnungsgleichen' doch zahlreich und erkennen einander schnell. Die Leiden der Menschen, die sich mit der schwierigen Gegenwart auseinandersetzen (müssen), treffen diese Figuren offenbar nicht.
Inhaltsverzeichnis
- Weltbilder
- Amerikanische Weltbilder
- Christlich-humanistisches Weltbild
- Die Bedeutung von Kunst und Literatur
- Wissenschaftliches Weltbild
- Religion
- Kontinuität - Unverändertes Weltbild
- Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
- Primärliteratur
- Gespräche und Interviews
- Sekundärliteratur
- Sonstige verwendete Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die verschiedenen Weltbilder, die in Wolfgang Koeppens Roman „Tauben im Gras“ (1951) dargestellt werden. Der Fokus liegt auf der Darstellung amerikanischer und christlich-humanistischer Weltbilder sowie der Bedeutung von Kunst, Literatur, Wissenschaft und Religion im Kontext des Romans.
- Darstellung unterschiedlicher Weltbilder im Roman
- Analyse amerikanischer Weltbilder im Kontext der Nachkriegszeit
- Bedeutung von Kunst und Literatur als Ausdruck von Weltbildern
- Wissenschaftliche und religiöse Perspektiven auf die Welt
- Kontinuität und Wandel von Weltbildern im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Weltbildern, die im Roman eine Rolle spielen. Es werden amerikanische, christlich-humanistische und wissenschaftliche Weltbilder sowie die Bedeutung von Kunst und Literatur und die Rolle der Religion analysiert.
Das zweite Kapitel untersucht die amerikanischen Weltbilder im Kontext der Nachkriegszeit und der Umerziehungsprogramme der Besatzer. Es werden verschiedene amerikanische Figuren vorgestellt, die unterschiedliche Perspektiven auf die Welt vertreten. Die Analyse zeigt, dass die amerikanischen Weltbilder im Roman nicht uneingeschränkt positiv dargestellt werden, sondern auch kritisch betrachtet werden.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem christlich-humanistischen Weltbild, das im Roman ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Es werden die Figuren vorgestellt, die dieses Weltbild vertreten, und es wird analysiert, wie dieses Weltbild im Kontext der Nachkriegszeit und der amerikanischen Besatzung verstanden werden kann.
Das vierte Kapitel untersucht die Bedeutung von Kunst und Literatur im Roman. Es wird gezeigt, wie Kunst und Literatur als Ausdruck von Weltbildern dienen und wie sie die Figuren und ihre Perspektiven auf die Welt beeinflussen.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Rolle der Wissenschaft im Roman. Es wird analysiert, wie wissenschaftliche Erkenntnisse und Perspektiven im Roman dargestellt werden und wie sie sich auf die Weltbilder der Figuren auswirken.
Das sechste Kapitel untersucht die Rolle der Religion im Roman. Es wird gezeigt, wie Religion im Kontext der Nachkriegszeit und der amerikanischen Besatzung verstanden werden kann und wie sie sich auf die Weltbilder der Figuren auswirkt.
Das siebte Kapitel befasst sich mit der Frage der Kontinuität und des Wandels von Weltbildern im Roman. Es wird analysiert, wie sich die Weltbilder der Figuren im Laufe des Romans verändern und wie sie sich auf die Handlung des Romans auswirken.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Weltbilder in Wolfgang Koeppens Roman „Tauben im Gras“, amerikanische Weltbilder, christlich-humanistisches Weltbild, Kunst und Literatur, Wissenschaft, Religion, Kontinuität, Nachkriegszeit, Umerziehungsprogramme, Besatzung, deutsche Gesellschaft, amerikanische Besatzer, Kulturkonflikt, Identität, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Rassismus, Optimismus, Fortschritt, Nützlichkeit, Zivilisation, Vernunft.
Häufig gestellte Fragen
Welche Weltbilder werden in "Tauben im Gras" thematisiert?
Der Roman kontrastiert amerikanische Weltbilder der Besatzer mit christlich-humanistischen Traditionen, wissenschaftlichen Sichtweisen und religiösen Überzeugungen.
Wie wird das amerikanische Weltbild dargestellt?
Es wird im Kontext der Umerziehungsprogramme und demokratischen Werte gezeigt, wobei Koeppen auch kritische Nuancen und Nuancen des Kulturkonflikts einbezieht.
Welche Rolle spielt die Figur Mr. Edwin?
Mr. Edwin vertritt eine konservative, elitäre Kulturideologie der abendländischen Tradition und sieht in der christlichen Religion das "einzige wärmende Licht".
Warum verweigern sich einige Figuren der Gegenwart?
Figuren wie Frau Behrend flüchten in ein unverändertes Weltbild der Vergangenheit, um der Angst und Orientierungslosigkeit der Nachkriegszeit zu entgehen.
Welche Bedeutung haben Kunst und Literatur im Roman?
Sie dienen als Ausdrucksmittel für die verschiedenen Weltbilder und beeinflussen maßgeblich die Perspektiven der Figuren auf ihre Umwelt.
- Quote paper
- Claudia Kollschen (Author), 2004, Unterschiedliche Weltbilder und ihre Darstellung in Wolfgang Koeppens „Tauben im Gras“ (1951), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288484