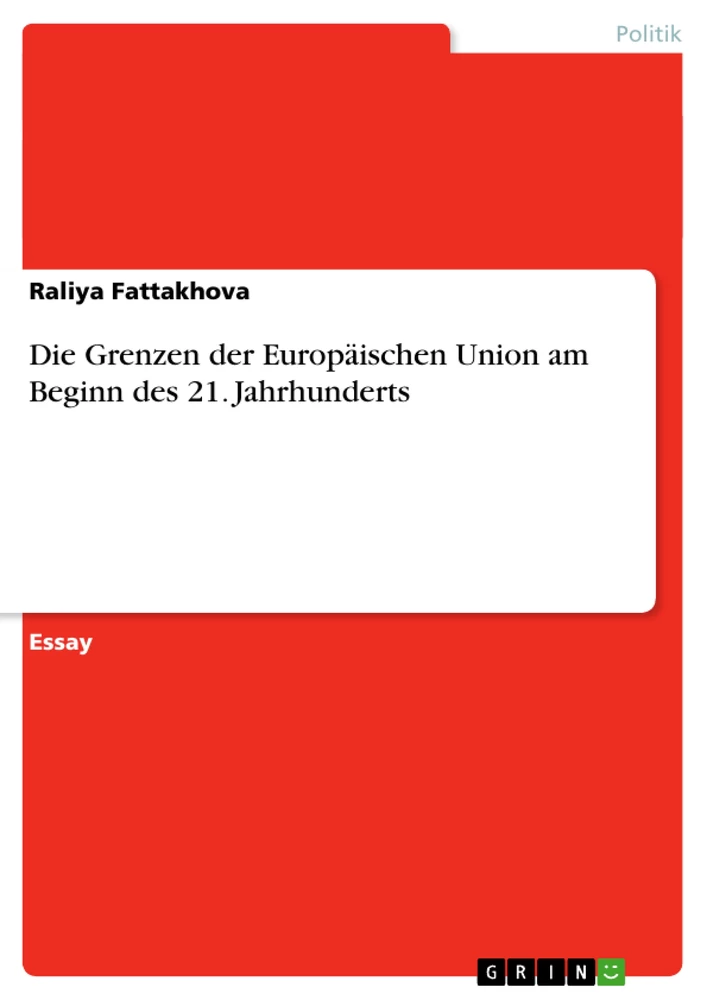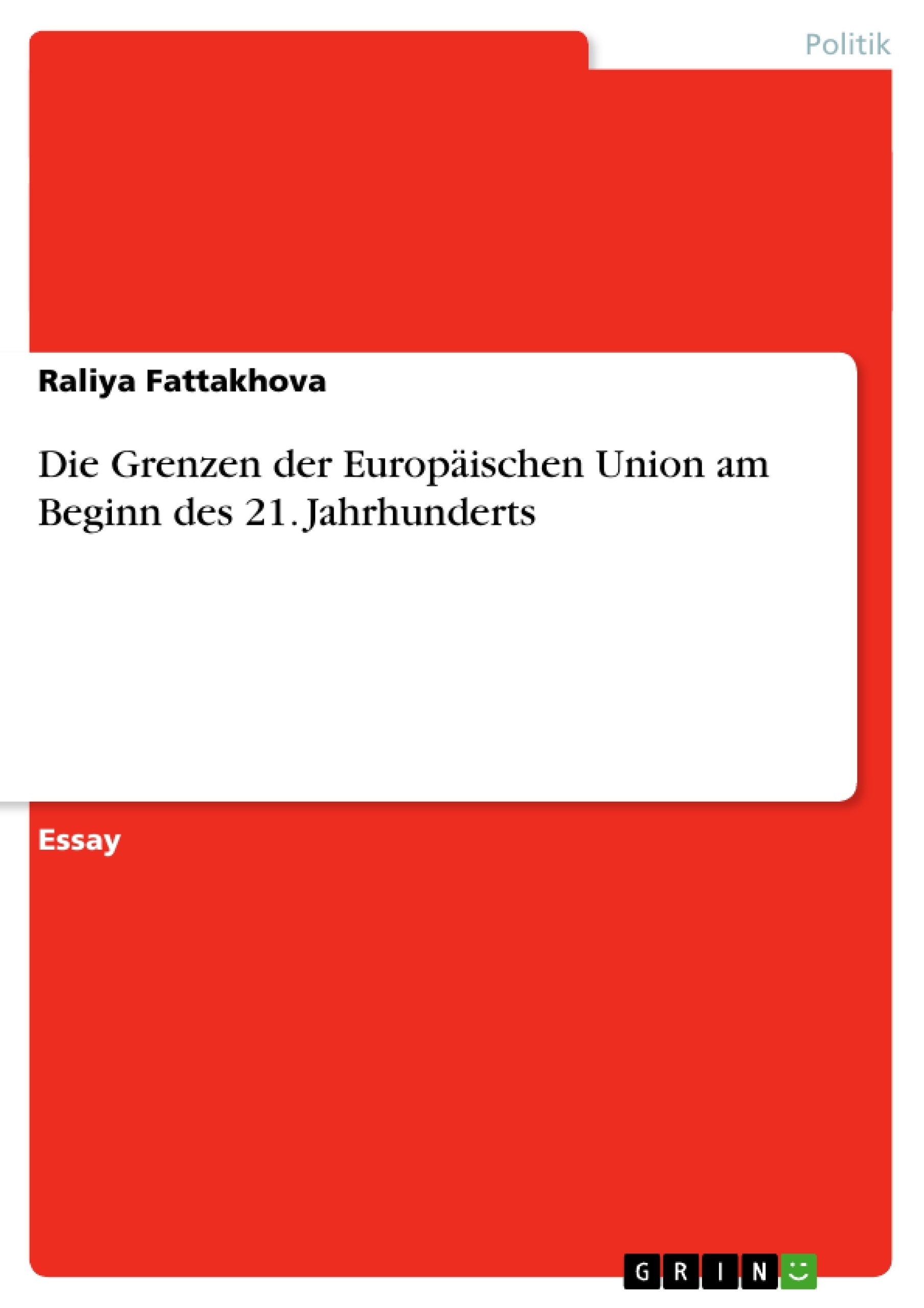Der Essay untersucht die Trends der EU-Grenzpolitik Innen sowie Außen und ordnet diese in traditionelle Konzepte politischer Herrschaft ein.
Die modernen EU-Grenzen stellen sich als abgegrenzter Raum mit der «Auflösung» der Innengrenzen dar.
Unter der «Auflösung» meine ich kein Wegfallen von Grenzen, sondern die Schwächung ihrer Kontrollfunktion.
In der heutigen globalisierten Welt gibt es verschiedene vielfältige Definitionen der Grenzen. Einige verstehen unter der Grenze einen “durch entsprechende Markierungen gekennzeichneten Geländestreifen, der politische Gebilde (Länder, Staaten) voneinander trennt“. Andere bezeichnen sie als den Rand einer Territorialität mit politischer Herrschaft.
Man kann weitere Definitionen angeben, aber alle laufen darauf hinaus, dass die Grenze eine Trennlinie zwischen zwei und mehr unterschiedlichen Objekten bzw. Subjekten ist.
Die modernen EU-Grenzen stellen sich als abgegrenzter Raum mit der «Auflösung» der Innengrenzen dar. Unter der «Auflösung» meine ich kein Wegfallen von Grenzen, sondern die Schwächung ihrer Kontrollfunktion.
In der heutigen globalisierten Welt gibt es verschiedene vielfältige Definitionen der Grenzen. Einige verstehen unter der Grenze “(durch entsprechende Markierungen gekennzeichneter) Geländestreifen, der politische Gebilde (Länder, Staaten) voneinander trennt“.[1] Die Anderen bezeichnen sie als den Rand einer Territorialität mit politischer Herrschaft. Man kann weitere Definitionen angeben, aber alle laufen darauf hinaus, dass die Grenze eine Trennlinie zwischen zwei und mehr unterschiedlichen Objekten bzw. Subjekten ist.
In der Politikwissenschaft betrachtet man die Grenze als eine Trennlinie zwischen verschiedenen autonomen und souveränen Gebieten (Kontinente, Staaten, Länder usw.), die über eine Staatlichkeit verfügen. Das heißt, die Macht jedes souveränen Staates beschränkt sich innerhalb seiner Territorialität bzw. seiner Grenzen.
Mit dem Blick auf die gegenwärtige Weltordnung kann man kaum behaupten, dass die Herrschaft eines Staates da endet, wo die Macht des anderen beginnt. So kann ich am Beispiel der EU eine neue Entwicklungstendenz der Entgrenzung innerhalb der Europäischen Union und gleichzeitig die Abgrenzung der Außengrenzen beobachten.
Zuerst will ich auf die Grenzproblematik im Rahmen der EU eingehen. Ich stelle klar heraus, dass das Phänomen der Entgrenzung hier stattfindet. Wie schon bemerkt wurde, ist Entgrenzung keine Auflösung bzw. Wegfallen von Grenzen, sondern die Schwächung ihrer Funktionen.Dadurch entsteht ein neuartiger Grenzraum sowohl mit den oberen Behörden und Regeln, als auch mit ihrer eigenen Identität.
Die Europäische Union stellt sich als ein solcher Grenzraum dar. Europäisches Parlament und Europäische Kommission sind die obersten Institutionen der Union, die Verfassung der Europäische Union gilt als oberste Regel und die Mitglieder der EU haben ihre eigene Identität als«Europäer». Innerhalb der europäischen Innengrenzen können sowohl die Menschen als auch die Waren sich frei bewegen (Die EU-Mitglieder brauchen im Rahmen der Union kein Visum und die Waren und Dienstleistungen sind zollfrei). Das heißt, die Grenzen verlieren ihre Hauptfunktion der Kontrolle. Was noch bemerkenswert ist, dass bei diesem Phänomen jeder Mitgliedstaat seine eigene Souveränität und Staatlichkeit behielt und seine Interessen auf der europäischen Ebene repräsentiert werden. Darauf gehe ich weiter unten ein.
Gleichzeitig sieht man aber in der EU eine Entwicklungstendenz der sogenannten (1) Abgrenzung und (2) Herausbildung territorialer Identität, die von Mathias Albert als «Glokalisierung» bezeichnet wurde.[2]
Zu 1): Trotz der Schwächung der Kontrollfunktion bleiben in der EU die Grenzen als Schutzlinie ihrer Staatlichkeit und Souveränität. Beim Grenzübergang treffen Europäer gewisse Schwierigkeiten in solchen Bereichen wie Arbeitsmarkt, Sozial- und Rechtssystem, Gesundheits- und Ausbildungspolitik. Die Situation in diesen Sphären sieht in jedem EU-Mitgliedstaat unterschiedlich aus und wurde auf der Europäischen Ebene nicht geregelt, was man als Hindernisse beim Grenzübergang bezeichnen kann.
Zu 2): Die andere Entwicklungstendenz in der EU habe ich als Glokalisierung bezeichnet. In einer Reihe mit Entgrenzung und Abgrenzung bildet die Glokalisierung eine nationale Identität jedes Landes mit seinen Besonderheiten in einem globalisierten Raum. Dieses Phänomen hat seinen Platz in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel Politik, Wirtschaft und Kultur. Folglich ist im Europäischen Parlament jeder Mitgliedstaat vertreten, deren Interessen auf europäischer Ebene berücksichtig werden müssen. Hinsichtlich der Wirtschaft, versucht jedes Land seine eigene kulturelle Identität bzw. Besonderheiten beizubehalten und im globalen System sich auszeichnen zu lassen: Deutschland als Automobiltechnologieführer; Frankreich als Weinproduzent; Großbritannien durch seinen Finanzplatz usf.
Zusammenfassend bedeutet dies, dass die europäischen Binnengrenzen mehr entgrenzt als abgegrenzt sind. Die heutigen Grenzen haben sich seit Jahrhunderten entwickelt, aufgrund dessen ihre gemeinsame Geschichte beruht. Die EU stellt einen entgrenzten Raum durch enge Verflechtung ihrer Mitgliedstaaten dar und will dadurch einen der stärksten Akteure auf internationaler Ebene begründen. Nichtsdestotrotz, existieren heutzutage Sphären, die durch die EU nicht reguliert werden können und als Hindernisse beim Grenzübergang gelten.
Ich gehe nun von der Binnengrenzproblematik der Europäischen Union zu den Außengrenzen über, die als Trennlinie zwischen der EU und ihren Nachbarländern gilt. Die EU-Außengrenze ist 14.151 km lang und hat 25 Nachbarländer. Eine solch große Nachbarschaft beinhaltet auch vielfältige Grenzprobleme, die im Regionen-Vergleich äußerst unterschiedlich sind. Man sieht eine deutliche Beschränkung der EU durch ihre strenge Kontrollfunktion und Beitrittsbedingungen, aber gleichzeitig eine intensive Zusammenarbeit mit Nachbarländern und schrittweise Ausweitung nach Osten. Aus diesem Grund will ich die Problematik der Entgrenzung und Abgrenzung am Beispiel der Ost- und Südgrenzen betrachten.
Die Ostgrenzpolitik bezeichne ich als offene Türen mit geschlossenen Toren. Hier versucht die EU die Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn auszubauen und ihre Grenze weiter auszuweiten (offene Türen), aber stellt dabei strenge Regeln für bilaterale Partnerschaft, die in osteuropäischen Ländern bestimmte Probleme verursachen und als Einschränkung der Möglichkeiten für Kooperation gilt (geschlossene Toren). So sind unter strengen Bedingungen neue osteuropäische Länder (wie z.B. Estland, Polen, Tschechische Republik usw.) der EU beigetreten, wobei dieser Prozess der EU-Erweiterung bis heutzutage aktuell bleibt. Dafür gilt als ein gutes und aktuelles Beispiel die europäische Grenze zur Ukraine. Als erster Schritt zur Entgrenzung in dieser Region wurde das Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU initiiert, aber aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und Energieabhängigkeit von Russland durch die Ukraine abgelehnt. Das Abkommen war ein entscheidender Punkt für offenen der Tore zur EU und weitere intensive Zusammenarbeit, was am Ende zum Beitritt der Ukraine bzw. zur Erweiterung der EU nach Osten geführt hätte. Hier sind die Interessen von zwei regionalen Mächtenzusammengestoßen: einerseits der EU und USA, anderseits Russland. Das Abkommen hat beide Seiten in Gefahr gebracht, dessen Folgen bis heute unlösbar bleiben.
[...]
[1] DUDEN, verfügbar unter: http://www.duden.de/rechtschreibung/Grenze#Bedeutung1a, abgerufen am 05.03.2014, 12 Uhr.
[2] Albert, Mathias 1998: Entgrenzung und Formierung neuer politischer Räume, in: Regieren in entgrenzten Räumen, hg. von Mathias Albert u.a., PVS-Sonderheft 29/1998, Nomos: Opladen/Wiesbaden, S. 49-76.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die "Auflösung" der EU-Innengrenzen?
Die Auflösung bedeutet kein Wegfallen der Grenzen, sondern eine Schwächung ihrer Kontrollfunktion, was freien Personen- und Warenverkehr ermöglicht.
Was versteht man unter dem Begriff "Glokalisierung" in der EU?
Glokalisierung beschreibt die gleichzeitige Entgrenzung nach außen und die Stärkung lokaler bzw. nationaler Identitäten innerhalb des globalisierten Raums der EU.
Warum bleiben Grenzen trotz Entgrenzung als Schutzlinien bestehen?
Grenzen schützen weiterhin die nationale Souveränität in Bereichen wie dem Arbeitsmarkt, dem Rechtssystem und der Sozialpolitik, die nicht vollständig EU-weit geregelt sind.
Wie unterscheidet sich die EU-Außengrenzpolitik von der Binnenpolitik?
Während im Inneren Entgrenzung herrscht, ist die Außengrenze durch strenge Kontrollen und Beitrittsbedingungen gekennzeichnet, was oft als "offene Türen bei geschlossenen Toren" bezeichnet wird.
Welche Herausforderungen gibt es an der EU-Ostgrenze?
Am Beispiel der Ukraine zeigt sich das Spannungsfeld zwischen der EU-Erweiterung und den Interessen regionaler Mächte wie Russland, was zu politischen Konflikten führt.
- Arbeit zitieren
- Raliya Fattakhova (Autor:in), 2014, Die Grenzen der Europäischen Union am Beginn des 21. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288615